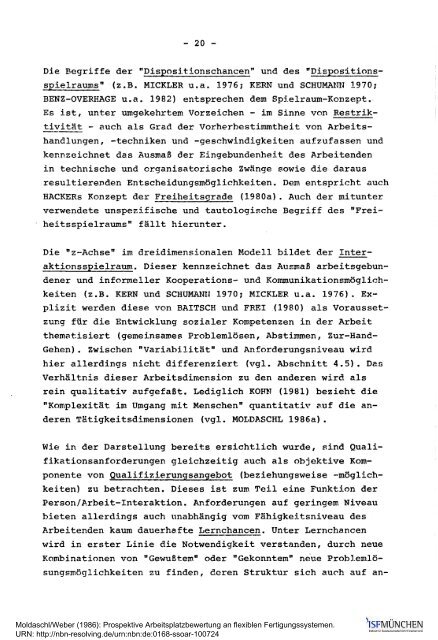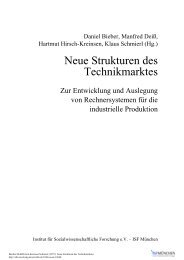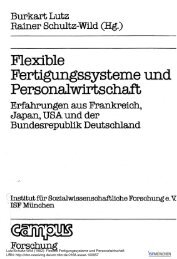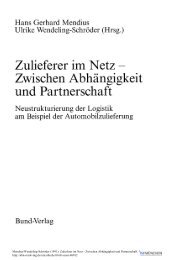Prospektive Arbeitsplatzbewertung an flexiblen ... - ISF München
Prospektive Arbeitsplatzbewertung an flexiblen ... - ISF München
Prospektive Arbeitsplatzbewertung an flexiblen ... - ISF München
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Begriffe der "Dispositionsch<strong>an</strong>cen" und des "Dispositionsspielraums"<br />
(z.B. MICKLER u.a. 1976; KERN und SCHUMANN 1970;<br />
BENZ-OVERHAGE u.a. 1982) entsprechen dem Spielraum-Konzept.<br />
Es ist, unter umgekehrtem Vorzeichen - im Sinne von Restriktivität<br />
- auch als Grad der Vorherbestimmtheit von Arbeitsh<strong>an</strong>dlungen,<br />
-techniken und -geschwindigkeiten aufzufassen und<br />
kennzeichnet das Ausmaß der Eingebundenheit des Arbeitenden<br />
in technische und org<strong>an</strong>isatorische Zwänge sowie die daraus<br />
resultierenden Entscheidungsmöglichkeiten. Dem entspricht auch<br />
HACKERs Konzept der Freiheitsgrade (1980a). Auch der mitunter<br />
verwendete unspezifische und tautologische Begriff des "Freiheitsspielraums"<br />
fällt hierunter.<br />
Die "z-Achse" im dreidimensionalen Modell bildet der Interaktionsspielraum.<br />
Dieser kennzeichnet das Ausmaß arbeitsgebundener<br />
und informeller Kooperations- und Kommunikationsmöglichkeiten<br />
(z.B. KERN und SCHUMANN 1970; MICKLER u.a. 1976). Explizit<br />
werden diese von BAITSCH und FREI (1980) als Voraussetzung<br />
für die Entwicklung sozialer Kompetenzen in der Arbeit<br />
thematisiert (gemeinsames Problemlösen, Abstimmen, Zur-H<strong>an</strong>d-<br />
Gehen). Zwischen "Variabilität" und Anforderungsniveau wird<br />
hier allerdings nicht differenziert (vgl. Abschnitt 4.5). Das<br />
Verhältnis dieser Arbeitsdimension zu den <strong>an</strong>deren wird als<br />
rein qualitativ aufgefaßt. Lediglich KOHN (1981) bezieht die<br />
"Komplexität im Umg<strong>an</strong>g mit Menschen" qu<strong>an</strong>titativ auf die <strong>an</strong>deren<br />
Tätigkeitsdimensionen (vgl. MOLDASCHL 1986a).<br />
Wie in der Darstellung bereits ersichtlich wurde, sind Qualifikations<strong>an</strong>forderungen<br />
gleichzeitig auch als objektive Komponente<br />
von Qualifizierungs<strong>an</strong>gebot (beziehungsweise -möglichkeiten)<br />
zu betrachten. Dieses ist zum Teil eine Funktion der<br />
Person/Arbeit-Interaktion. Anforderungen auf geringem Niveau<br />
bieten allerdings auch unabhängig vom Fähigkeitsniveau des<br />
Arbeitenden kaum dauerhafte Lernch<strong>an</strong>cen. Unter Lernch<strong>an</strong>cen<br />
wird in erster Linie die Notwendigkeit verst<strong>an</strong>den, durch neue<br />
Kombinationen von "Gewußtem" oder "Gekonntem" neue Problemlösungsmöglichkeiten<br />
zu finden, deren Struktur sich auch auf <strong>an</strong>-<br />
Moldaschl/Weber (1986): <strong>Prospektive</strong> <strong>Arbeitsplatzbewertung</strong> <strong>an</strong> <strong>flexiblen</strong> Fertigungssystemen.<br />
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100724