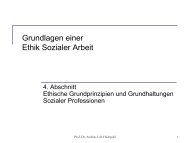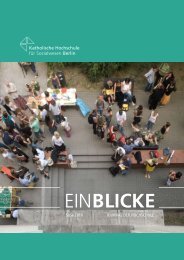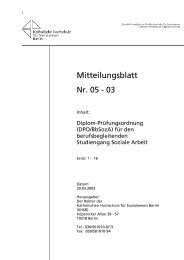EINBLICKE - KHSB
EINBLICKE - KHSB
EINBLICKE - KHSB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einblick<br />
7<br />
Widerstand gegen Rechtsextremismus als Christenpflicht<br />
Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl<br />
Die Positionierung des damaligen Vorsitzenden<br />
der CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Lorenz Jäger, dass der<br />
»Kampf gegen Rechtsextremismus (...) eigentlich<br />
eine Christenpflicht« sei, hat im letzten<br />
Jahr und in diesem Frühjahr eine breite Debatte<br />
in der politischen und kirchlichen Landschaft<br />
angestoßen. In diesem Zusammenhang wurde<br />
das Berliner Institut für christliche Ethik und<br />
Politik (ICEP) beauftragt, die Frage zu untersuchen,<br />
ob und in welcher Weise Christinnen und<br />
Christen von den Grundlagen ihres Glaubens<br />
her zum Widerstand gegen den Rechtsextremismus<br />
aufgerufen seien.<br />
Der Rechtsextremismus, der sich durch<br />
»völkische Denkmuster, ein daraus abgeleitetes<br />
Menschenbild, autoritär-rigide<br />
Ordnungsvorstellung und die Berufung<br />
auf das Führerprinzip« (Greß/Jaschke/<br />
Schönekäs 1990) auszeichnet, steht im<br />
schroffen Gegensatz zum demokratischen<br />
Verfassungsstaat. Darüber hinaus<br />
bestreiten seine Vertreter – auch in Unterscheidung<br />
zu anderen politischen Extremismen<br />
wie dem Kommunismus oder<br />
dem Anarchismus – grundsätzlich das<br />
»Prinzip menschlicher Fundamentalgleichheit«<br />
(Backes/Jesse). Dieses strikte Gleichheitsprinzip<br />
ist jedoch nicht nur für den<br />
bundesdeutschen Verfassungsstaat konstitutiv,<br />
sondern auch für das Christentum.<br />
Es wurzelt in der absolut gleichen Menschenwürde<br />
jedes Menschen als Ebenbild<br />
Gottes, die keinerlei Nuancierungen oder<br />
Abstufungen – etwa im Sinne rassistischer,<br />
sozialdarwinistischer, sexistischer<br />
oder kultur-ethnozentristischer Auffassungen<br />
– zulässt. Rassismus und Christentum<br />
schließen sich kategorisch aus. Das<br />
Zweite Vatikanische Konzil hat anerkannt,<br />
dass es in vielen politischen Fragen legitimerweise<br />
unterschiedliche Auffassungen<br />
geben kann, zu denen Christen nach reiflicher<br />
Gewissensbildung kommen können<br />
(vgl. Gaudium et spes 43). Damit anerkennt<br />
das Konzil grundsätzlich die Legiti-<br />
mität politischer Pluralität, die das Konzil<br />
als Ausdruck der Autonomie weltlicher<br />
Sachbereiche wertet (vgl. GS 36). Sie findet<br />
freilich dort ihre absolute Grenze, wo<br />
politische Auffassungen und Praktiken die<br />
»Achtung vor der menschlichen Person«<br />
bzw. »die wesentliche Gleichheit aller<br />
Menschen und die soziale Gerechtigkeit«<br />
verletzten oder sogar beseitigen wollen<br />
(vgl. GS 27f): »Doch jede Form einer<br />
Diskriminierung in den gesellschaftlichen<br />
und kulturellen Grundrechten der Person,<br />
sei es wegen des Geschlechts oder der<br />
Rasse, der Farbe, der gesellschaftlichen<br />
Stellung, der Sprache oder der Religion,<br />
muß überwunden und beseitigt werden,<br />
da sie dem Plan Gottes widerspricht.«<br />
(GS 29)<br />
Damit ist zugleich jeder Gleich-Gültigkeit,<br />
also jeder indifferenten Haltung eines<br />
Christen gegenüber dem Rechtsextremismus<br />
eine unzweideutige Absage erteilt.<br />
Christen sind wie Kirche insgesamt zur<br />
Weltverantwortung, die Politik im Sinne<br />
der aktiven Gestaltung des Öffentlichen<br />
Raumes notwendig einschließt,<br />
aufgerufen, durch die sie die Hoffnung,<br />
die in ihnen ist, auch »in den gewöhnlichen<br />
Verhältnissen der Welt« (Lumen<br />
gentium 35) zum Ausdruck bringen.<br />
Besondere Verantwortung kommt jenen<br />
Christen zu, die als Politiker maßgeblich<br />
die Ordnung des Weltlebens gestalten.<br />
Auch für christliche Politiker gelten die<br />
vorgenannte legitime Pluralität politischer<br />
Auffassungen und damit auch die<br />
legitime Pluralität politischer Strategien.<br />
Insofern sie aber als Christen politische<br />
Verantwortung übernehmen, binden sie<br />
ihr politisches Handeln an das Fundament<br />
und die normativen Implikationen ihres<br />
Glaubens. Insofern sind sie nicht erst<br />
als besonders politisch verantwortliche<br />
Staatsbürger, sondern schon als Christen<br />
zur Gegenwehr gegenüber politischen<br />
Extremen und insbesondere gegenüber<br />
dem Rechtsextremismus verpflichtet.<br />
Verantwortliches solidarisches Handeln<br />
von Christinnen und Christen gründet<br />
sodann auf den normativen Grundsätzen<br />
der Menschenrechte, die die Ermöglichungsstruktur<br />
menschenwürdiger Lebensführung<br />
darstellen. Auch die Kirche<br />
identifiziert sich mit dem Anliegen der<br />
Menschenrechte, das wesentlich für ihr<br />
soziales Engagement und für das Zeugnis<br />
der frohen Botschaft insgesamt ist. (GS<br />
41). Der spezifisch moralische Verpflichtungsgehalt<br />
von Menschenrechten weist<br />
auf ein konstitutives Reziprozitätsverhältnis<br />
von Rechten und Pflichten hin,<br />
das für das Gelingen einer zivilen und<br />
demokratischen Gesellschaft von hoher<br />
Bedeutung ist. Diese wichtige Ressource<br />
demokratischer Aushandlungsprozesse<br />
lässt sich mit dem Begriff der Solidarität<br />
übersetzen. Solidarität hebt auf die<br />
»konstruktive Verpflichtung« aller Träger<br />
von Menschenrechten ab, die ihnen gewährten<br />
Rechtsansprüche nicht nur nicht<br />
zu Lasten, sondern vielmehr zugunsten<br />
anderer Rechtsträger zu nutzen. Der eigene<br />
unverfügbare Anspruch auf ein menschenwürdiges<br />
Leben begründet zugleich<br />
die Pflicht zur Anerkennung der Ansprüche<br />
anderer auf eine menschenwürdige<br />
Existenz und deshalb auch die Pflicht, Gestaltungsverantwortung<br />
für die humanen<br />
Lebensbedingungen anderer zu übernehmen.<br />
Wo Menschen mit Verweis auf die<br />
Unverfügbarkeit ihrer Menschenwürde<br />
Freiheits-, Gleichheits- und Teilhaberechte<br />
einfordern, stehen sie in der Pflicht, die<br />
gleichen Rechtsansprüche allen anderen<br />
zuzubilligen – und zwar nicht nur, indem<br />
sie sie grundsätzlich anerkennen, sondern<br />
auch durch tätige Mithilfe an deren konkreter<br />
Verwirklichung. Aus diesem Grund<br />
stehen auch die Kirchen und alle Christinnen<br />
und Christen in der Pflicht, bei<br />
der Anerkennung, dem Schutz und der<br />
Durchsetzung dieser Rechte mitzuwirken.<br />
Aus diesen Überlegungen folgt, dass der<br />
Rechtsextremismus eine Form politischer