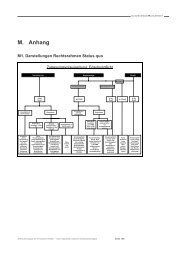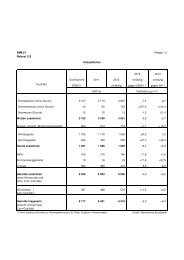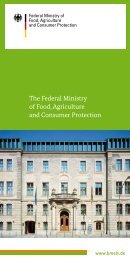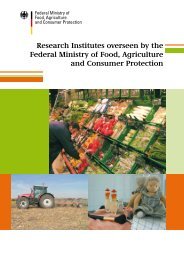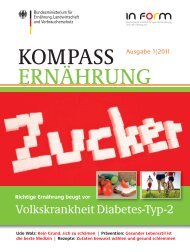Berichte über Landwirtschaft - Bundesministerium für Ernährung ...
Berichte über Landwirtschaft - Bundesministerium für Ernährung ...
Berichte über Landwirtschaft - Bundesministerium für Ernährung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
372 Agnes Klein, Klaus Menrad<br />
gessen ist außerdem, dass die Projekte gerade in der Startphase häufig keine relevanten<br />
Beiträge zum Betriebsergebnis der beteiligten Landwirte leisten. Aus diesen Gründen ist<br />
es notwendig, dass die Marktleistung der Projekte von den Beteiligten realistisch eingeschätzt<br />
und kommuniziert wird. So ist es beispielsweise nicht vertretbar, den beteiligten<br />
Landwirten unrealistische Versprechen bezüglich erzielbarer Milchpreise zu geben. Dies<br />
ist v. a. insofern kritisch und als fragwürdig zu beurteilen, als teilnehmende Landwirte<br />
zum Beispiel bestehende Lieferverträge mit ihrer Molkerei gekündigt oder Investitionen<br />
getätigt habe (z. B. Umstellung auf GVO-freie Fütterung). Außerdem sollte durch die<br />
Kommunikation der Verantwortlichen auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass man<br />
mithilfe eines solchen Projektes die „Probleme“ der ganzen Wertschöpfungskette Milch<br />
lösen und insgesamt aus dem bestehenden Preisgefüge am Markt ausbrechen kann. Wahrscheinlicher<br />
ist dagegen, dass solche Projekte nur <strong>für</strong> bestimmte Unternehmen und eine<br />
eingeschränkte Anzahl an Erzeugern ein interessantes Differenzierungspotenzial bieten<br />
und eine Erfolg versprechende Marktnische darstellen können.<br />
Etablierung von allgemeingültigen „Fair-Kriterien“ und Übertragung auf den Milchsektor<br />
Die Kernaussage in der Kommunikation der meisten untersuchten Projekte besteht darin,<br />
dass durch das Projekt „Fairness“ erreicht wird. Dabei unterscheiden sich sowohl die<br />
Zielpersonen/-gruppen, <strong>für</strong> die „Fairness“ erreicht werden soll (z. B. nur Erzeuger, auch<br />
Verbraucher etc.), als auch die Art und Weise, wie „Fairness“ erreicht werden soll, zwischen<br />
den Projekten. Vielfach bleibt das „Fairness“-Argument bei den Initiativen aber<br />
bisher verhältnismäßig schwammig und unklar. Auch eine gesetzliche Definition oder<br />
ein allgemein gültiges Verständnis des Begriffs ist (noch) nicht vorhanden. Anzunehmen<br />
ist zwar, dass Konsumenten aufgrund der „Fair Trade“-Bewegung ein gewisses „Vorverständnis“<br />
haben, was im Lebensmittelsektor unter „fair“ zu verstehen ist. Andererseits<br />
lässt die steigende Anzahl an Initiativen, die in den letzten Jahren entstanden ist, vermuten,<br />
dass sich ein gewisser Markt <strong>für</strong> „Domestic Fair Trade“ entwickelt. Aus Wettbewerbs-<br />
und Verbraucherschutzgründen wären daher allgemeingültige und verbindliche<br />
Definitionen und Kriterien <strong>für</strong> „Fairness/fair“ notwendig. Nur so kann gewährleistet werden,<br />
dass es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt, wenn unterschiedliche Niveaus/<br />
Auslegungsgrade von „Fairness“ insolchen Projekten kommuniziert und zugrunde gelegt<br />
werden. Außerdem kann nur auf diese Weise sichergestellt werden, dass Verbraucher die<br />
in der Kommunikation verwendeten Angaben <strong>für</strong> ihre Kaufentscheidung nutzen können<br />
und dass Verbrauchertäuschung vorgebeugt bzw. verhindert wird. Einige solcher „Fair“-<br />
Kataloge existieren bereits. Auffällig ist, dass ein Großteil davon aus der Bio-Branche<br />
stammt. So hat z. B. Naturland „Fair-Kriterien“ entwickelt (28). Auch der Verein „Bio<br />
Bestes Fair- Für alle“ und der Anbauverband „Biokreis“ besitzen einen solchen Katalog<br />
(45). Weitere Beispiele sind eher aus Regionalbewegungen entstanden (z. B. FairRegional<br />
Charta Berlin Brandenburg) oder stammen aus der „Domestic Fair Trade“-Bewegung<br />
des angelsächsischen Sprachraums (4; 10; 11). Diese existierenden Kataloge könnten als<br />
Grundlage <strong>für</strong> eine gemeinsame Entwicklung von „Fair-Kriterien“ dienen.<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mittlerweile eine ganze Reihe von<br />
(regionalen) Milchvermarktungsprojekten existieren, die mit einer Unterstützung der<br />
beteiligten Erzeuger bzw. „Fairness zum Landwirt“ werben. Viele dieser Projekte sind<br />
noch verhältnismäßig „neu“ am Markt. Auffällig ist dabei, dass gerade diese „jungen“ Initiativen<br />
oftmals vom Handel aufgebaut wurden und die Produkte unter einer Eigenmarke<br />
des betreffenden Handelsunternehmens vermarktet werden. Inwieweit diese Projekte langfristig<br />
erfolgreich am Markt bestehen werden, ist derzeit kaum absehbar, dasie einerseits<br />
einer Vielzahl an Hemmnissen und Barrieren gegen<strong>über</strong>stehen. Andererseits weisen sie<br />
aufgrund ihrer Projektorganisation zum Teil aber auch erheblichen Verbesserungsbedarf<br />
Buel_3_11.indb 372 17.11.2011 08:13:09