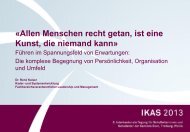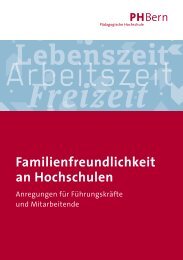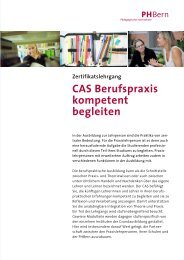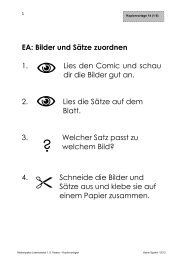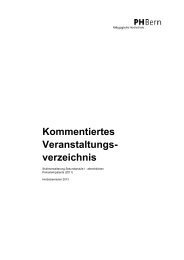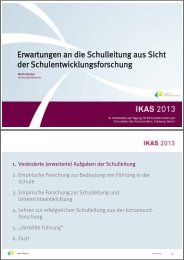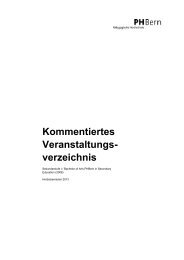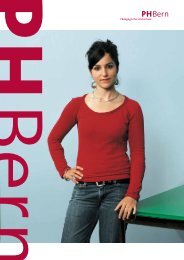Gender an der Mittelschule - PHBern
Gender an der Mittelschule - PHBern
Gender an der Mittelschule - PHBern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>an</strong>gemessene Strategie gewählt. Die fehlerfeindliche Haltung im<br />
gängigen Unterricht ist dafür mitver<strong>an</strong>twortlich. Auch <strong>der</strong> hohe<br />
Zeitdruck, dem sowohl die Lehrpersonen als auch die Lernenden<br />
ausgesetzt sind, trägt zu einem oberflächlichen und stör<strong>an</strong>fälligen<br />
Anlernen bei. Und schliesslich ist die weit verbreitete<br />
kleinschrittige Methodik entl<strong>an</strong>g einer vorgegebenen Stoffsystematik<br />
ein weiterer Faktor, <strong>der</strong> die Haltung <strong>der</strong> ‹erlernten Hilflosigkeit›<br />
för<strong>der</strong>t.<br />
An<strong>der</strong>e Denkstile<br />
Darüber hinaus zeigen die Mädchen ein grösseres Bedürfnis<br />
nach Genauigkeit und Gründlichkeit. Dies könnte mit einer<br />
Präferenz für einen prädikativen Denkstil in Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
stehen (vgl. Seite 23). Darunter wird eine kognitive Struktur verst<strong>an</strong>den,<br />
die eher auf Beziehungsgeflechte und Ordnungsprinzipien<br />
ausgerichtet ist.<br />
Das von den Mädchen geäusserte Bedürfnis, den Unterrichtsstoff<br />
wirklich bzw. richtig verstehen zu wollen, könnte darauf<br />
hindeuten, dass die Mädchen sich ein umfassendes inneres<br />
Bild von <strong>der</strong> Struktur des Gegenst<strong>an</strong>des machen wollen. Dazu<br />
benötigen sie ausreichend viel Zeit. Die oben beschriebenen<br />
‹Haltegriffe› können beim Auau einer in sich stimmigen, vernetzten<br />
internen Repräsentation hilfreich sein und haben damit<br />
möglicherweise die Funktion von Strukturierungshilfen. Der<br />
Wunsch einer Teilgruppe <strong>der</strong> Jungen nach einer Beschleunigung<br />
des Unterrichtstempos und einem weniger gründlichen<br />
Vorgehen könnte dagegen mit einem funktionalen Denkstil in<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g stehen. Die Jungen, die sich den For<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Mädchen <strong>an</strong>geschlossen haben, verfügen möglicherweise<br />
ebenso wie die Mädchen über einen prädikativen Denkstil.<br />
Sozialisation<br />
Die Vorliebe <strong>der</strong> Mädchen für ein zeitintensiveres und gründliches<br />
Vorgehen im Unterricht könnte auch mit <strong>der</strong> geschlechtertypischen<br />
Sozialisation in Zusammenh<strong>an</strong>g stehen: Mädchen<br />
lernen eher enge, auf Gleichheit basierende Beziehungen aufzubauen.<br />
Dies erfor<strong>der</strong>t eine gründliche Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit<br />
den Ged<strong>an</strong>ken <strong>an</strong><strong>der</strong>er, und daraus resultiert möglicherweise<br />
auch das Bedürfnis, Probleme umfassend zu durchdenken (s.<br />
Jungwirth 1992).<br />
Eine weitere mögliche Erklärung für die Wünsche nach<br />
einer Be- bzw. Entschleunigung des Unterrichts könnte auch<br />
noch in einem unterschiedlichen mathematischen Leistungsvermögen<br />
zu finden sein. Da aber auch sehr gute Mathematikschülerinnen<br />
die gleichen Wünsche wie ihre in Mathematik weniger<br />
begabten Geschlechtsgenossinnen geäussert haben, erscheint<br />
mir diese Erklärung für die Mädchen nicht in Betracht<br />
zu kommen. Bei den Jungen hingegen könnte dieser Faktor<br />
durchaus eine Rolle gespielt haben.<br />
nicht Recht hat: ‹Ich habe im Koedukationsunterricht immer<br />
die Erfahrung gemacht: wenn m<strong>an</strong> sich nach den Mädchen richtet,<br />
so ist es auch für die Jungen richtig; umgekehrt aber nicht.›<br />
(Wagenschein 1965)<br />
Zumindest eine Teilgruppe <strong>der</strong> Jungen wird sich sehr l<strong>an</strong>gweilen,<br />
wenn allein den Bedürfnissen <strong>der</strong> Mädchen nachgegeben<br />
werden würde. Zudem: Wäre die Erfüllung aller ihrer Wünsche<br />
überhaupt für die Mädchen gut? M<strong>an</strong>che <strong>der</strong> geäusserten<br />
Bedürfnisse scheinen eher Ausdruck eines fehlenden Selbstvertrauens<br />
zu sein. Ich halte es für sinnvoller, das Selbstvertrauen<br />
<strong>der</strong> Mädchen zu stärken als den Wünschen zu entsprechen,<br />
<strong>der</strong>en Erfüllung sie in ihrer Unselbstständigkeit hält. Nach welchen<br />
Wünschen sollten sich also die Lehrpersonen im Sinne<br />
Wagenscheins richten? Das Kooperationsbedürfnis <strong>der</strong> Mädchen<br />
und ihr Wunsch, im eigenen Tempo arbeiten zu dürfen<br />
(d.h. ohne Zeitdruck), erscheinen mir typisch für ihre Art, sich<br />
den Stoff zu erschliessen (im Sinne eines gründlichen Verstehens<br />
im Austausch mit <strong>an</strong><strong>der</strong>en). Von <strong>der</strong> Berücksichtigung dieser<br />
Wünsche können nicht nur die Mädchen, son<strong>der</strong>n auch die<br />
Jungen sehr profitieren. Auch einige <strong>der</strong> gewünschten ‹Haltegriffe›<br />
können – wenn sie im Sinne von Strukturierungshilfen<br />
eingesetzt werden – für Mädchen und Jungen sehr hilfreich sein.<br />
Das Führen eines Regelhees, auf freiwilliger Basis zu bearbeitende<br />
zusätzliche Übungsblätter mit <strong>der</strong> Möglichkeit zur Selbstkontrolle<br />
o<strong>der</strong> Probearbeiten werden von Mädchen und Jungen<br />
sehr d<strong>an</strong>kbar aufgenommen. Aber auch mit getrenntgeschlechtlichem<br />
Unterricht habe ich inzwischen gute Erfahrungen<br />
gemacht. Den Bedürfnissen <strong>der</strong> Mädchen konnte in einem<br />
solchen Unterricht stärker nachgegeben werden. Allerdings war<br />
die Jungengruppe sehr inhomogen.<br />
Curriculare Verän<strong>der</strong>ungen allein werden aber vermutlich<br />
nicht ausreichen, um eine gleiche Teilhabe <strong>der</strong> Mädchen bzw.<br />
Frauen im MINT-Bereich zu erzielen. Die fehlende Repräsent<strong>an</strong>z<br />
<strong>der</strong> Mädchen und Frauen in diesem Bereich k<strong>an</strong>n m. E.<br />
nicht losgelöst von <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Geschlechterhierarchie verbundenen<br />
Zuschreibung dieses Bereiches zum männlichen Geschlecht<br />
betrachtet werden. Dennoch ist es lohnenswert, sich<br />
mit kleinen Schritten auf den Weg zu machen …<br />
Dr. phil. Sylvia Jahnke-Klein unterrichtet am Institut für Pädagogik mit<br />
Schwerpunkt Gymnasium <strong>an</strong> <strong>der</strong> Carl von Ossietzky-Universität in Oldenburg.<br />
Artikel übernommen aus: mathematik lehren, Heft 127.<br />
Wir d<strong>an</strong>ken für die Abdruckerlaubnis.<br />
25<br />
Konsequenzen<br />
Aus den vorgestellten Untersuchungsergebnissen ergeben sich<br />
eine Vielzahl von Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung<br />
und die Schulorg<strong>an</strong>isation, die hier nicht im Einzelnen vorgestellt<br />
werden können (siehe dazu Jahnke-Klein 2001). Insbeson<strong>der</strong>e<br />
die gemeinsamen Wünsche von Mädchen und Jungen<br />
geben konkrete Anregungen für die Verbesserung <strong>der</strong> Unterrichtspraxis.<br />
Doch wie soll mit den unterschiedlichen Bedürfnissen<br />
<strong>der</strong> Mädchen und einer Teilgruppe <strong>der</strong> Jungen umgeg<strong>an</strong>gen<br />
werden? Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin,<br />
dass Wagenschein mit seinem vielzitierten Satz vermutlich