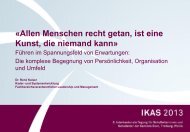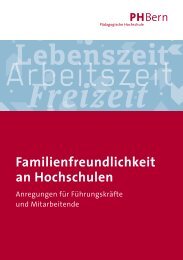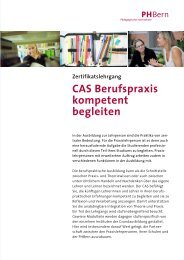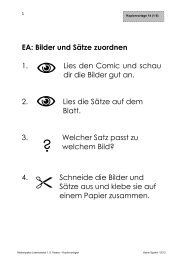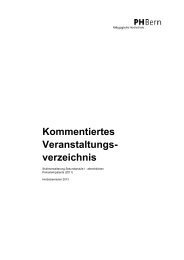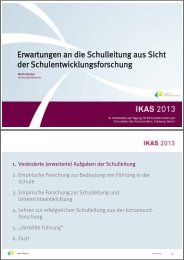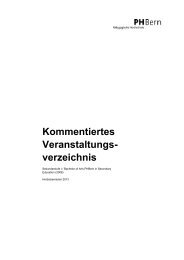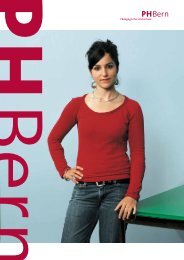Gender an der Mittelschule - PHBern
Gender an der Mittelschule - PHBern
Gender an der Mittelschule - PHBern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schwierige Themen:<br />
<strong>Gen<strong>der</strong></strong> im Kunstunterricht<br />
Ein Plädoyer für mehr Mut im Bildnerischen Gestalten<br />
¬ D<strong>an</strong>ja Erni<br />
34<br />
Im nachfolgenden Text werfe ich einen Blick auf meinen eigenen<br />
Unterricht sowie auf das Berufsfeld <strong>der</strong> Bildnerischen Gestaltung1<br />
(BG) Ausg<strong>an</strong>gspunkt dafür ist eine Netzwerkver<strong>an</strong>staltung, welche<br />
im J<strong>an</strong>uar 2011 <strong>an</strong> <strong>der</strong> Zürcher Hochschule <strong>der</strong> Künste stattgefunden<br />
hat: Persönlichkeitsverwicklung #1: Queer und Do-it-<br />
Yourself im Kunstunterricht. Dort stellte sich mir die Frage, weshalb<br />
<strong>der</strong> Einbezug von emen wie die Dekonstruktion von Geschlecht<br />
o<strong>der</strong> die ematisierung von Sexualität und <strong>Gen<strong>der</strong></strong> im<br />
BG-Unterricht kaum stattfindet, ja solche Fragen o als ‹schwierige<br />
emen› explizit vermieden werden. Ich möchte im Folgenden<br />
auf die Vorbehalte <strong>der</strong> Akteur_innen2 eingehen und erläutern,<br />
warum ich die Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit den ‹schwierigen<br />
emen› dennoch für produktiv und auch für notwendig halte –<br />
gerade für den BG-Unterricht. […]<br />
Einwände zu den schwierigien Themen<br />
Die Netzwerkver<strong>an</strong>staltung zu den emen Queer und Do-it-<br />
Yourself hat aus Sicht <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isator_innen deshalb eine<br />
grosse Relev<strong>an</strong>z für die Berufsausbildung, weil diese emen in<br />
<strong>der</strong> Berufspraxis weitgehend ausgeklammert werden und als<br />
‹heikel› gelten, wobei diese Einschätzung nicht für beide emen<br />
gleichermassen zu gelten scheint. Während die Kritik am<br />
Ansatz des DIY (zu dilett<strong>an</strong>tisch, zu nahe beim Basteln, politisches<br />
Statement sei wichtiger als <strong>der</strong> gestalterische Akt, u.ä.) vergleichsweise<br />
harmlos ausfällt, polarisiert das ema Queer, weshalb<br />
<strong>der</strong> Text darauf fokussiert.<br />
Was <strong>an</strong> <strong>der</strong> Beschäigung mit queeren Inhalten und Subjektpositionen<br />
als heikel eingeschätzt wird, lässt sich ungefähr<br />
mit folgenden Einwänden und Bedenken zusammenfassen:<br />
¬ ‹schwierige emen› würden die Schüler_innen nicht interessieren,<br />
weil sie keinen Bezug zu ihrer Lebenswelt hätten<br />
¬ die Schüler_innen würden sich von ‹schwierigen emen›<br />
überfor<strong>der</strong>t fühlen: die Betonung <strong>der</strong> Konstruktion von Geschlecht<br />
würde die Schüler_innen in einem unzumutbaren<br />
Masse verunsichern<br />
¬ die politische und ideologische Ausrichtung ‹schwieriger<br />
emen› komme einer Einmischung <strong>der</strong> Lehrperson in die<br />
Privatsphäre <strong>der</strong> Schüler_innen gleich<br />
¬ die ‹schwierigen emen› setzten eine Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung<br />
mit ‹schwierigen eorien› voraus, wofür Ausbildungszeit<br />
eingesetzt würde, welche den Schüler_innen bzw. Studierenden<br />
für das Erlernen von Grundlagen d<strong>an</strong>n fehle<br />
Ohne diese Einwände o<strong>der</strong> Bedenken in den Wind schlagen zu<br />
wollen, möchte ich im folgenden Text Lehrpersonen und Lehramtsstudierende<br />
dazu ermutigen, sich eingehen<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> eigenen<br />
Verunsicherung ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>zusetzen, welche <strong>der</strong> geäusserten<br />
Skepsis gegenüber ‹schwierigen emen› im Unterricht<br />
o zugrunde liegt.<br />
Überlegungen zum Workshop ‹Zweiflerei›3 –<br />
zur Dekonstruktion von Geschlecht<br />
Zum Einstieg in die Netzwerkver<strong>an</strong>staltung wurden verschiedene<br />
Werkstätten <strong>an</strong>geboten in denen für die <strong>Gen<strong>der</strong></strong> und Queer<br />
eories zentrale Begriffe wie Repräsentation, Performativität<br />
und Dekonstruktion4 eingeführt wurden. Lektüre- und Beobachtungsauräge<br />
dienten als Anregung, diese Begriffe in <strong>der</strong><br />
Gruppe vertie zu diskutieren und auszudifferenzieren.<br />
Eine dieser Werkstätten beschäigte sich mit dem ema<br />
<strong>der</strong> ‹Zweiflerei› im Sinne einer Dekonstruktion von Geschlecht.<br />
Dabei war <strong>der</strong> Titel Programm, d.h. es ging darum, sich in seinem<br />
Selbstverständnis verunsichern zu lassen:<br />
Anstatt nach ‹dem authentischen, wesenhaen Inhalt von<br />
Identität› zu suchen, wurde in <strong>der</strong> ‹Zweiflerei› ein diskursiver<br />
Zug<strong>an</strong>g zu Identität diskutiert, <strong>der</strong> diese als ‹eine Konstruktion,<br />
als einen Prozess, <strong>der</strong> niemals abgeschlossen ist, <strong>der</strong> immer ‹gewonnen›<br />
und ‹verloren› werden k<strong>an</strong>n›, auffasst. Identität wurde<br />
dabei nicht mehr als essentialistisches Konzept verst<strong>an</strong>den, ‹das<br />
auf einen stabilen, unverän<strong>der</strong>lichen Kern rekurriert, […] son<strong>der</strong>n<br />
[als] ein strategisches, das Identität als Position auffasst.› 5<br />
Dass diese Verunsicherung im wahrsten Sinne eine Zumutung<br />
war, zeigte sich <strong>an</strong> den stark polarisierten und polarisierenden<br />
Diskussionen: Während die einen Studierenden <strong>der</strong> ‹Zweiflerei›<br />
etwas Lustvolles und Spielerisches abzugewinnen vermochten,<br />
wehrten sich <strong>an</strong><strong>der</strong>e vehement gegen die Befragung<br />
o<strong>der</strong> gar Destabilisierung des von ihnen – als natürlich und<br />
selbstverständlich bezeichneten – heteronormativen Verständnisses<br />
von Geschlecht. Dabei wurden zur geschlechtlichen<br />
Selbstvergewisserung ausnahmslos biologistische und naturalisierende<br />
Argumente vorgebracht: Die Kategorien männlich und<br />
weiblich wurden über ihr evolutionstheoretisches ‹Gewachsensein›<br />
legitimiert. Erstaunlich schien mir dabei, dass die Studierenden<br />
sich <strong>der</strong> Konstruktion von Modellen und Diskursen in<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en Bereichen durchaus bewusst waren und diese reflektierten.<br />
Sobald es um das geschlechtliche Selbstverständnis<br />
ging, schien jedoch ausgeblendet zu werden, dass auch Evolutionstheorien<br />
letztlich ‹gemacht› sind und folglich nicht ausserhalbvonHerrschasverhältnissen<br />
entstehen – ebenso wenig wie<br />
die daraus resultierende Vorstellung einer ‹stabilen Identität›.6<br />
In ihrem Buch ‹Cultural Studies. Eine Einführung› begründen<br />
Lutter/Reisenleiter die Kritik <strong>an</strong> Evolutionstheorien und sogen<strong>an</strong>nten<br />
belegbaren eorien und Weltmodellen, <strong>der</strong>en Konstruktionscharakter<br />
entn<strong>an</strong>nt wird, indem Begriffe wie natür-