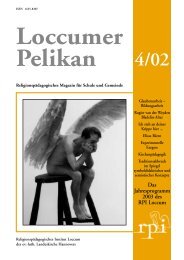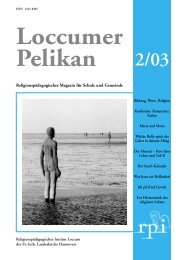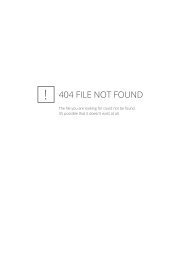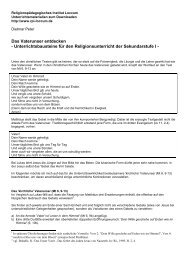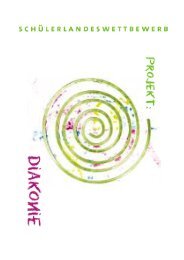'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
praktisches<br />
Religion in der Werbung<br />
Augenfällig wird die Verbindung von Religion und Werbung<br />
... vor allem dann, wenn die Werbung selbst explizit<br />
religiöse Stoffe aufgreift. Warum sie das tut, darüber<br />
gibt es unterschiedliche Meinungen. Jürgen Habermas<br />
hat schon Anfang der 70er Jahre vermutet, dass traditionalistische<br />
Weltbilder insbesondere im Rahmen der<br />
Legitimations- und Motivationskrise des Spätkapitalismus<br />
eine Rolle spielen. Im Rahmen dieser Krisenprozesse<br />
nutzt die Industrie sozusagen die Reste der legitimatorischen<br />
Kraft vergangener und vergehender Weltbilder<br />
für die eigenen Zwecke aus, freilich „verbraucht“<br />
sie sie dabei auch: sie frisst sie auf. Unbestreitbar ist,<br />
dass im Rahmen der Werbung nahezu grenzenlos auf<br />
kulturelle Traditionsbestände zurückgegriffen wird, dass<br />
Werbung „der größte Plünderer der gesamten Welt- und<br />
Kunstgeschichte ist“. Was das aber für Folgen hat,<br />
darüber kann und muss gestritten werden. Zum einen<br />
ist darauf hinzuweisen, dass derartige Plünderungen<br />
in der Geschichte der Menschheit immer schon eine<br />
ambivalente Wirkung hatten: Sie zerstörten und bewahrten<br />
in einem. Während sie einerseits das Material seinem<br />
genuinen Kontext entrissen, bewahrten sie es<br />
zugleich auf. Jedes Museum war bis ins 20. Jahrhundert<br />
das Ergebnis derartiger Plünderungsakte, die die<br />
ursprüngliche Kultur zerstörten, um sie allgemein zugänglich<br />
zu machen. Man könnte ähnliches auch für<br />
das Problemfeld „Religion und Werbung“ behaupten,<br />
dass nämlich Überlieferungen, die die religiösen Institutionen<br />
nicht mehr an sich zu binden vermochten, frei<br />
floatierend wurden und daher von der Werbung aufgegriffen<br />
und so zugleich im öffentlichen Bewusstsein gehalten<br />
werden. Zudem ist auch zu bedenken, dass man<br />
nicht einerseits stolz darauf sein kann, dass etwa Luthers<br />
Sprachkraft die deutsche Sprachkultur geprägt<br />
hat oder dass über nahezu tausend Jahre das Christentum<br />
die Kultur fast exklusiv geprägt hat, und sich<br />
andererseits darüber wundern, dass derartige Prägungen<br />
ihre Spuren auch in der Werbung hinterlassen. Verwunderlich<br />
wäre da doch schon eher, wenn die Werbung<br />
nicht auf religiöse Ausdrucksformen zurückgreifen<br />
würde. Religiöse Ausdrucksformen in Sprache und<br />
Bild, das zumindest kann gesagt werden, sind deshalb<br />
auch bevorzugte Materialien der Werbung, weil sie in<br />
unserer Gesellschaft immer noch einen so extrem<br />
hohen Bekanntheitsgrad haben. Und gerade aus diesem<br />
Grunde ist es auch interessant zu untersuchen,<br />
M 6<br />
welche Stoffe in der Werbung Verwendung finden. (...)<br />
Es gibt eine Art bedingten Reflex, mit dem Theologen<br />
kritisch auf Werbung reagieren, so <strong>als</strong> ob sie Exklusivvertreter<br />
für bestimmte Sprach-, Bild- und Gedankenformen<br />
wären. Stellvertretend für viele andere greife<br />
ich die kritische Auseinandersetzung mit Werbung<br />
heraus, die die Theologen Sven Howoldt und Wilhelm<br />
Schwendemann unter der Überschrift „Werbung – Religion<br />
– Ethik“ vorgelegt haben (in: medien praktisch 4/<br />
97, 51-55). Im schon fast klassisch gewordenen Alt-<br />
68er-Jargon wird nicht nur jede Bezugnahme auf Religion<br />
in der Werbung verurteilt, sondern die gesamte<br />
Werbung <strong>als</strong> Lüge denunziert: „Werbung eröffnet einen<br />
Horizont, der die materiale Dimension des Produkts<br />
transzendiert. Diese Transzendenz ist aber keine<br />
echte, sondern nur Blendwerk, denn sie dient der<br />
Überhöhung des vermeintlichen Gebrauchswertes. Um<br />
diesen Gebrauchswert herum wird ein Lifestyle mit einem<br />
entsprechenden Symbolinventar inszeniert. Die<br />
Symbole werden dabei hemmungslos instrumentalisiert,<br />
gleichen sich dem Warencharakter an und werden<br />
selbst zur Ware. Damit Ambiente, Produkt, Lifestyle<br />
stimmig aufeinander bezogen bleiben, muss Werbung<br />
zum Ereignis mutieren und inszeniert werden ...<br />
Diese Art Kommunikation wirkt wie ein Vampir, alles<br />
wird aufgesogen und für eigene Interessen dienstbar<br />
gemacht. Das kulturelle Erbe einer Gesellschaft wird<br />
aufgegriffen und jeweils neu arrangiert. Dabei werden<br />
die kulturellen Traditionen Europas und Amerikas für<br />
die Beeinflussung der Käuferschichten ausgebeutet.“<br />
Nach Meinung von Howoldt und Schwendemann sind<br />
die Folgelasten erschreckend: „Mit religiös besetzten<br />
Symbolen und Bildern, die oft nicht mehr vollständig<br />
verstanden werden, wird gespielt. Neue Identifikationsmuster<br />
werden munter montiert, so dass eine Patchwork-Identität<br />
entsteht, die ständig neu ist und keine<br />
Vergangenheit mehr kennt.“<br />
Die Patchwork-Identität, die die Gegenwart auszeichnet,<br />
ist demnach nicht ein Produkt komplexer gesellschaftlicher<br />
Prozesse, sondern das Ergebnis einer verwerflichen<br />
Handlungsweise der Werbewirtschaft, welche<br />
hehre kulturelle Werte für den schnöden Mammon<br />
missbraucht. Das dürfte der Werbeindustrie nun mehr<br />
Macht zusprechen, <strong>als</strong> dieser zukommt.<br />
(Andreas Mertin)<br />
Quelle: Andreas Mertin: Samson interpretiert Genesis 1. Die Kultur der Religion in der Werbung, in: Thomas Klie (Hg.): Spiegelflächen. Phänomenologie –<br />
Religionspädagogik – Werbung, Münster/Hamburg/London 1999, S. 125-159 (137f.;144f.)<br />
1. Was würde Andreas Mertin zur Verwendung des Stephanus-Motivs in der Bierwerbung sagen? Tauscht euch<br />
in einer Dreier- bis Fünfergruppe zu dieser Frage aus und überlegt euch, ob ihr selbst Mertins Meinung teilt.<br />
2. Was würden Sven Howoldt und Wilhelm Schwendemann, die im Text von Mertin zitiert werden, zur Verwendung<br />
des Stephanus-Motivs in der Bierwerbung sagen? Tauscht euch in einer Dreier- bis Fünfergruppe zu<br />
dieser Frage aus und überlegt euch, ob ihr selbst diese Meinung teilt.<br />
Loccumer Pelikan 4/03 183