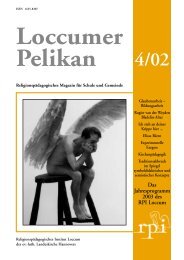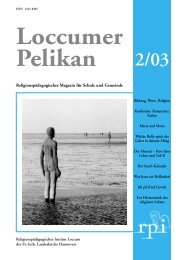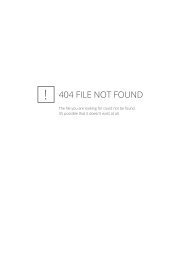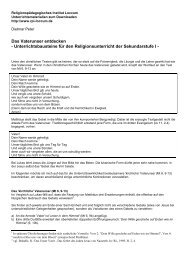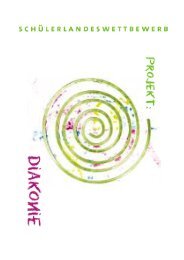'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
grundsätzlich<br />
Auch auf den ersten Blick zunächst einmal „rein kognitive“<br />
Unterrichtsformen unterliegen den Bedingungen szenischer<br />
Darstellung. So kann bspw. kein Text rezipiert werden, der nicht<br />
zuvor gelesen wurde. Dieser Satz ist lerntheoretisch trivial, inszenatorisch<br />
aber von großer Bedeutung. Denn der Lesevorgang,<br />
die schulische Lernform schlechthin, erweist sich bei<br />
genauem Hinsehen <strong>als</strong> ein zutiefst leiblicher und räumlicher<br />
Vollzug: Die Augen folgen einer perlenschnurähnlich aufgereihten<br />
Wortreihe, eine Blickbewegung, die zu einer bestimmten<br />
Haltung des Kopfes bzw. des Oberkörpers nötigt. Fortlaufend<br />
erzeugt die Lektüre innere Bilder – <strong>als</strong>o zwei- oder dreidimensionale<br />
Raum-Vorstellungen, ohne die kaum ein Wort<br />
mit Bedeutung belehnt werden kann.<br />
Wie <strong>als</strong>o lassen wir lesen? Auf einem eilig kopierten „Zettel“,<br />
wie Arbeitsblätter oftm<strong>als</strong> benannt werden, zeigt sich ein Bibel-Text<br />
anders <strong>als</strong> in der (mehr oder weniger mühsam) aufzuschlagenden<br />
Schulbibel oder in Gestalt etwa eines Textbausteins,<br />
der sich neben vielen anderen nichtbiblischen Inhalts<br />
auf der Doppelseite eines Religionsbuches wieder findet.<br />
Schon die bloße Präsentationsform beinhaltet eine Vorentscheidung<br />
über die veranschlagten Lehr-Ziele und Lern-Chancen.<br />
Function follows form. Formen aber sind methodisch<br />
durchaus variabel. Unterrichtende können ja schließlich festlegen,<br />
in welcher Weise die gewünschte Textfunktion zum<br />
Ausdruck gebracht werden soll: <strong>als</strong> gehörte, d. h. erzählte oder<br />
vorgelesene oder gar gemeinsam gesungene Bibelverse; <strong>als</strong><br />
Stillarbeit oder <strong>als</strong> für alle vernehmliches Vorlesen; oder gar<br />
<strong>als</strong> szenisch dargestellte oder einfach nur gemalte bzw. kalligraphierte<br />
Bibelworte. Methoden variieren immer auch Inhaltserwartungen.<br />
2. Der theologische Ort: Zwischen protestantischem<br />
Wortverständnis und ästhetischer Erfahrung besteht<br />
ein enges Wechselverhältnis. Die systematischtheologische<br />
Rede vom Wort-Ereignis hat auch eine<br />
religionspädagogische Außenseite.<br />
Es war Luthers feste Überzeugung, dass das Bibelwort solange<br />
nicht Evangelium ist, bis es verlautet, gehört und <strong>als</strong> solches<br />
realisiert wird. Die leib-räumliche Gestalt ist konstitutiv<br />
für das Wortgeschehen. Das macht die Hermeneutik des sola<br />
scriptura abbildbar auf die der ästhetischen Wirkung.<br />
Das verbum externum, das äußerliche Wort, ist für Luther das<br />
sinnliche Zeichen göttlicher Selbstmitteilung. In ihm nimmt<br />
der redende Gott für den hörenden Menschen verheißungsvoll<br />
Gestalt an. Der Zuspruch der Gnade ergeht in Form der Darstellung.<br />
Vor und außerhalb dieses Inszenierungsrahmens, <strong>als</strong>o<br />
unabhängig von der Mündlichkeit des Gotteswortes, kann der<br />
Adressat nicht wirklich erreicht werden. Das Lesen vermag<br />
eben nicht soviel wie das Hören – lectio non proficit tantum,<br />
quantum auditio.“ 10 Die Kirche ist darum auch eher „Mundhaus“<br />
denn „Federhaus“. 11<br />
Evangelischerseits ist die Heilige Schrift wesentlich Anrede,<br />
nicht aber Anschreiben: „natura verbi est audiri“. Es gehört<br />
zur Natur des Wortes, gehört zu werden. 12 Das Wort wirkt,<br />
indem es zur Sprache kommt. Es setzt, was es sagt, indem es<br />
verlautet und von einem angesprochenen Subjekt <strong>als</strong> angehende<br />
Botschaft geglaubt wird.<br />
Erst das präsentierte, <strong>als</strong>o das öffentlich aus- und aufgeführte<br />
Wort setzt diejenige Referenz in Kraft, von der es handelt und<br />
die es letztlich bezeugt. Promissio und fides, Verheißung und<br />
Glaube, korrelieren im Modus der Präsentation. Das Evangelium<br />
muss eben auch und gerade äußerlich ankommen, damit es<br />
nicht in schwärmerischer Attitüde unmittelbar und unbefragbar<br />
in der Subjektivität seiner Hörer aufgeht.<br />
Wendet man nun diese schrift-theologische Einsicht ins Pädagogische,<br />
dann besteht der angemessene Umgang mit der Bibel<br />
darin, dieser Eigenbewegung des Wortes Zeit, Raum und Ausdruck<br />
zu geben. Wortlaute der Heiligen Schrift sind dann so in<br />
Szene zu setzen, dass sie im freien Zugriff <strong>als</strong> Orientierungsgewinne<br />
– <strong>als</strong>o bildend – zu Buche schlagen. Es ist somit auch –<br />
streng lutherisch genommen – ein folgenreiches Fehlurteil, unsere<br />
evangelische Religion einfach fraglos einzureihen in die<br />
sog. „Buch- oder gar Schriftreligionen“. Protestanten haben keine<br />
Religion des Buches, sondern eine Religion der Aufführung. Ich<br />
spitze zu: Evangelische Religion ist allem Anschein zum Trotz<br />
eine Inszenierungsreligion.<br />
3. Der raumtheoretische Ort: Kein Unterrichtsgegenstand<br />
ist einfach abstrakt gegeben. Vielmehr teilt er<br />
sich mit, indem man mit ihm umgeht, sich in ihn hinein<br />
begibt, sich in ihm bewegt, sich in ihm und zu<br />
ihm verortet.<br />
Diese in der These angedeuteten Umgangsformen beanspruchen<br />
einen bestimmten Raum. Um begangen und bewohnt zu werden,<br />
muss ein angemessener Raum erst einmal pädagogisch eingeräumt<br />
werden. Wie das Lesen einen Raum der Stille braucht,<br />
so braucht die Gruppenarbeit einen Kommunikationsraum geschäftigen<br />
Miteinanders. Räume, Schulräume, ja ganze Schulen<br />
erzeugen eine je eigene Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung<br />
teilt sich einem ganz spontan mit: Man fühlt sich wohl oder unwohl,<br />
man ist abgelenkt oder angetan, ist konzentriert oder zerstreut.<br />
In der Schule werden Räume zu Wahrnehmungs- und Handlungsräumen,<br />
zu Räumen <strong>als</strong>o, in denen Lernende miteinander ihre<br />
Lernanlässe leiblich aushandeln. Jeder Raum kann durch seine<br />
Gestalt und seine Ausstattung bestimmte Handlungen nahe legen<br />
(manchmal auch verhindern). Räume können sich aber auch<br />
durch die in ihnen stattfindenden Tätigkeiten verändern: eine<br />
Kirche, in der ein Gospelchor auftritt, wird zur Konzerthalle, eine<br />
Schule, in der eine Ausstellung aushängt, zur Galerie und eine<br />
Sporthalle, die einen Flohmarkt beherbergt, zum Kaufhaus.<br />
Jede Verrichtung stimmt den Raum in besonderer Weise – sie<br />
macht ihn sich zum Umraum. Und zugleich legt die Verrichtung<br />
auch die Zeit fest, in der er <strong>als</strong> Umraum fungiert. Umräume sind<br />
wesenhaft Zeit-Räume, zeitweilige Räume.<br />
4. Der rollentheoretische Ort: In einem performativen<br />
Religionsunterricht nehmen die SchülerInnen eine<br />
höchst aktive Rolle ein. Selbsttätig wird Religion in<br />
ihren Formen und Figuren ertastet, erspielt, gesehen,<br />
gehört und bewegt.<br />
Im Unterricht wie im Theater übernehmen Menschen gewisse<br />
Rollen. Sie verkörpern für sich und andere eine bestimmte Fi-<br />
Loccumer Pelikan 4/03 175