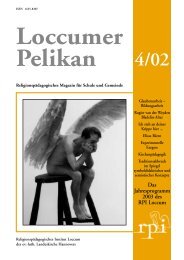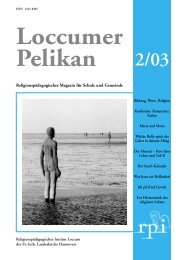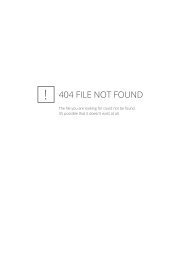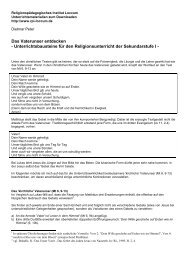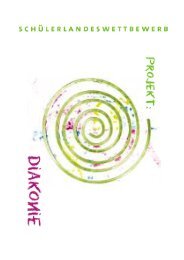'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
grundsätzlich<br />
2. Nichts Neues unter der Sonne: Traditionsstränge<br />
Der Akzent auf die leib-räumlichen Aspekte des Religionsunterrichts<br />
ist natürlich nicht neu. Bereits Hubertus Halbfas und<br />
Peter Biehl haben die Reichweite eines reinen Textunterrichts<br />
in ihren symboldidaktischen<br />
Entwürfen<br />
stark in Frage<br />
gestellt. Durch die<br />
unterrichtliche Arbeit<br />
mit „Symbolen“ wurden<br />
die traditionellen<br />
texthermeneutischen<br />
Methoden um andere,<br />
zumeist ästhetisch<br />
ausgelegte Lernwege<br />
erweitert. Im Ganzheitlichkeitsgestus<br />
der 80er Jahre setzte<br />
man auf Expressivität<br />
und Wirkung. Im Vordergrund<br />
stand der<br />
Transzendenzbezug<br />
bzw. dessen vielfältige<br />
Gestaltungsmöglichkeiten.<br />
Und so hielten vor etwa 20 Jahren Meditationen und<br />
Bildbearbeitungen auf breiter Front Einzug in den Religionsunterricht.<br />
Bald schon kamen auch Begehungen und Ausdrucksübungen,<br />
Rituale und Bibliodramen dazu. An der<br />
Grundschule hatte man mit einem solchen Methodenzuschnitt<br />
natürlich schon lange vorher gute Erfahrungen gemacht, aber<br />
mit dem Etikett „Symboldidaktik“ bekamen diese Lehrformen<br />
eine letztlich auch gymnasial akzeptable Theoriegestalt.<br />
Die „kreativen“ Methoden, an denen man zunächst einmal<br />
das Neue dieser Neuerung nach außen hin ablesen konnte,<br />
wurden notwendig, weil mit dem „Symbol“ eine Vermittlungsinstanz<br />
in den Mittelpunkt rückte, deren Bedeutung unmittelbar<br />
in der ihr zugeschriebenen Repräsentationsfunktion gesehen<br />
wurde. „Symbole geben zu lernen“ 5 – so formulierte<br />
es Peter Biehl 1989 programmatisch. Er verband mit dieser<br />
Formulierung die Vorstellung, dass Sinnbilder grundsätzlich<br />
Anteil geben an dem, was sie zeigen und wodurch sie dieses<br />
Was zeigen. Indem man sie unterrichtlich in Gebrauch nimmt,<br />
setzen „Symbole“ frei, was sie in sich gleichsam an religiöser<br />
Energie gespeichert haben.<br />
Ob und wie sie dies bewirken, ist zwar nach wie vor theoretisch<br />
strittig, ganz und gar unstrittig ist jedoch die Einsicht in<br />
die Gestaltungsnotwendigkeit religiöser Lerngegenstände. Wie<br />
Religion „funktioniert“ – so die unhintergehbare Einsicht der<br />
Symboldidaktiken – vermittelt sich unterrichtlich nur über ihre<br />
Gebrauchszusammenhänge. Religion gibt nur dann zu lernen,<br />
wenn ihre Formen ernst genommen und entsprechend wahrgenommen<br />
werden. Und dies geschieht immer dann, wenn sie<br />
angemessen „in Form“ kommt, d.h. wenn man diesen didaktischen<br />
Gestaltungsimperativ anmisst an den vorfindlichen Alltagsgestalten<br />
des Religiösen.<br />
Das war dam<strong>als</strong> für religionspädagogisch engagierte Protestanten<br />
eine durchaus neue Sicht, denn das gemeinsame<br />
preußisch-pietistisches Erbe suggeriert – im Grunde genommen<br />
bis heute –, dass Religion eine Herzenssache oder<br />
bestenfalls eine Einstellungssache sei. So oder so: Evangelisch<br />
ist man, wenn überhaupt, „innen drin“ und keinesfalls<br />
aber „nach außen<br />
hin“. Und wenn sich<br />
schon Evangelisches<br />
äußert, dann<br />
in moralischer Hinsicht,<br />
keines-wegs<br />
jedoch religiös.<br />
Evangelisch sein,<br />
heißt – zugespitzt<br />
formuliert – die<br />
Formlosigkeit zum<br />
religiösen Programm<br />
zu erheben.<br />
Die Symboldidaktiken<br />
machten nun auf<br />
ihre Weise darauf<br />
aufmerksam, dass<br />
Religion in erster Linie<br />
„Formsache“ ist,<br />
Religion <strong>als</strong>o allererst<br />
eine Praxis ist.<br />
Foto: Reinart Grütter<br />
Sie behaupteten Religion <strong>als</strong> einen Handlungsvollzug, <strong>als</strong> ein<br />
ästhetisch herausragendes Formenspiel mit durchaus erkennund<br />
gestaltbaren „Außenseiten“. Man wies darauf hin, dass<br />
Religion darum auch „schön“ sein könne (mitunter allerdings<br />
auch weniger schön) und dass Religiöses nicht nur dem reformatorischen<br />
Haupt-Organ, dem Ohr, sondern auch der Hand,<br />
dem Auge, mitunter sogar der Nase schmeicheln könne.<br />
Auf diesen Grundsatz berufen sich in je unterschiedlicher Weise<br />
auch all diejenigen Didaktik-Konzepte, die in symboldidaktischer<br />
Tradition den Prozesscharakter religiösen Lernens<br />
und Lehrens stark machen. Was sich derzeit <strong>als</strong> Performative<br />
Religionspädagogik formiert, lässt sich nicht nur <strong>als</strong> eine Fortschreibung<br />
der herkömmlichen Symbolkunde mit anderen Mitteln<br />
verstehen. Der Inszenierungsgedanke speist sich auch noch<br />
aus anderen Quellen: 6<br />
Da ist in diesem Zusammenhang zunächst einmal die sog.<br />
Zeichendidaktik 7 zu nennen. Sie nahm Mitte der 90er Jahre<br />
ihren Anfang in der semiotischen Kritik an dem in den Symboldidaktiken<br />
vorausgesetzten Symbol-Begriff. Der Zeichendidaktik<br />
geht es darum, Religion <strong>als</strong> ein Ensemble grundsätzlich<br />
deutungsoffener Zeichen zu verstehen. Religion kommt<br />
hier <strong>als</strong> eine in Kultur eingelagerte Praxis in den Blick, die je<br />
nach Vorwissen und Vorerfahrung unterschiedliche Lesarten<br />
hervorbringen kann. Wie bei allen ästhetischen Zeichensystemen<br />
(z.B. bei Kunstbildern, Musik- oder Theaterstücken<br />
etc.), so ist auch die Deutung religiöser Zeichen (bspw. Gleichnisse,<br />
Gebete, Kirchenräume etc.) tendenziell unabschließbar.<br />
Deutung gibt es nur im Plural individueller Erfahrungen mit<br />
den entsprechenden Zeichen. Die je individuelle Zeichenlektüre<br />
wird dabei stimuliert und begrenzt durch die mit den Zeichen<br />
mitgesetzten Deutungsüblichkeiten. Im Gegensatz zum<br />
Loccumer Pelikan 4/03 173