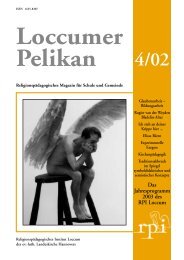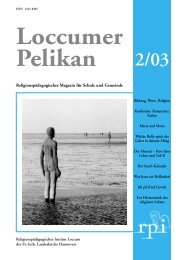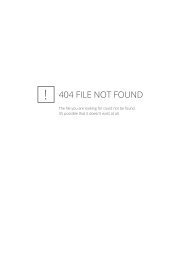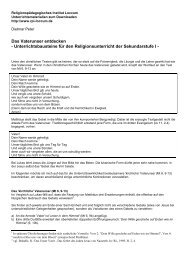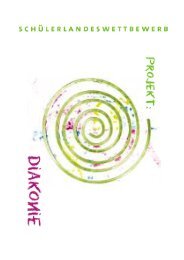'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
'Loccumer Pelikan' 04/2003 als pdf-Datei - Religionspädagogisches ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schule und gemeinde<br />
Elisabeth Schwarz<br />
Die Entwicklung des kindlichen<br />
Sterblichkeitswissens *<br />
Um die Entwicklung der kindlichen Todesvorstellungen<br />
zu erklären, wurde<br />
lange Zeit von einer Korrelation zwischen<br />
Stadien der Begriffsbildung und<br />
kognitiven Reifungsprozessen ausgegangen.<br />
So wie der Erwerb von körperlichen<br />
Fähigkeiten oder der Erwerb der<br />
Sprache sollten sich auch die Vorstellungen<br />
über den Tod nach naturgegebenen<br />
und in altersabhängigen Stadien<br />
entwickeln. Demnach wären bei verschiedenen<br />
Kindern eines Alters in etwa<br />
die gleichen Konzepte über Tod und<br />
Sterben zu erwarten.<br />
Verschiedene empirische Untersuchungen<br />
haben diese Erwartung jedoch relativiert.<br />
Sie haben gezeigt, dass sich gerade<br />
die Todesvorstellungen von Kindern<br />
gleichen Alters abhängig von ihrer<br />
Sozialisation im Hinblick auf ihren<br />
Realitätsgehalt teilweise sehr stark von<br />
einander unterscheiden. 1<br />
●<br />
Drei Einflussfaktoren möchte ich<br />
nennen:<br />
● Der distanziert vermittelte Tod im<br />
Fernsehen führt zu einer Abstraktion<br />
des Todesproblems, die eine wirkliche,<br />
existentielle Auseinandersetzung<br />
mit dem Tod eher behindert <strong>als</strong><br />
fördert. Der Tod verliert seine Hintergründigkeit<br />
und Ernsthaftigkeit.<br />
Er wirkt reparabel, nicht endgültig.<br />
Hinterher leben alle Helden wieder!<br />
● Familienmitglieder kommunizieren<br />
oft unbedacht vor den Kindern über<br />
Tod. Diese hören nebenbei zu, fassen<br />
vieles wortwörtlich auf und konstruieren<br />
dann „Schreckensbilder“<br />
oder f<strong>als</strong>che „Harmoniebilder“. Beispielhaft<br />
seien folgende Aussagen<br />
genannt:<br />
„Der Opa ist an Krebs gestorben.“<br />
Das Kind möchte nicht ins Meer<br />
gehen, denn dort gibt es viele Krebse,<br />
die offensichtlich den Tod bringen<br />
können.<br />
„Opa ist im Himmel.“ Die Enkelin<br />
entwickelt Schlafstörungen aus<br />
Angst, der Himmel könnte herunterbrechen.<br />
Schließlich ist er voller<br />
Leichen. Der dicke Opa ist ja auch<br />
noch dazugekommen.<br />
„Wir haben unsere liebe Tante Greta<br />
verloren!“ Das Kind sagt tröstend:<br />
„Mach dir nichts draus, wir werden<br />
sie schon wieder finden!“<br />
Wo Kinder durch traurige Umstände<br />
angeregt werden, über Tod nachzudenken,<br />
werden sie früher ausgefeilte<br />
oder zumindest andere Todeskonzepte<br />
entwickeln <strong>als</strong> Kinder ihres<br />
Alters. Direkte Todeserlebnisse<br />
lösen Empfindungen aus, die unter<br />
Umständen zu rascherer Weiterentwicklung<br />
des Todesverständnisses<br />
führen.<br />
* 1. Gastvorlesung im Rahmen des Erasmus-DozentInnenaustausches an der Päd. Hochschule Nagykörös/Ungarn (5.3.2002)<br />
Loccumer Pelikan 4/03 197