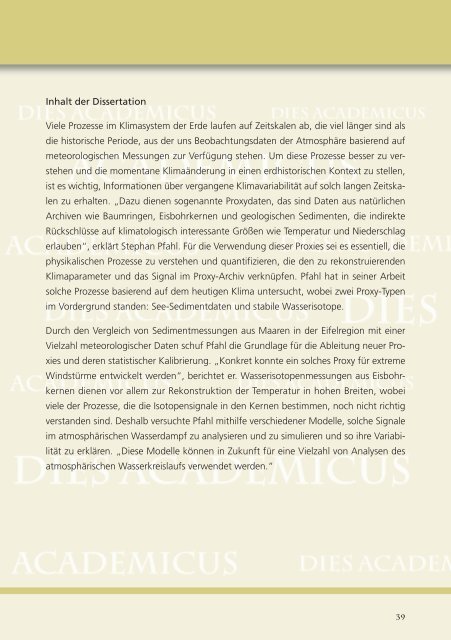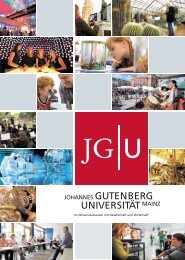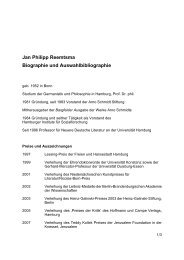Ausgezeichnete Abschlussarbeiten 2009/2010 - Johannes ...
Ausgezeichnete Abschlussarbeiten 2009/2010 - Johannes ...
Ausgezeichnete Abschlussarbeiten 2009/2010 - Johannes ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Inhalt der Dissertation<br />
Viele Prozesse im Klimasystem der Erde laufen auf Zeitskalen ab, die viel länger sind als<br />
die historische Periode, aus der uns Beobachtungsdaten der Atmosphäre basierend auf<br />
meteorologischen Messungen zur Verfügung stehen. Um diese Prozesse besser zu verstehen<br />
und die momentane Klimaänderung in einen erdhistorischen Kontext zu stellen,<br />
ist es wichtig, Informationen über vergangene Klimavariabilität auf solch langen Zeitskalen<br />
zu erhalten. „Dazu dienen sogenannte Proxydaten, das sind Daten aus natürlichen<br />
Archiven wie Baumringen, Eisbohrkernen und geologischen Sedimenten, die indirekte<br />
Rückschlüsse auf klimatologisch interessante Größen wie Temperatur und Niederschlag<br />
erlauben“, erklärt Stephan Pfahl. Für die Verwendung dieser Proxies sei es essentiell, die<br />
physikalischen Prozesse zu verstehen und quantifizieren, die den zu rekonstruierenden<br />
Klimaparameter und das Signal im Proxy-Archiv verknüpfen. Pfahl hat in seiner Arbeit<br />
solche Prozesse basierend auf dem heutigen Klima untersucht, wobei zwei Proxy-Typen<br />
im Vordergrund standen: See-Sedimentdaten und stabile Wasserisotope.<br />
Durch den Vergleich von Sedimentmessungen aus Maaren in der Eifelregion mit einer<br />
Vielzahl meteorologischer Daten schuf Pfahl die Grundlage für die Ableitung neuer Proxies<br />
und deren statistischer Kalibrierung. „Konkret konnte ein solches Proxy für extreme<br />
Windstürme entwickelt werden“, berichtet er. Wasserisotopenmessungen aus Eisbohrkernen<br />
dienen vor allem zur Rekonstruktion der Temperatur in hohen Breiten, wobei<br />
viele der Prozesse, die die Isotopensignale in den Kernen bestimmen, noch nicht richtig<br />
verstanden sind. Deshalb versuchte Pfahl mithilfe verschiedener Modelle, solche Signale<br />
im atmosphärischen Wasserdampf zu analysieren und zu simulieren und so ihre Variabilität<br />
zu erklären. „Diese Modelle können in Zukunft für eine Vielzahl von Analysen des<br />
atmosphärischen Wasserkreislaufs verwendet werden.“<br />
39