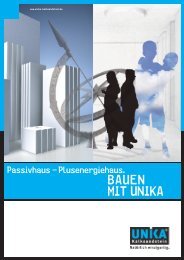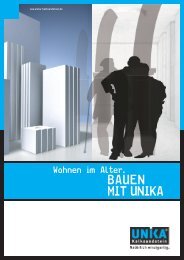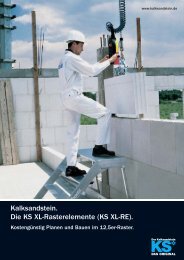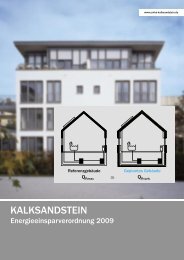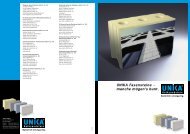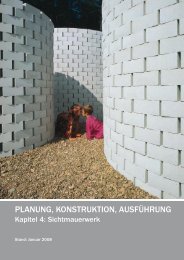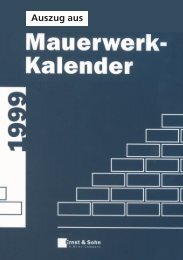PDF Download - Kalksandstein
PDF Download - Kalksandstein
PDF Download - Kalksandstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KALKSANDSTEIN – Wärmeschutz V 01/2009<br />
3.7 Wärmeübergangswiderstände<br />
Für die Wärmeübergangswiderstände an<br />
der inneren (R si ) und äußeren (R se ) Bauteiloberfläche<br />
bei der U-Wert-Berechnung<br />
werden die tabellierten Bemessungswerte<br />
aus DIN EN ISO 6946 verwendet. Dabei<br />
wird nach der Richtung des Wärmestroms<br />
unterschieden. Geneigte Bauteile und<br />
Dächer mit einer Neigung kleiner als 60°<br />
gegenüber der Waagerechten werden wie<br />
waagerechte Bauteile behandelt, bei Neigungen<br />
von 60° oder mehr wie senkrechte<br />
Bauteile. Tafel 6 sowie Bild 6 zeigen die Zuordnung<br />
der jeweils zu verwendenden Werte<br />
für einzelne Bauteile abhängig von der baulichen<br />
Situation für den Winterfall (Wärmestromrichtung<br />
von innen nach außen).<br />
Für Bauteile im Inneren des Gebäudes,<br />
die Teil der thermischen Gebäudehülle<br />
sind, wird auf beiden Seiten der gleiche<br />
Wärmeübergangswiderstand R si angesetzt.<br />
Für Flächen gegen Erdreich und andere Flächen<br />
mit direktem Kontakt zu Feststoffen<br />
beträgt der Wärmeübergangswiderstand<br />
0 (Null). Für wechselnde Wärmestromrichtungen<br />
(z.B. bei einer dynamischen<br />
Gebäudesimulation für den Sommerfall)<br />
oder für den U-Wert von Bauteilen, deren<br />
Einbaulage nicht vorab bekannt ist, wird<br />
empfohlen, die Werte wie für senkrechte<br />
Wände zu verwenden. Für die Überprüfung<br />
eines Bauteils auf Kondensat- oder<br />
Tauwasserausfall nach DIN 4108-3 (klimabedingter<br />
Feuchteschutz) bzw. DIN 4108-2<br />
Abschnitt 6 (Wärmebrücken) gelten jeweils<br />
die dort angegebenen Wärmeübergangswiderstände.<br />
Zum direkten Vergleich der<br />
Dämmleistung von Bauteilen in verschiedenen<br />
Einbausituationen empfiehlt es<br />
sich, statt des U-Werts den Wärmedurchlasswiderstand<br />
der Bauteile zu verwenden,<br />
da er unabhängig von den je nach Einbausituation<br />
unterschiedlichen Wärmeübergangswiderständen<br />
ist.<br />
3.8 U-Wert von Bauteilen aus homogenen<br />
und inhomogenen Schichten<br />
Besteht das Bauteil aus homogenen und<br />
inhomogenen Schichten, bzw. hat es unterschiedliche<br />
nebeneinanderliegende<br />
Bereiche (z.B. Sparren und Gefach bei<br />
Holzdächern; Betonstütze in einer Mauerwerkswand),<br />
muss man zur Berechnung<br />
des U-Wertes ein anderes Verfahren anwenden,<br />
das so genannte „vereinfachte<br />
Verfahren“ nach DIN EN ISO 6946. Die<br />
früher übliche, flächenanteilige Mittelung<br />
„normal“ berechneter U-Werte nebeneinander<br />
liegender Bereiche ist nicht mehr<br />
zulässig und stellt einen Planungsfehler<br />
dar, weil diese Vorgehensweise zu niedrige<br />
und damit zu günstige U-Werte ergibt. Die<br />
Berechnung des U-Werts eines zusammengesetzten<br />
Bauteils bzw. eines Bauteils aus<br />
homogenen und inhomogenen Schichten<br />
erfolgt sinnvollerweise mit einem Berechnungsprogramm<br />
[5].<br />
Das Verfahren der DIN EN ISO 6946 ist<br />
vereinfacht im Vergleich zu genauen, zweioder<br />
dreidimensionalen numerischen Computerverfahren,<br />
die ansonsten zur Berechnung<br />
des U-Werts eines solchen Bauteils<br />
verwendet werden müssten. Nicht anwend-<br />
Tafel 6: Bemessungswerte der Wärmeübergangswiderstände für die Berechnung des U-Werts nach DIN EN ISO 6946 für verschiedene Bauteile, für den Winterfall<br />
(Wärmestromrichtung von innen nach außen)<br />
Zeile Bauteil Wärmeübergangswiderstand<br />
innen R si<br />
[m²·K/W]<br />
außen R se<br />
[m²·K/W]<br />
1 Außenwände (ausgenommen Außenwände aus Zeile 2); nicht hinterlüftete geneigte Dächer mit Neigung $ 60° 0,13 0,04<br />
2<br />
3<br />
Außenwände mit einer hinterlüfteten Bekleidung, Abseitenwände zum ungedämmten Dachraum; hinterlüftete<br />
geneigte Dächer mit Neigung $ 60°<br />
Wohnungstrennwände, Treppenhauswände, Wände zwischen unabhängigen Räumen, Trennwände zu dauernd<br />
unbeheizten Räumen, Abseitenwände zu gedämmten Dachräumen<br />
0,13 0,13<br />
0,13 0,13<br />
4 Außenwände, die an das Erdreich grenzen 0,13 0<br />
5<br />
Decken oder geneigte Dächer mit einer Neigung < 60°, die Aufenthaltsräume gegen Außenluft abgrenzen;<br />
unbelüftete Flachdächer<br />
0,10 0,04<br />
6 Decken unter Spitzböden und nicht ausgebauten Dachräumen; Decken unter belüfteten Räumen 0,10 0,10<br />
7<br />
Wohnungstrenndecken und Decken zwischen unabhängigen Räumen<br />
Wärmestromrichtung nach oben<br />
Wärmestromrichtung nach unten<br />
0,10<br />
0,17<br />
0,10<br />
0,17<br />
8 Kellerdecken 0,17 0,17<br />
9 Decken, die Räume nach unten gegen Außenluft abgrenzen 0,17 0,04<br />
10 An das Erdreich grenzender unterer Abschluss eines Aufenthaltsraums 0,17 0<br />
Für die Überprüfung eines Bauteils hinsichtlich Kondensat- oder Tauwasserausfall nach DIN 4108-3 (klimabedingter Feuchteschutz) bzw. DIN 4108-2 Abschnitt 6<br />
(Wärmebrücken) gelten jeweils die dort angegebenen Wärmeübergangswiderstände.<br />
Für Bauteile mit wechselnder Wärmestromrichtung (z.B. bei einer dynamischen Gebäudesimulation für den Sommerfall) oder für Bauteile, deren Einbaulage nicht<br />
vorab bekannt ist, wird empfohlen, die Wärmeübergangswiderstände wie für Wände zu verwenden.<br />
206