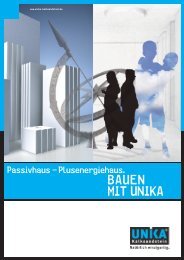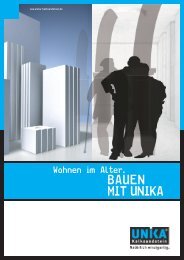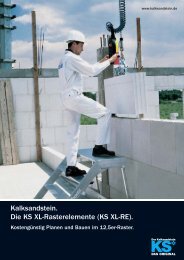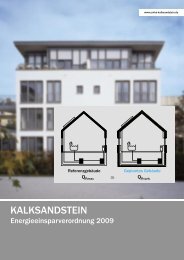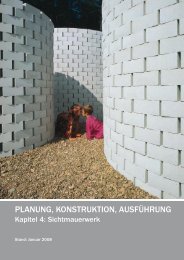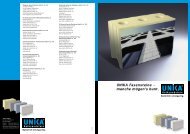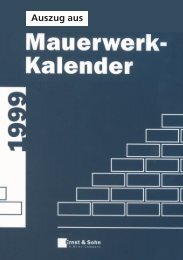PDF Download - Kalksandstein
PDF Download - Kalksandstein
PDF Download - Kalksandstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KALKSANDSTEIN – Wärmeschutz V 01/2009<br />
5. WÄRMESCHUTZ UND SCHIMMEL-<br />
VERMEIDUNG BEI WÄRMEBRÜCKEN<br />
Wärmebrücken sind Stellen in der Umhüllung<br />
eines Gebäudes, an denen es zu<br />
einem örtlich erhöhten Wärmedurchgang<br />
durch die Konstruktion kommt. Daraus<br />
resultieren örtliche Unterschiede in der<br />
Temperatur der Innen- und der Außenoberflächen<br />
der Konstruktion. Im Winter<br />
kommt es an Wärmebrücken zu einem<br />
erhöhten Wärmeverlust. Zusätzlich kann<br />
es zu deutlich verringerten Innenoberflächentemperaturen<br />
kommen, und in der<br />
Folge zu Kondensatanfall und Schimmelbildung.<br />
Deshalb sind Wärmebrücken aus<br />
energetischer Sicht, vor allem aber aus<br />
Bauqualitäts- und Hygienegesichtspunkten<br />
zu vermeiden oder möglichst in ihrem<br />
Einfluss zu begrenzen. Mit steigendem<br />
Dämmstandard kommt den Wärmebrücken<br />
im Planungsprozess und bei der Bewertung<br />
eines Gebäudes eine zunehmende Bedeutung<br />
zu. Die Hinweise zur Vermeidung von<br />
Schimmelpilzwachstum gelten in gleicher<br />
Weise für Wärmebrücken.<br />
Wärmebrücken können sehr unterschiedliche<br />
Ursachen haben, die auch in Kombination<br />
miteinander auftreten können:<br />
● Stoffbedingte Wärmebrücken ergeben<br />
sich aus einem Wechsel der Baustoffe<br />
nebeneinander liegender Bereiche,<br />
z.B. Betonpfeiler in einer Mauerwerkswand.<br />
● Geometriebedingte Wärmebrücken<br />
finden sich beispielsweise an jeder<br />
Gebäudekante und Fensterleibung.<br />
● Eine Wärmebrückenwirkung ist durch<br />
Einbauteile gegeben (Rollladenkästen,<br />
Fassadendübel).<br />
Oft findet sich auch eine Kombination<br />
mehrerer Ursachen (Traufanschluss,<br />
Deckeneinbindung). Üblich ist deswegen<br />
die Unterteilung entsprechend ihrer Geometrie<br />
in punkt-, linien- und flächenförmige<br />
Wärmebrücken.<br />
Zur Vermeidung von Wärmebrücken gilt<br />
generell die Empfehlung, die dämmende<br />
Schicht so vollständig und lückenlos wie<br />
möglich um das beheizte Gebäudevolumen<br />
zu legen. Die dämmenden Schichten<br />
benachbarter Bauteile sollten lückenlos<br />
und ohne Dickenverminderung ineinander<br />
übergehen. Das Konstruktionsprinzip<br />
der durchgehenden Dämmebene kann<br />
bei Neubauten und vorausschauender<br />
Planung gut eingehalten werden. Bei der<br />
Bestandssanierung ist dies häufig nur<br />
mit erhöhtem Aufwand oder mitunter gar<br />
nicht mehr nachträglich möglich. Hier<br />
sind entsprechend angepasste Lösungen<br />
erforderlich.<br />
5.1 Energetische Charakterisierung von<br />
Wärmebrücken<br />
In energetischer Hinsicht werden linienförmige<br />
Wärmebrücken durch den linearen<br />
Wärmedurchgangskoeffizienten<br />
( -Wert) charakterisiert (früher: Wärmebrückenverlustkoeffizient).<br />
Er gibt<br />
den Wärmedurchgang pro Meter Länge<br />
der Wärmebrücke und pro Kelvin Temperaturdifferenz<br />
an, der zusätzlich zum<br />
Wärmedurchgang durch die benachbarten<br />
flächigen Bauteile auftritt. Der<br />
-Wert ist das längenbezogene Pendant<br />
zum U-Wert für flächige Bauteile. Für punktförmige<br />
Wärmebrücken wird der -Wert<br />
verwendet.<br />
Mit zunehmender Wärmedämmung<br />
müssen auch die Bauteilanschlüsse<br />
wärmetechnisch verbessert werden.<br />
wird bestimmt, indem der gesamte stationäre<br />
Wärmedurchgang durch den Bereich<br />
der Wärmebrücke zweidimensional<br />
mit numerischen Methoden berechnet und<br />
durch die angesetzte Temperaturdifferenz<br />
geteilt wird. Vom Ergebnis zieht man den<br />
Wärmedurchgang ab, der sich aus Fläche<br />
(Außenmaß) mal U-Wert der beiden angrenzenden<br />
flächigen Bauteile pro Grad Temperaturunterschied<br />
ergibt (Bild 9).<br />
U 1<br />
U 1<br />
a i<br />
<br />
U 2<br />
<br />
U 2<br />
A 2<br />
a<br />
A 2<br />
L =<br />
Q<br />
a<br />
L =<br />
Q = L - U 1 · A 1 - U 2 · A 2<br />
<br />
A 1<br />
a<br />
A 1<br />
= L - U 1 · A 1 - U 2 · A 2<br />
L: Thermischer Leitwert<br />
U: U-Wert<br />
A: Fläche<br />
Q: Wärmestrom<br />
D = Dq: Lufttemperaturdifferenz zwischen<br />
außen und innen<br />
Bild 9: Skizze zur Berechnung des längenbezogenen<br />
Wärmedurchgangskoeffizienten <br />
i<br />
Längenbezogene Wärmebrücken treten an<br />
den Anschlussstellen zwischen benachbarten<br />
Bauteilen auf. Je nach Bauweise<br />
können sie sich deutlich bemerkbar machen,<br />
vor allem wenn auf die Vermeidung<br />
von Wärmebrücken nicht besonders geachtet<br />
wird. Die Bilder 10 und 11 vergleichen<br />
den Wärmedurchgang im Bereich<br />
einer einbindenden Decke zwischen der<br />
KS-Funktionswand mit Wärmedämmverbundsystem<br />
und einer monolithischen<br />
Bauweise. Deutlich erkennbar ist die Verringerung<br />
der Wärmebrückenwirkung bei<br />
der KS-Funktionswand.<br />
5.2 Verminderung des Wärmebrückenverlusts<br />
nach DIN 4108 Beiblatt 2<br />
Im Gegensatz zu flächigen Bauteilen werden<br />
an Wärmebrücken keine allgemeingültigen<br />
energetischen Mindestanforderungen<br />
gestellt. So gibt es auch keine<br />
verbindlichen Höchstgrenzen für -Werte.<br />
Dennoch ergeben sich in der Regel „freiwillige<br />
eingegangene Mindestanforderungen“<br />
daraus, dass im EnEV-Nachweis und/oder<br />
in der Baubeschreibung bestätigt wird, die<br />
relevanten Wärmebrücken würden dem<br />
„Wärmebrückenbeiblatt“ DIN 4108 Beiblatt<br />
2 entsprechen. Dieses nicht-normative<br />
Beiblatt gibt in Prinzipskizzen Planungsund<br />
Ausführungsempfehlungen, wie der<br />
Einfluss von Wärmebrücken energetisch<br />
und thermisch vermindert werden kann.<br />
Bezieht sich der Planer im EnEV-Nachweis<br />
oder in der Baubeschreibung darauf, wird<br />
das dort definierte Niveau der Wärmebrückenverminderung<br />
verbindlich. Hintergrund<br />
für das Erstellen des Beiblatts war, dass<br />
der Wärmeschutz in der Fläche ausreichend<br />
gut funktioniert, aber bei Wärmebrücken<br />
Wissens- oder Aufmerksamkeitslücken<br />
bestehen.<br />
Generell muss ein Planer gemäß EnEV<br />
den Einfluss konstruktiver Wärmebrücken<br />
auf den Jahres-Heizwärmebedarf nach<br />
den Regeln der Technik und den im jeweiligen<br />
Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren<br />
Maßnahmen so gering wie möglich halten.<br />
Den zusätzlichen Wärmedurchgang durch<br />
alle relevanten Wärmebrücken eines Gebäudes<br />
(∆U WB ) kann er im EnEV-Nachweis<br />
wahlweise detailliert oder pauschalisiert<br />
berücksichtigen:<br />
● Die - bzw. - Werte der linien- bzw.<br />
punktförmigen Wärmebrücken werden<br />
detailliert ermittelt und im Transmissionswärmedurchgang<br />
mittels -Wert<br />
mal abgemessener Länge der Wärmebrücken<br />
bzw. mittels -Wert mal Anzahl<br />
der punktförmigen Wärmebrücken berücksichtigt.<br />
Zahlenwerte für C können<br />
210