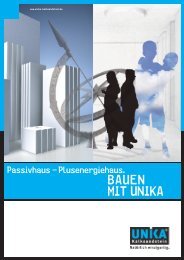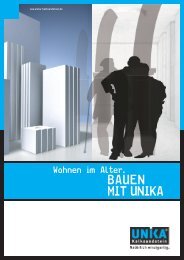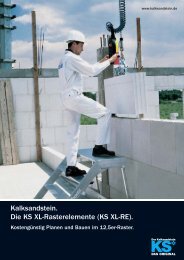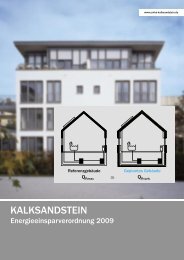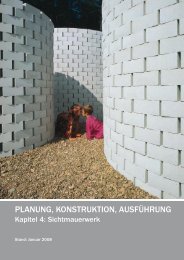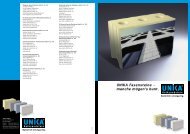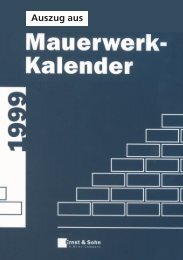PDF Download - Kalksandstein
PDF Download - Kalksandstein
PDF Download - Kalksandstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KALKSANDSTEIN – Wärmeschutz V 01/2009<br />
3. VON DER WÄRMELEITFÄHIGKEIT ZUM<br />
U-WERT<br />
Im Folgenden werden die relevanten Größen<br />
rund um die Wärmedämmung von Bauteilen<br />
beschrieben. Ein Beispiel erläutert<br />
die Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten<br />
(U-Wert), die international<br />
in ISO 6946 normiert ist. Die Energieeinsparverordnung<br />
nimmt die deutsche<br />
Ausgabe DIN EN ISO 6946 dieser Norm<br />
als Berechnungsvorschrift in Bezug. Somit<br />
sind U-Werte generell hiernach zu<br />
ermitteln, sofern nicht genauere Berechnungsverfahren,<br />
z.B. DIN EN ISO 10211 für<br />
2- und 3-dimensionale Wärmebrückenberechnungen,<br />
DIN EN ISO 10077-1 und -2<br />
für Fensterberechnungen, oder DIN EN ISO<br />
13974 für Vorhangfassaden verwendet<br />
werden. Abweichungen von den Rechenvorschriften<br />
der Norm stellen einen Planungsfehler<br />
dar.<br />
Betrachtet werden generell nur die Bauteile<br />
der thermischen Gebäudehülle. Zur<br />
thermischen Gebäudehülle gehören all<br />
jene Innen- und Außenbauteile, die das<br />
beheizte Gebäudevolumen gegen die<br />
Außenluft oder gegen unbeheizte Dachböden<br />
und Keller, Garagen, unbeheizte<br />
Anbauten etc. abgrenzen. Die thermische<br />
Gebäudehülle umgibt das beheizte Gebäudevolumen<br />
lückenlos (Ausnahme:<br />
Haustrennwände und -decken zwischen<br />
gleichartig beheizten Bereichen werden<br />
nicht berücksichtigt). Alle beheizbaren<br />
Räume, auch wenn sie nur gelegentlich<br />
beheizt werden, wie Gästezimmer, Hobbyraum<br />
etc., zählen zum beheizten Bereich.<br />
Indirekt über Raumverbund beheizte Räume<br />
wie z.B. der innen liegende Treppenabgang<br />
in den unbeheizten Keller zählen<br />
ebenfalls zum beheizten Bereich. Ein zum<br />
Wohnbereich abgeschlossenes Treppenhaus<br />
ohne Heizkörper kann wahlweise als<br />
indirekt beheizt (über die Wohnungstüren;<br />
innen Feststoff außen<br />
dann gehört es zum beheizten Bereich)<br />
oder als tatsächlich unbeheizt (dann liegt<br />
es außerhalb der thermischen Hülle) eingestuft<br />
werden. Die Überlegungen zur thermischen<br />
Gebäudehülle gelten in gleicher<br />
Weise für die Hüllfläche, die im Sommer<br />
einen gekühlten Bereich gegen Außenluft<br />
bzw. gegen angrenzende, nicht gekühlte<br />
Bereiche abgrenzt.<br />
3.1 Wärmestrom, Widerstand, U-Wert<br />
Der stationäre Wärmedurchgang (Transmission)<br />
durch ein einschichtiges Bauteil<br />
besteht aus drei Phasen:<br />
● Wärmeübergang von der Raumluft mittels<br />
Luftströmung (Konvektion) und<br />
Wärmeleitung von den Raumoberflächen<br />
mittels Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung)<br />
auf die raumseitige Wandoberfläche;<br />
● Wärmetransport durch die Baustoffschicht<br />
selbst (mittels Wärmeleitung),<br />
und<br />
● Wärmeübergang (Wärmeabgabe) von<br />
der Außenoberfläche an die Außenluft<br />
mittels Konvektion und Wärmeleitung<br />
und an jene Oberflächen, die die Außenseite<br />
der Wand „sieht“, mittels Wärmestrahlung.<br />
In allen Phasen wird der Wärme, also der<br />
Energie, ein gewisser Widerstand entgegengesetzt,<br />
den sie überwinden muss: den<br />
Wärmeübergangswiderstand auf der Innenseite<br />
(R si ), den Wärmedurchlasswiderstand<br />
der Baustoffschicht (R i ), den Wärmeübergangswiderstand<br />
auf der Außenseite (R se ).<br />
Es handelt sich um eine Reihenschaltung<br />
von Widerständen. Wie beim elektrischen<br />
Strom ist der Gesamtwiderstand die Summe<br />
der Einzelwiderstände (in der Wärmelehre<br />
bezeichnet als Wärmedurchgangswiderstand,<br />
mit dem Formelzeichen R T ).<br />
Wärme<br />
Bauteile bestehen häufig aus mehreren<br />
Schichten (i = 1, 2, 3… n), deren individuelle<br />
Wärmedurchlasswiderstände R i alle in<br />
Reihe geschaltet sind; ihre Summe nennt<br />
man den Wärmedurchlasswiderstand R<br />
des Bauteils (von Oberfläche zu Oberfläche).<br />
Sind die Schichten in sich jeweils<br />
homogen (d.h., innerhalb einer Schicht ändern<br />
sich die thermischen Eigenschaften<br />
nicht), dann errechnet sich der Wärmedurchlasswiderstand<br />
jeder Baustoffschicht<br />
als Quotient ihrer Schichtdicke (in Metern)<br />
und der Wärmeleitfähigkeit des Materials<br />
(in W/(m·K)), aus dem sie besteht:<br />
R i = d i<br />
l i<br />
R =<br />
i<br />
d i<br />
l i<br />
für die i-te Schicht und<br />
für die Summe aller<br />
Schichten von Oberfläche<br />
zu Oberfläche.<br />
R ist flächenspezifisch, mit der Einheit<br />
m²·K/W. Die Wärmeübergangswiderstände<br />
R si und R se sind in Normen tabelliert. Der<br />
gesamte Wärmedurchgangswiderstand R T<br />
eines Bauteils ergibt sich damit zu:<br />
R T = R si +<br />
i<br />
R i + R se = R si +<br />
i<br />
d i<br />
l i<br />
+ R se<br />
[m²·K/W]<br />
Je größer der Wärmedurchlasswiderstand<br />
bzw. der Wärmedurchgangswiderstand sind,<br />
desto größer ist die Dämmwirkung der Baustoffschicht<br />
bzw. des Bauteils. Die Vorgänge<br />
beim Wärmetransport lassen sich gut<br />
mit der Analogie zum elektrischen Strom<br />
verdeutlichen. Dabei entspricht der elektrische<br />
Strom dem Wärmestrom, der elektrische<br />
Widerstand dem Wärmedurchlasswiderstand<br />
einer einzelnen Baustoffschicht,<br />
oder dem Wärmedurchgangswiderstand<br />
des ganzen Bauteils als Reihenschaltung<br />
von Widerständen. Die elektrische Spannung<br />
entspricht der Temperaturdifferenz<br />
zwischen der warmen und der kalten Seite.<br />
Sie stellt das treibende Potenzial dar,<br />
aufgrund dessen es überhaupt zum Wärmetransport<br />
kommt: Herrscht auf beiden<br />
Seiten des Bauteils die gleiche Temperatur,<br />
findet kein Wärmetransport statt.<br />
Üblich ist im Bauwesen die Verwendung<br />
des Wärmedurchgangskoeffizienten U (U-<br />
Wert) des Bauteils, welcher der Kehrwert<br />
des Wärmedurchgangswiderstands ist<br />
(Tafel 1).<br />
Bild 3: Wärmedurchgang durch ein Bauteil<br />
U = 1 R T<br />
=<br />
R si +<br />
i<br />
1<br />
d i<br />
l i<br />
+ R se W<br />
(m²·K)<br />
198