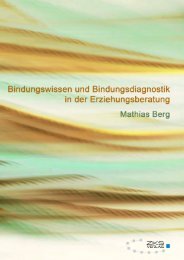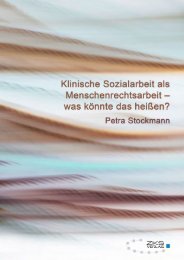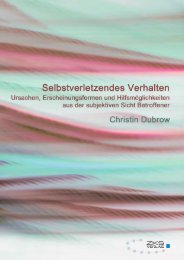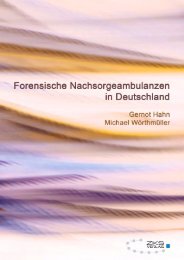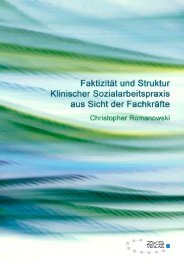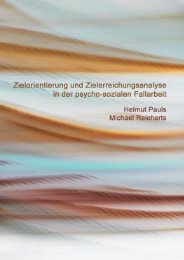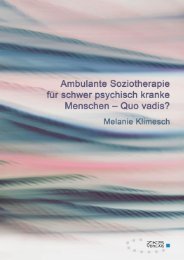Download (124 Seiten) - ZKS-Verlag
Download (124 Seiten) - ZKS-Verlag
Download (124 Seiten) - ZKS-Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einzigen Wiener Jugendamt (Bezirksjugendamt Hernals) die Methode der „vertieften<br />
Einzelfallhilfe“, wie die Methode genannt wurde, angewandt und bis 1960<br />
auf alle Bezirksjugendämter ausgedehnt, beschreibt Wolfgruber den Beginn<br />
methodischer Überlegungen in Ausbildung und Praxis der Jugendwohlfahrt in<br />
Wien. Dies wurde von den PraktikerInnen sehr unterschiedlich bewertet. Vor<br />
allem ältere FürsorgerInnen waren sehr skeptisch, die Jüngeren hat die<br />
„akzeptierende Haltung“ und die neue Gesprächsführung im Case<br />
Managements – durch das „Erkennen des Problems“ begeistert (vgl.<br />
Wolfgruber 2006:23). Wolfgruber erklärt, die lange Zeit fehlende theoretische<br />
und methodische Basis darin, dass im Anschluss an den Nationalsozialismus<br />
der Rekurs auf die einschlägige Wiener Theoriebildung der 1920-er Jahre<br />
fehlte. „Den grundlegenden Arbeiten von Ilse Arlt, die auch vergeblich eine<br />
interdisziplinäre wissenschaftliche Erforschung der Fürsorge forderte, wurden<br />
weder in Österreich noch international entsprechend beachtet. Nach 1945<br />
gerieten Arlts Schriften über Theorie und Praxis der Fürsorge (Arlt 1921, 1958)<br />
lange Jahre vollends in Vergessenheit.“ (Wolfgruber 2006:23) Ab Mitte der<br />
1950-er Jahre wurde das Case Management um andere methodische Ansätze<br />
erweitert. Was die Beziehung zwischen KlientIn und SozialarbeiterIn betrifft,<br />
weist Wolfgruber darauf hin, dass die Erzählungen ihrer Interviewpartnerinnen<br />
von einem Kontakt berichten, „der sich vornehmlich in der Nichtexistenz von<br />
Beziehung und Anonymität auszeichnete, unabhängig davon, ob sich die<br />
‚Parteien‘ freiwillig an das Jugendamt wandten oder von Fürsorgerinnen<br />
‚aufgesucht‘ wurden.“ (Wolfgruber 2006:24) Die FürsorgerInnen blieben bis<br />
Mitte der 1960-er Jahre, trotz neuer methodischer Ansätze für die KlientInnen<br />
namenlos, die KlientInnen zu einer simplen Kennziffer sozialer Bedürftigkeit<br />
oder Abweichung reduziert, was Wolfgruber auch auf die formalisierte<br />
Aktenführung zurückführt. Häufiger Wechsel der FürsorgerInnenu, oftmals auch<br />
von oben verfügt, um die Beziehungen zu den KlientInnen und zum „Sprengel“<br />
nicht zu eng werden zu lassen, um damit die professionelle Distanz zu wahren,<br />
erschwerten zusätzlich die Kontinuität bereits bestehender Beziehungen (vgl.<br />
Wolfgruber 2006:26f). Hierarchisch waren die FürsorgerInnen den meist<br />
weiblichen OrganisationsfürsorgerInnen und den meist männlichen<br />
47