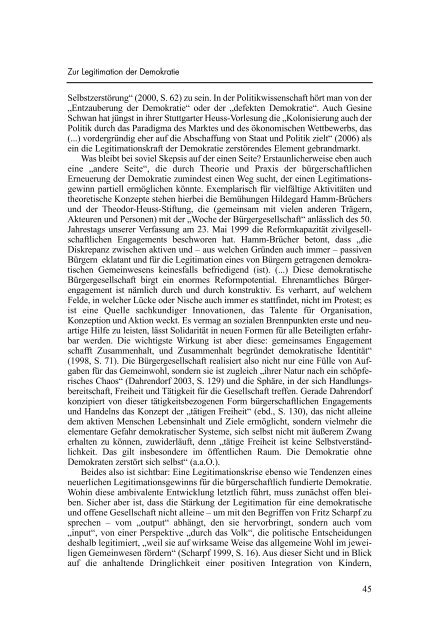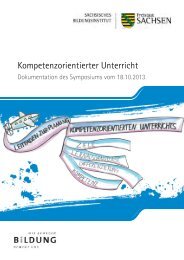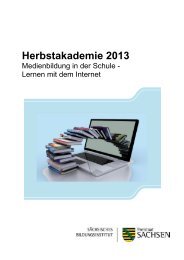Demokratisch Handeln - Sächsisches Bildungsinstitut (SBI)
Demokratisch Handeln - Sächsisches Bildungsinstitut (SBI)
Demokratisch Handeln - Sächsisches Bildungsinstitut (SBI)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zur Legitimation der Demokratie<br />
Selbstzerstörung“ (2000, S. 62) zu sein. In der Politikwissenschaft hört man von der<br />
„Entzauberung der Demokratie“ oder der „defekten Demokratie“. Auch Gesine<br />
Schwan hat jüngst in ihrer Stuttgarter Heuss-Vorlesung die „Kolonisierung auch der<br />
Politik durch das Paradigma des Marktes und des ökonomischen Wettbewerbs, das<br />
(...) vordergründig eher auf die Abschaffung von Staat und Politik zielt“ (2006) als<br />
ein die Legitimationskraft der Demokratie zerstörendes Element gebrandmarkt.<br />
Was bleibt bei soviel Skepsis auf der einen Seite Erstaunlicherweise eben auch<br />
eine „andere Seite“, die durch Theorie und Praxis der bürgerschaftlichen<br />
Erneuerung der Demokratie zumindest einen Weg sucht, der einen Legitimationsgewinn<br />
partiell ermöglichen könnte. Exemplarisch für vielfältige Aktivitäten und<br />
theoretische Konzepte stehen hierbei die Bemühungen Hildegard Hamm-Brüchers<br />
und der Theodor-Heuss-Stiftung, die (gemeinsam mit vielen anderen Trägern,<br />
Akteuren und Personen) mit der „Woche der Bürgergesellschaft“ anlässlich des 50.<br />
Jahrestags unserer Verfassung am 23. Mai 1999 die Reformkapazität zivilgesellschaftlichen<br />
Engagements beschworen hat. Hamm-Brücher betont, dass „die<br />
Diskrepanz zwischen aktiven und – aus welchen Gründen auch immer – passiven<br />
Bürgern eklatant und für die Legitimation eines von Bürgern getragenen demokratischen<br />
Gemeinwesens keinesfalls befriedigend (ist). (...) Diese demokratische<br />
Bürgergesellschaft birgt ein enormes Reformpotential. Ehrenamtliches Bürgerengagement<br />
ist nämlich durch und durch konstruktiv. Es verharrt, auf welchem<br />
Felde, in welcher Lücke oder Nische auch immer es stattfindet, nicht im Protest; es<br />
ist eine Quelle sachkundiger Innovationen, das Talente für Organisation,<br />
Konzeption und Aktion weckt. Es vermag an sozialen Brennpunkten erste und neuartige<br />
Hilfe zu leisten, lässt Solidarität in neuen Formen für alle Beteiligten erfahrbar<br />
werden. Die wichtigste Wirkung ist aber diese: gemeinsames Engagement<br />
schafft Zusammenhalt, und Zusammenhalt begründet demokratische Identität“<br />
(1998, S. 71). Die Bürgergesellschaft realisiert also nicht nur eine Fülle von Aufgaben<br />
für das Gemeinwohl, sondern sie ist zugleich „ihrer Natur nach ein schöpferisches<br />
Chaos“ (Dahrendorf 2003, S. 129) und die Sphäre, in der sich Handlungsbereitschaft,<br />
Freiheit und Tätigkeit für die Gesellschaft treffen. Gerade Dahrendorf<br />
konzipiert von dieser tätigkeitsbezogenen Form bürgerschaftlichen Engagements<br />
und <strong>Handeln</strong>s das Konzept der „tätigen Freiheit“ (ebd., S. 130), das nicht alleine<br />
dem aktiven Menschen Lebensinhalt und Ziele ermöglicht, sondern vielmehr die<br />
elementare Gefahr demokratischer Systeme, sich selbst nicht mit äußerem Zwang<br />
erhalten zu können, zuwiderläuft, denn „tätige Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit.<br />
Das gilt insbesondere im öffentlichen Raum. Die Demokratie ohne<br />
Demokraten zerstört sich selbst“ (a.a.O.).<br />
Beides also ist sichtbar: Eine Legitimationskrise ebenso wie Tendenzen eines<br />
neuerlichen Legitimationsgewinns für die bürgerschaftlich fundierte Demokratie.<br />
Wohin diese ambivalente Entwicklung letztlich führt, muss zunächst offen bleiben.<br />
Sicher aber ist, dass die Stärkung der Legitimation für eine demokratische<br />
und offene Gesellschaft nicht alleine – um mit den Begriffen von Fritz Scharpf zu<br />
sprechen – vom „output“ abhängt, den sie hervorbringt, sondern auch vom<br />
„input“, von einer Perspektive „durch das Volk“, die politische Entscheidungen<br />
deshalb legitimiert, „weil sie auf wirksame Weise das allgemeine Wohl im jeweiligen<br />
Gemeinwesen fördern“ (Scharpf 1999, S. 16). Aus dieser Sicht und in Blick<br />
auf die anhaltende Dringlichkeit einer positiven Integration von Kindern,<br />
45