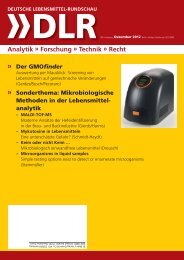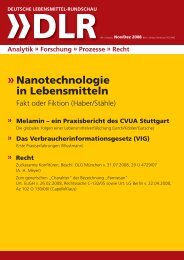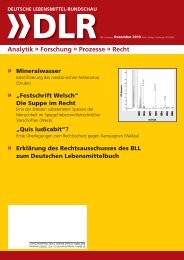Recht - DLR Online
Recht - DLR Online
Recht - DLR Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abgrenzung von Lebensmitteln und Arzneimitteln<br />
deutlich auf, wie groß das Unbehagen über die<br />
weiterhin bestehende <strong>Recht</strong>sunsicherheit bei allen<br />
Beteiligten ist.<br />
Risiko als Thema des Lebensmittelrechts:<br />
Symposium der Forschungsstelle für Lebensmittelrecht<br />
an der Universität Bayreuth<br />
Laura Schnall<br />
Forschungsstelle für Lebensmittelrecht an der Universität<br />
Bayreuth<br />
Lehrstuhl Prof. Leible, Universität Bayreuth, 95440<br />
Bayreuth (Tel.: 0049-921-552901, Fax: 0049-921-<br />
552081, E-Mail: stefan.leible@uni-bayreuth.de)<br />
„Wo bleiben denn da noch Menschenwürde und<br />
persönliche Freiheit“, tat ein Teilnehmer des diesjährigen<br />
Symposiums der Forschungsstelle für<br />
deutsches und europäisches Lebensmittelrecht<br />
am 7. und 8. Februar 2008 an der Universität<br />
Bayreuth sein Erstaunen kund, nachdem Professorin<br />
Hannelore Daniel (TU München) einen<br />
spannenden Einblick in die molekulare Ernährungsforschung<br />
gewährt hatte. Was manchen<br />
Zuhörer dabei irritierte, waren die von Professorin<br />
Daniel dargestellten Möglichkeiten der<br />
nahen Zukunft: Dank der Entschlüsselung des<br />
menschlichen Genoms könne neben verschiedenen<br />
Krankheitsrisiken nun auch der Stoffwechseltyp<br />
des einzelnen Menschen geklärt werden.<br />
Auf dieser Grundlage sei es möglich, individuell<br />
zugeschnittene Ernährungsprogramme für Personen<br />
anhand ihrer DNA zu erstellen und ihnen<br />
anschließend diese gezielte Ernährungsberatung<br />
zu vermitteln.<br />
Die steigende Nachfrage nach derartigen wissenschaftlichen<br />
Ansätzen hat ihre Ursache nicht zuletzt in<br />
der häufig unausgewogenen Ernährung der mitteleuropäischen<br />
Bevölkerung. Dies verlangt geradezu neue<br />
Wege der Risikokommunikation. Voraussetzungen<br />
einer sachgerechten Risikokommunikation sind allerdings<br />
zuvor die wissenschaftliche Ermittlung und Bewertung<br />
der jeweiligen Risiken sowie entsprechender<br />
Handlungsmöglichkeiten. Gefragt sind dabei insbesondere<br />
die Unternehmen der Lebensmittelindustrie<br />
wie auch die Behörden, um durch schnelle und zuverlässige<br />
Information zur Gewährleistung eines hohen<br />
Schutzniveaus für Leben und Gesundheit der gesamten<br />
Bevölkerung beizutragen.<br />
Mit der komplexen Thematik „Risiko als Thema<br />
des Lebensmittelrechts: Risikobewertung, Risikomanagement,<br />
Risikokommunikation“ setzten<br />
sich in diesem Jahr daher über 80 Teilnehmer mit<br />
hochkarätigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft<br />
und Verwaltung auf dem Symposium auseinander,<br />
organisiert von Prof. Dr. Alfred Hagen<br />
Meyer, dem geschäftsführender Vorstand des Fördervereins,<br />
geleitet von Prof. Dr. Stefan Leible,<br />
dem neuen Direktor der Forschungsstelle.<br />
(von links nach rechts) Prof. Leible (Direktor Forschungsstelle), Prof. Gundel (Forschungsstelle), Prof.<br />
Meyer (geschäftsführender Vorstand Förderverein), Laura Schnall (Leitung Forschungsstelle), Prof.<br />
Kalscheuer (Vorsitzender Förderverein), Prof. Daniel (TU Weihenstephan, Referentin), Dr. Schaffert<br />
(BGH, Teilnehmer)<br />
Was aber bedeutet überhaupt „Risiko“? Dr. Gerhard<br />
Zellner, Leitender Ministerialrat im Bayerischen<br />
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit<br />
und Verbraucherschutz, will es als Zusammenspiel<br />
der Wahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses<br />
und dem Ausmaß des Schadens verstanden wissen.<br />
Eine Abweichung zwischen der wissenschaftlichen<br />
Feststellung eines Risikos und dessen emotionaler<br />
Wahrnehmung in der Bevölkerung stellte<br />
Dr. Julia Gelbert vom Bund für Lebensmittelrecht<br />
und Lebensmittelkunde fest. So befürchten rund<br />
25–50 % der Verbraucher, „chemisch verseuchte“<br />
Lebensmittel zu sich zu nehmen. Als Ursache<br />
nennt Dr. Gelbert ein allgemein sinkendes Grundvertrauen,<br />
mangelnde Kenntnisse über die Herstellung<br />
von Nahrungsprodukten und die Darstellungen<br />
in den Medien. Naturgemäß werde meist eher<br />
negativ über Mängel, als positiv über Qualität von<br />
Lebensmitteln berichtet, nach dem Motto „Only<br />
bad news are good news.“<br />
Amtliche Kontrollen sollen lebensmittelrechtlichen<br />
Verstößen grundsätzlich vorbeugen. In Bayern<br />
existiert seit den „Gammelfleischskandalen“ im<br />
Jahr 2006 eine Spezialeinheit „Lebensmittelsicherheit“<br />
beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,<br />
die in der Regel gemeinsam mit<br />
der örtlichen Behörde Betriebskontrollen durchführt.<br />
Fabian Baumann berichtete als Vertreter<br />
der Spezialeinheit von deren Einbindung in das<br />
EU-Schnellwarnsystem (SWS). Dieses ermöglicht<br />
ein rasches Zugreifen vor Ort, wenn zum Beispiel<br />
eine Meldung französischer Behörden über das<br />
Auffinden mangelhafter Ware berichtet, die über<br />
bayerische Zwischenhändler aus Italien nach Frankreich<br />
geliefert worden ist.<br />
Neben Betrieben aus der Lebensmittelindustrie<br />
sind auch öffentliche Einrichtungen vor Fehlern in<br />
der Lebensmittelüberwachung nicht gefeit. Über<br />
die Folgen von staatlichem Fehlverhalten sprach<br />
Professor Jörg Gundel (Universität Bayreuth).<br />
So ist es denkbar, dass die Behörde eines EU-<br />
Mitgliedstaates fälschlicherweise vor bestimmten<br />
Produkten warnt und dadurch für das betroffene<br />
Unternehmen ein größerer wirtschaftlicher Schaden<br />
eintritt. Will das Unternehmen dafür jemanden<br />
haftbar machen, stößt es oft auf Schwierigkeiten.<br />
Aufgrund fehlender Haftungsnormen und hoher<br />
Anforderungen der Gerichte an die Geltendmachung<br />
von Staatshaftungsansprüchen auf nationaler<br />
und europäischer Ebene bestehen für deren<br />
tatsächliche Durchsetzbarkeit nämlich nur geringe<br />
Erfolgschancen.<br />
Soweit Informationen über schädliche Lebensmittel<br />
in den Medien und auf staatlichen Internetplattformen<br />
kursieren, bezwecken sie regelmäßig<br />
den Schutz des Verbrauchers. Mit dem neuen<br />
Verbraucherinformationsgesetz wurde zusätzlich<br />
ein <strong>Recht</strong>sanspruch des Verbrauchers auf Zugang<br />
zu den bei den Behörden vorhandenen amtlichen<br />
Informationen zu Lebens- und Futtermitteln geschaffen.<br />
Die Veröffentlichung von Daten, welche<br />
einzelne Unternehmen betreffen, wird ab dem 1.<br />
Mai 2008, wenn das Gesetz in Kraft tritt, bei entsprechenden<br />
Verbraucheranfragen zum Regelfall,<br />
ihre Nicht-Veröffentlichung zur Ausnahme. Ein<br />
Grund für eine solche Ausnahme kann nach Dr.<br />
Marcus Girnau, Bund für Lebensmittelrecht und<br />
Lebensmittelkunde, beispielsweise die Wahrung<br />
von Geschäftsgeheimnissen sein.<br />
150 ı Informationen Deutsche Lebensmittel-Rundschau ı 104. Jahrgang, Heft 3, 2008