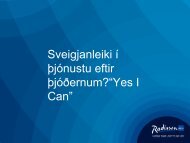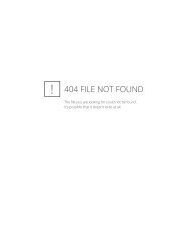Die deutsch isländischen Beziehungen
Die deutsch isländischen Beziehungen
Die deutsch isländischen Beziehungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„germanische Geist“ gestärkt werden, was unter anderem mit einer Ausweitung dieses<br />
Begriffs auf den Pangermanismus und das Postulieren einer gemeinsamen nordischgermanischen,<br />
heldenhaften Vergangenheit geschah, wie es beispielweise Fichte, Arndt oder<br />
die Gebrüder Grimm taten. So baut beispielsweise Jacob Grimms „Deutsche Mythologie“ von<br />
1835 im Wesentlichen auf der altisländischen Edda auf.<br />
Waren altisländische Texte <strong>deutsch</strong>en Dichtern und Denkern im 17. und 18. Jahrhundert<br />
zunächst durch in Schweden und Dänemark erschienene lateinische Übersetzungen<br />
zugänglich, so führten die politisch-philosophischen Entwicklungen in Deutschland auch zu<br />
einem vermehrten Interesse an diesen Texten und zu einer vermehrten Übersetzungstätigkeit.<br />
So wurden zum Beispiel im 18. Jahrhundert erste Lieder der Edda ins Deutsche übertragen, zu<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts erschien die erste umfassendere <strong>deutsch</strong>e Übersetzung der Prosa-<br />
Edda, der im Laufe des Jahrhunderts weitere folgten. <strong>Die</strong> erste <strong>deutsch</strong>e Übersetzung der<br />
Völsungensaga datiert auf 1815, der Gisli und Egils Saga in Auszügen auf 1816 und der<br />
Heimskringla auf 1835-1837. Auch die Gebrüder Grimm versuchten sich an einer<br />
Übersetzung der Edda, von der aber nur der erste Band erschien.<br />
Unmittelbar profitiert von den Übersetzungen hat auch Richard Wagner. Sein Opernzyklus<br />
„Der Ring des Nibelungen“, der in der Zeit von 1848 bis 1874 entstanden ist, lässt dem Titel<br />
nach zwar auf stoffliche Vorlagen aus dem <strong>deutsch</strong>en Sprachraum im Allgemeinen und dem<br />
Nibelungenlied im Besonderen schließen, in der Tat stammen die überwiegenden Motive<br />
seines Rings aus der altisländischen Literatur, wie Wagner auch selber formulierte:<br />
„Unwiderstehlich … auf die nordischen Zeugnisse … hingewiesen, suchte ich nun auch,<br />
soweit mir dies ohne fließende Kenntnis der nordischen Sprachen möglich war, die `Edda´<br />
sowie die prosaischen Aufzeichnungen der großen Bestandteile der Heldensage mir vertraut<br />
zu machen. Von entscheidendem Einfluss auf die bald in mir sich gestaltende Behandlung<br />
dieses Stoffes war – die Lektüre der `Wälsungensaga´. 6<br />
Er bediente sich im Wesentlichen viererlei Quellen: der Lieder- sowie der Prosa-Edda, der<br />
Völsungensaga und der Þidreks Saga. Gleichwohl muss natürlich betont werden, dass Wagner<br />
mit seinem Ring etwas gänzlich Selbständiges geschaffen hat, indem er seine Vorlagen für<br />
seine Zwecke zu einem neuen Ganzen zusammenfügte.<br />
Nicht nur inhaltlich, auch in Bezug auf die Form blieb Wagner von der altisländischen<br />
Literatur nicht unbeeindruckt und übernahm in seinen Dichtungen die Verwendung des<br />
Stabreims, dem typischen Stilmittel der isländischen Sagas.<br />
6 Richard Wagner: Mein Leben. Teil I, Leipzig 1986, S. 394-395.<br />
18