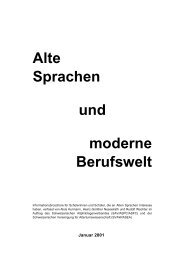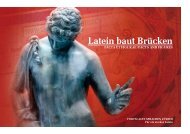PDF -Fassung - Schweizerischer Altphilologenverband
PDF -Fassung - Schweizerischer Altphilologenverband
PDF -Fassung - Schweizerischer Altphilologenverband
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Rezensionen<br />
Die Worte der Sieben Weisen, Griechisch und Deutsch, herausgegeben, übersetzt<br />
und kommentiert von Jochen Althoff und Dieter Zeller, Texte zur Forschung,<br />
Darmstadt (WBG) 2006, CHF 66.70, 196 S.<br />
Während frühere Ausgaben nur die den sog. Sieben Weisen zugeschriebenen<br />
Einzelworte in einer Form auflisten, legen die Herausgeber des neuen Bandes die<br />
verschiedenen Überlieferungsvarianten mit deutscher Übersetzung vor, was bisher<br />
fehlte. Im Zentrum des Interesses stehen nicht die Persönlichkeiten (der Kanon der<br />
Weisen ist bereits in der Antike nach Namen und Anzahl sehr unterschiedlich; als<br />
Kollegium erscheinen sie ohnehin erst in Platons Protagoras), sondern die Texte<br />
selbst, die nach den Ausführungen über die Zeugnisse und Überlieferungsgeschichte<br />
(auch die Zuordnung der einzelnen Aussprüche variiert beträchtlich) im ersten<br />
Teil in den Varianten des Demetrios von Phaleron (überliefert bei Stobaios) bzw.<br />
Diogenes Laertios wiedergegeben werden. Es folgen Erläuterungen zu weiteren<br />
Überlieferungen in Form von Inschriften und Papyri, die wiederum mit deutscher<br />
Übersetzung aufgelistet werden.<br />
Im zweiten Teil untersucht Markus Asper die Funktion der Sieben Weisen<br />
bzw. ihrer Sprüche. Diese richteten sich offenbar nicht an die Allgemeinheit –<br />
dazu seien sie zu banal –, sondern sollten als Standesethik zu einer Stabilisierung<br />
adliger Gruppen beitragen, indem sie sich gegen Machtkonzentrationen einzelner<br />
oder das Auftreten von Emporkömmlingen richteten. Die Sieben Weisen hingegen<br />
hät ten entgegen legendenhaften Darstellungen nie als Gruppe existiert, sondern<br />
seien als Autoritätskonstruktion in die Vergangenheit projiziert worden.<br />
Im dritten Teil stellt Dieter Zeller den oft rätselhaften Worten Parallelstellen<br />
unterschiedlicher Herkunft aus der griechischen Literatur und teils aus dem Alten<br />
Testament gegenüber, um so ihren Kontext aufzuhellen. Dabei sind sie thematisch<br />
übersichtlich nach allgemeinem Inhalt, dem Verhältnis des Menschen zu sich<br />
selbst, den andern, dem Staat und den Göttern angeordnet.<br />
Im letzten Teil befaßt sich Lothar Spahlinger mit der Rezeption der Sprüche<br />
in der lateinischen Spätantike v.a. anhand der (echten und unechten) Werke des<br />
Ausonius, in einer Zeit also, in der sich die Wertschätzung der Sprüche bei der<br />
politischen Elite, die sich durch die Verbreitung des Christentums in eine pagane<br />
Innterlichkeit zurückzog, zum letzten Mal verstärkte, ehe sie bis zur Renaissance<br />
praktisch dem Vergessen anheimfielen. In zwei Anhängen listet Spahlinger die<br />
Reihenfolge der Weisen in den literarischen Quellen der lateinischen Kaiserzeit<br />
und Spätantike auf und fügt Ausonius’ Ludus septem sapientum mit Übersetzung<br />
bei.<br />
Bulletin 70/2007 35