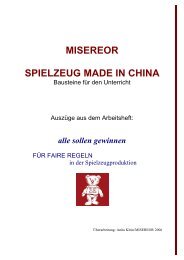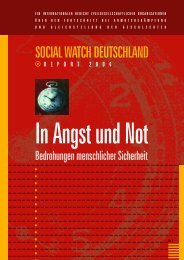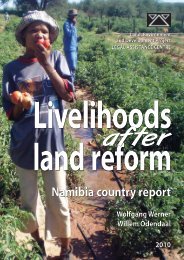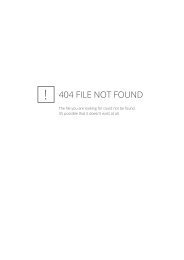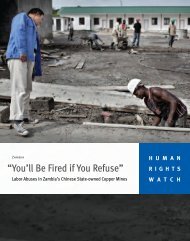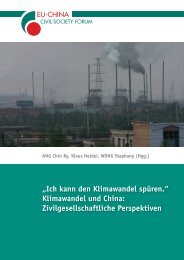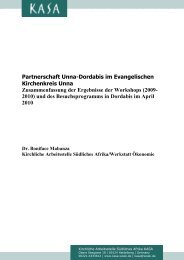MaliLernen und LachenEin Klassenzimmer in Westafrika12Schulschlaf:Ende eineslangen TagesFoto: Veit MetteLernen mit SpaßFoto: Veit MetteFatou ist eingeschlafen. Kaum hatte der Unterrichtbegonnen, da fielen ihr schon die Augen zu. Auf densanften Stups ihrer Nachbarin reagiert sie nicht mehr,also lässt man sie schlafen. Es ist ein merkwürdigesKlassenzimmer in Bamako, der Hauptstadt von Mali:Es scheint fast, als mangele es hier an der nötigenDisziplin. Fatou schläft, andere Mädchen sprechenund kichern miteinander. Die Tür steht weit offen;mal kommt eine Schülerin verspätet herein, eineandere muss früher gehen. Auch die Zeit ist ungewöhnlich:Der Unterricht hat erst abends um achtbegonnen; draußen ist es schon stockdunkel. Knapp30 Schülerinnen sind hier versammelt. Es sind jungeFrauen darunter; eine von ihnen trägt ein Baby aufdem Rücken. Andere, wie die elfjährige Fatou, sindselbst noch Kinder. Aber eines haben alle gemeinsam:einen schweren Job. Die Mädchen, die hieram Abend die Schulbank drücken, arbeiten tagsüberals Hausmädchen, so wie tausende andere inWestafrika, die ihre Dörfer verlassen haben, um inder Stadt ein bisschen Geld zu verdienen.Arbeitende SchattenAuch die 15-jährige Assan Fofana besucht die Abendschule.Vor drei Jahren haben ihre Eltern sie in denZug nach Bamako gesteckt, seitdem arbeitet sie imHaus einer Witwe mit acht Kindern. Ihr Arbeitstagist lang und hart: Um fünf wird sie geweckt, undnach dem Morgengebet, das der Islam vorschreibt,bereitet sie das Frühstück. Sämtliche Hausarbeit istSache von Assan. Nach dem Frühstück putzt sie dasHaus, während die Kinder ihrer Chefin zur Schulegehen. Danach steht sie gebückt über den Plastikwannenim Innenhof und wäscht die Kleider derFamilie. Sobald die Wäsche auf der Leine hängt, musssie die täglichen Einkäufe erledigen und anschließenddas Mittagessen vorbereiten – meist Reis oder Hirsemit einer Soße aus Gemüse, manchmal auch Fleisch.Nicht nur für die Arbeit im Haus ist Assan zuständig,sie muss auch Geld verdienen für ihre Arbeitgeber.Das Produktivkapital der Familie ist eine große,altersschwache Kühltruhe, in der Leitungswassergelagert wird – abgepackt in kleinen durchsichtigenPlastiktüten. Solche Beutel werden hier an jederEcke angeboten: Der Käufer beißt ein kleines Lochhinein und spritzt sich das Wasser in den Mund.Am späten Vormittag, wenn die Tageshitze einsetzt,schleppt Assan einen großen Eimer mit Wasserbeutelnzum Markt. »Das ist die schwerste Zeit <strong>des</strong>Tages«, sagt sie. Die Hitze, das Gewicht <strong>des</strong> Eimers,das Gedränge auf dem Markt, der Ärger mit unfreundlichenKunden – eine endlose Quälerei. Undimmer die Angst, nicht genug zu verkaufen: ZehnFrancs-CFA kostet so ein Beutel, das sind anderthalbCent. 150 Beutel pro Tag soll sie verkaufen, anderenfallskann es Ärger geben. Einmal, gegen zwei Uhrnachmittags, kommt sie zum Haus zurück, um etwaszu essen und den Eimer nachzufüllen. Dann geht siewieder auf den Markt.Dieser Markt ist nicht der bunte und freundliche»Marché Rose« von Bamako, der in jedem Reiseführerabgebildet ist. Es ist der Markt der armenLeute, auf den sich <strong>kein</strong>e Touristen verirren: Bretterverschlägeauf schlammigem Boden, faulige Gerüche,
Malitrocknender Fisch in praller Sonne, Berge von Altkleidern,Autoschrott aus Europa. Viele Kinder sindhier unterwegs. Sie bieten Früchte, Batterien, Erdnüsseoder Holzkohlen an; Zigaretten werden einzelnverkauft, denn die Kundschaft ist knapp bei Kasse.Assan hasst die Arbeit auf dem Markt. Früher hatsie ihrer Chefin geholfen, Stoffe zu färben. »Das warnicht so anstrengend, und ich habe etwas dabei gelernt«,sagt sie. Sie träumt davon, selbst einmal alsFärberin zu arbeiten. Die haben ein sicheres Einkommen,denn für schöne Stoffe gibt es in Westafrikaimmer einen Markt. Doch nun lebt die Familie nurnoch vom Verkauf <strong>des</strong> Wassers, und Assan hatAngst, dass sie alles wieder vergisst, was sie überdas Färben gelernt hat.Am späten Nachmittag geht die Arbeit zu Hauseweiter. Der Wasserverkauf für den nächsten Tag mussvorbereitet werden: Assan füllt Wasser in die Plastikbeutel,verknotet sie sorgfältig und packt sie in dieKühltruhe. Anschließend macht sie das Aben<strong>des</strong>sen.Das ist ihr Arbeitstag, an sieben Tagen in derWoche. Pro Monat bekommt sie dafür 5.000 Francs-CFA – etwa acht Euro, dazu das Essen und denSchlafplatz auf einer Bastmatte.Glückliche MomenteSo wie die meisten Hausmädchen in Westafrika arbeitetauch Assan, um ihre Aussteuer zu verdienen.Eine Truhe mit allem, was ein Mädchen für dieHochzeit braucht, kostet mehr als 100 Euro. ZweiJahre noch, dann hat sie das Geld zusammen, meintsie. Dann wird sie in ihr Dorf zurückkehren und denMann heiraten, den ihr Vater für sie ausgesucht hat.Eine Schule hat Assan nie besucht; nur ihre Brüderdurften zur Schule gehen. Weil das so üblich ist,sind in manchen ländlichen Gegenden Malis fast90 Prozent der Frauen Analphabetinnen. Assan erfuhrauf dem Markt, dass es eine Abendschule fürHausmädchen gibt. Jetzt besucht sie jeden Abendden Unterricht. Sie lernt schreiben und rechnen,aber es wird auch über das Leben gesprochen:Schwangerschaft, Heirat, Arbeit, Drogen, AIDS.Der Verein »Mali Enjeu« bietet die Abendkursefür Hausmädchen an. »Die meisten dieser Mädchensind total isoliert. Sie werden ausgebeutet, und auchSchläge und sexuelle Übergriffe sind <strong>kein</strong>e Seltenheit«,sagt der Lehrer Amadou Diarra. Er ist Direktoreiner Grundschule; die Hausmädchen unterrichteter in seiner Freizeit. Er weiß genau, welchenArbeitstag die Mädchen hinter sich haben, wennsie abends in seiner Klasse sitzen. Darum lässt erdie kleine Fatou schlafen, und er sorgt dafür, dassder Unterricht den Mädchen Spaß macht. »Es gehtuns hier nicht nur um Alphabetisierung«, erklärter, »sondern um die Persönlichkeitsentwicklung.MaliMali steht in einer der traurigsten Ranglisten derWelt auf Platz sechs: UNICEF listet Staaten nachder Sterblichkeitsrate der Kinder unter fünf Jahren.In Mali sterben 231 Kinder von 1.000 vor ihremfünften Geburtstag. Mali gehört zu den ärmstenLändern der Welt mit einem Bruttosozialproduktvon 210 US-Dollar pro Kopf der Bevölkerung(<strong>Deutschland</strong>: 23.700 US-Dollar). 73 Prozent derBevölkerung haben weniger als einen Dollar pro Tag. Nur 51 Prozent derJungen und 36 Prozent der Mädchen gehen zur Schule.<strong>terre</strong> <strong>des</strong> <strong>hommes</strong> unterstützt in Mali, Burkina Faso und Gambia Projektefür Dienstmädchen, gegen Kinderhandel und Klitorisbeschneidungsowie Dorfentwicklungsprojekte gegen Landflucht und soziale Verelendungvon Jugendlichen.DienstmädchenWie viele Mädchen auf der Welt früh ihr Zuhause verlassen und als Dienstmädchenschuften – darüber gibt es kaum Daten. Auch die ILO schätztnur, dass die Zahl »sehr hoch« ist. Dienstmädchen schuften buchstäblichim Verborgenen, sie sind oft völlig isoliert und der Ausbeutung und Willkürihrer Arbeitgeber ausgeliefert. Die philippinische Organisation »VisayanForum« schätzt, dass dort 200.000 Mädchen unter 16 Jahren als Dienstmädchenarbeiten. Für Indonesien nennt die ILO eine Zahl von fünf MillionenMädchen. Eine <strong>terre</strong> <strong>des</strong> <strong>hommes</strong>-Studie über <strong>Kinderarbeit</strong> in Westafrikagibt allein für die beiden großen Städte im kleinen Land Benin dieZahl von 100.000 Dienstmädchen an. 13 Prozent sind jünger als zehn Jahre,56 Prozent sind zwischen zehn und 13 Jahren alt. Sie gehen nicht zurSchule, arbeiten bis zu 15 Stunden täglich und haben niemals frei. EinigeDienstmädchen sind Schlägen, schlechter Ernährung und sexueller Belästigungdurch ihre Dienstherren ausgesetzt.Hier haben die Mädchen die Möglichkeit, Freundinnenzu treffen, sich auszutauschen und überihre Probleme zu sprechen.«Oft wird in der internationalen Entwicklungspolitikin theoretisch-nichtssagenden Vokabelndas »alternative Bildungsangebot« gefordert, »dasan der Lebenssituation der Schüler orientiert ist«.In diesem Klassenzimmer in Bamako wird es praktiziert.Hier wird gelernt und gelacht, hier erlebendie Mädchen nach all der Arbeit ein paar glücklicheMomente. Um <strong>kein</strong>en Preis will Assan denUnterricht verpassen. Auch wenn sie so langearbeiten muss, dass sie erst um halb zehn ankommt– sie geht immer hin. »Die Schule«, sagtsie, »hat mir die Augen geöffnet. Und das Herz.«Stephan Stolze<strong>terre</strong> <strong>des</strong> <strong>hommes</strong> unterstützt die Schule für Hausmädchenin Bamako pro Jahr mit 10.000 Euro.13