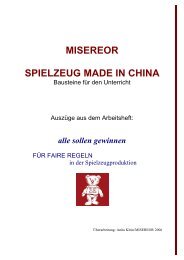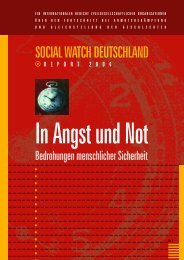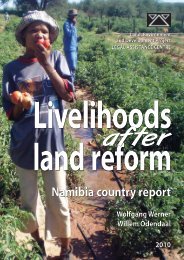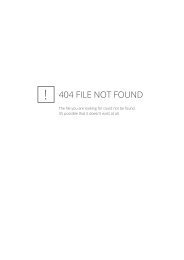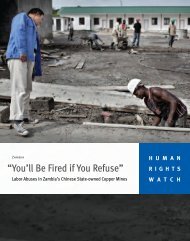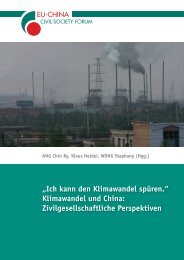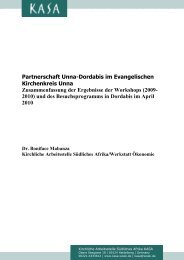BolivienDer Preis <strong>des</strong> Zinns<strong>Kinderarbeit</strong> im Boliviens Bergbauregion18Kinder und Jugendlichemahlen ErzstaubfeinFoto: Peter Strack /<strong>terre</strong> <strong>des</strong> <strong>hommes</strong>Früher gab es für die Kinder der COMIBOL-Minenarbeiterin Boliviens staatlicher Zinnmine noch verbilligteLebensmittel. Die Gesundheitsversorgungwar kostenlos, und die Kinder konnten regelmäßigzur Schule gehen. In den 1980er Jahren begann dieKrise: Der Weltmarktpreis für Zinn sank. Die meistenstaatlichen Minen wurden daraufhin geschlossen.Über 32.000 Arbeiter wurden entlassen. Viele sindin den tropischen Teil Boliviens gezogen und lebenvom Anbau von Cocapflanzen. In den Bergbaugebietenwächst die Armut und immer mehr Kindermüssen arbeiten.Kahle braune Berge, graue Geröllmassen. Hierund dort ein Gebirgsfluss, der trübes, chemiever-Zinnbarone und <strong>Kinderarbeit</strong>erHeute sind die meisten Minen ausgebeutet und dasStraßenbild ist nicht mehr von Männern in Schutzhelmenund zerschlissener Arbeitskleidung geprägt.Statt<strong>des</strong>sen steigt die Zahl der Kinder, die als Lastenträger,Busschaffner, Schuhputzer, Straßenverkäuferoder auf den Erzhalden schuften. Wer heute noch imBergwerk arbeitet, tut dies auf eigene Faust und aufeigenes Risiko. Da die industrielle Verarbeitung zuteuer geworden ist, werden die Erze von Hand undunter Einsatz von giftigen Chemikalien in den Flüssengewaschen und konzentriert. Ungeklärt fließt diegefährliche Brühe flussabwärts, wo sie später dieFischbestände der Guaraní-Indianer im Pilcomayo-Fluss vergiften.»Mein Vater holt das Erz aus dem Berg undbringt es in Säcken hier an den Fluss. Da müssenwir es weiterverarbeiten. Die wertlosen Steinemüssen aussortiert werden, dann wird das Zinnherausgewaschen und nach Llallagua an die Kooperativeverkauft«, erzählt der elf Jahre alteMiguel Angel. Fünf Stunden am Tag schuftet erhier am Fluss. Die Arbeit macht ihn schon nacheiner halben Stunde müde. Weil sein Vater heutenicht so viel Erz gebracht hat, kann er mit denanderen Kindern Fußball spielen. »Da oben«,sagt er, »arbeiten welche, die sind noch viel jünger.Foto: ChristelKovermann / <strong>terre</strong><strong>des</strong> <strong>hommes</strong>seuchtes Wasser mit sich führt. Wer in dieser wüstenähnlichenGegend – 4.000 Meter über dem Meeresspiegel– lebt, muss hart arbeiten. Einst waren dieZinnminen von Potosí, Llallagua und Huanuni/Oruro der Reichtum Boliviens. Doch von demReichtum profitierten nur wenige. Einer von ihnenwar der Zinnbaron Simón Patiño, zu Lebzeiteneiner der reichsten Männer der Erde. Welchen Preisdie Arbeiter in den Minen aber für diesen Reichtumzahlen mussten, beschreibt der uruguayische SchriftstellerEduardo Galeano in seinem Buch »Die offenenAdern Lateinamerikas«: »Die bolivianischenMinenarbeiter gehen an verfaulten Lungen zuGrunde, damit die Welt billiges Zinn verbrauchenkann. Nach einem Jahr werden die ersten Symptomespürbar, und nach zehn Jahren zieht man inden Friedhof ein.«BolivienIn Bolivien haben 14 Prozent der Bevölkerung wenigerals 1 Dollar am Tag, das Bruttosozialprodukt liegtbei 940 US-Dollar pro Kopf. Acht Prozent der Männerund 21 Prozent der Frauen sind Analphabeten.91 Prozent der Kinder werden eingeschult, 18 Prozentbrechen die Schule vor dem fünften Schuljahr ab.
BolivienEs gibt auch welche, die im Bergwerk arbeiten.Aber das ist gefährlich wegen der herabfallendenSteine. Dunkel ist es auch. Einmal war ich im Stollen.Grässlich ist das, da würde ich nicht arbeitenwollen. Da hätte ich Angst.« Ein bisschen stolz ist erschon, dass er seinen Eltern helfen kann. Später willer mal was anderes machen und von hier fortgehen.Schreiner wäre sein Lieblingsberuf.»Leichte Arbeit«Der 14-jährige Basilio ist eines der wenigen Kinder,die im Bergwerkssektor von Llallagua für Lohn arbeiten.Etwas schüchtern zeigt er auf seinen Chef,der wenige Meter weiter Erz wäscht. Acht Stundenarbeitet er jeden Tag. »Es ist eine leichte Arbeit«, sagter. »Mein Vater arbeitet im Bergwerk, aber er verdientnicht genug. Früher habe ich Kleider genäht. Das istleichter und gefällt mir besser. Aber das lässt sich nichtmehr verkaufen.« Obwohl er wenig Zeit hat, geht Basilionicht nur in die Abendschule, sondern besuchteinmal wöchentlich die Kurse von CEPROMIN. »Umirgend etwas zu lernen«, wie er sagt. CEPROMIN(Centro de Promoción Minera) arbeitet seit vielenJahren in der Bergwerksregion. Angefangen hat dieArbeit mit Gesundheitsprojekten für die Minenarbeiterund ihre Familien. Weil aber immer mehr Kinder inder Region arbeiten müssen, kümmert sich CEPRO-MIN seit einigen Monaten auch um die arbeitendenKinder. Rodrigo ist seit Beginn <strong>des</strong> Projektes dabeiund besucht regelmäßig die Kurse von CEPROMIN.Er wohnt in der Bergarbeitersiedlung Siglo XX. SeinArbeitsplatz ist abseits der belebten Einkaufsstraßen,wo es vor allem Koka, das die Arbeiter gegen denHunger kauen, und billigen Schnaps zu kaufen gibt.In einem winzigen Zimmer zur Straße bietet er seineWaren an. »Die Leute wollen mich zwar immer übersOhr hauen. Verkauf es mir für zehn Centavos, sagensie, auch wenn es 20 kostet. Aber ich kenne diePreise. Meine Mutter hat sie mir beigebracht.« Durchdie Kurse bei CEPROMIN hat er auch von den Problemenanderer Kinder erfahren. Zum Beispiel vonden Schuhputzern. »Die versucht man auch ständigzu betrügen. Manchmal werden sie von den Erwachsenenauch angeschrien oder geschlagen.«Hilfsarbeiten und Erz waschenUm die Situation der minderjährigen Minenarbeiter zu untersuchen, führtedie bolivianische Nicht-Regierungsorganisation CEPROMIN auf Anregungvon <strong>terre</strong> <strong>des</strong> <strong>hommes</strong> eine Befragung unter den arbeitenden Kinderndurch. 221 der 342 befragten Kindern arbeiten danach im Bergbau oder dendamit zusammenhängenden Verarbeitungsprozessen. Die anderen Kindersind als Hilfsarbeiter auf den Märkten oder in kleinen Werkstätten beschäftigt.72 Prozent arbeiten zwischen acht und zehn Stunden täglich. 72,5 Prozentverdienen monatlich 300 Bolivianos (etwa 50 Euro).Den höchsten Anteil arbeitender Kinder im Alter zwischen acht undzwölf Jahren, so ergab die Untersuchung, findet man am »Cerro Rico« inPotosí. Sechs Prozent der Befragten sind Halbwaisen. Als Ursache gilt diehohe Sterblichkeitsrate bei den Minenarbeitern (Staublunge). 67 Prozentder Väter sind Bergarbeiter, acht Prozent Händler. Zwei Drittel der Mütterverrichten Hausarbeiten, elf Prozent arbeiten als »Erzklopferin« (palliri),zehn Prozent als Straßenhändlerin. Die meisten Kinder und Jugendlichensehen ihre Arbeit als eine »vorübergehende Notwendigkeit«. Die Eltern,so die Untersuchung, sehen in der Arbeit ihrer Kinder <strong>kein</strong>e Ausbeutung,sondern eine »notwendige Mithilfe«.Befragt nach ihren Lebensperspektiven, gaben 46 Prozent der Kinderund Jugendlichen an, später studieren zu wollen; 35 Prozent wollen einenpraktischen Beruf erlernen: Ingenieur, Buchhalter, Jurist, Zahnarzt, Mechanikeroder Elektriker. Die Tatsache, dass die meisten Kinder und Jugendlichendie Schule abgebrochen haben oder nur zeitweise besuchen, stehtin krassem Gegensatz zu den angegebenen Berufswünschen. Allerdingsgaben 29 Prozent an, die Schulausbildung »irgendwann« fortzusetzen.Kurse für die arbeitenden KinderIm bolivianische Jugendschutzgesetz (Código delMenor) wird das Recht auf Bildung, Gesundheit undFamilie betont. Obwohl das Gesetz internationalenStandards vergleichbare Schutzbestimmungen enthält,gefährliche und gesundheitsschädigende Tätigkeitenausdrücklich verboten und regelmäßige staatlicheKontrollen vorgeschrieben sind, wird in der BergwerksregionBoliviens täglich gegen diese Bestimmungenverstoßen. Das Gesetz erlaubt zwar, dass Jugendlicheunter 18 Jahren bis zu sechs Stunden pro Tagarbeiten dürfen, alle Formen der Gewalt und Ausbeutungvon Kindern und Jugendlichen sind aber ausdrücklichverboten. In Potosí, Llallagua und Huanunihaben die Gesetze aber offensichtlich <strong>kein</strong>e Gültigkeit.Das wissen auch die Mitarbeiter von CEPROMIN. Undso kann das Projekt nur ein kleiner Beitrag sein, diekonkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen ein wenigzu verbessern.Etwa 60 arbeitende Kinder und Jugendliche nehmen anden Kursen von CEPROMIN teil. Wichtig ist der Aspektder »technischen Weiterbildung«, wie die Mitarbeitervon CEPROMIN betonen. Für die Kinder und Jugendlichenaus dem Bergwerkssektor gehört dazu zum Beispielder Umweltaspekt bei der Erzverarbeitung sowiedie Frage, wie man die Arbeit leichter und ungefährlichergestalten kann. Ein anderer Kurs richtet sich anMädchen, die vorwiegend zu Hause, in Restaurantsoder als Dienstmädchen arbeiten. Weil viele Kindernur unregelmäßig zur Schule gehen können, bietetCEPROMIN kostenlosen Nachhilfeunterricht an.Peter Strack<strong>terre</strong> <strong>des</strong> <strong>hommes</strong> unterstützt die Arbeit vonCEPROMIN mit 6.000 Euro im Jahr.19