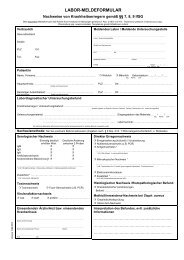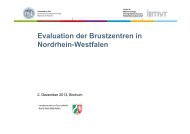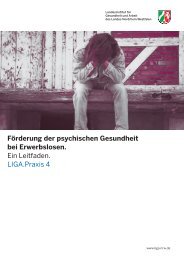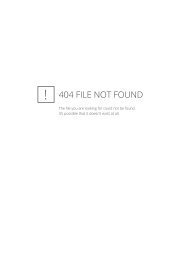Themenspezifische Planungshilfen - LZG.NRW
Themenspezifische Planungshilfen - LZG.NRW
Themenspezifische Planungshilfen - LZG.NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ortsnahe Koordinierung Häusliche Gewalt und Gesundheit<br />
10,2% der Patientinnen innerhalb des vorangegangenen Jahres sexuelle oder körperliche<br />
Gewalt erlebt (Romito, Garin 2001).<br />
In der repräsentativen deutschen Erhebung berichteten Frauen, die seit ihrem 16.<br />
Lebensjahr Gewalt erlitten hatten, deutlich mehr gesundheitliche Beschwerden in<br />
den letzten 12 Monaten als Frauen, die keine Gewalt erlebt haben. „Der Anteil der<br />
Frauen, die mehr als 11 Beschwerden genannt haben, war bei den Gewaltopfern in<br />
allen Kategorien fast doppelt so hoch wie bei den Frauen, die keine Gewalt erlebt<br />
haben.“ (Schröttle/Müller 2004: 141) Besonders ausgeprägt sind diese Zusammenhänge<br />
bei sexueller Gewalt, psychischer Gewalt und bei Gewalt in Paarbeziehungen.<br />
Bei den Opfern häuslicher Gewalt haben auffällig viele Frauen in den letzten<br />
12 Monaten häufig unter Rückenschmerzen, zu hohem/niedrigem Blutdruck, Kopfschmerzen,<br />
Gelenk- oder Gliederschmerzen und Magen-Darm-Problemen gelitten.<br />
Nach Gewalt in einer Paarbeziehung leiden Frauen auch relativ häufiger unter allen<br />
Formen von gynäkologischen Beschwerden, Ess-Störungen und Atemproblemen.<br />
Misshandlungen haben häufig körperliche Verletzungen zur Folge. 64% der<br />
betroffenen Frauen berichten, dass die Angriffe des Partners mindestens einmal<br />
eine Verletzung nach sich zogen; mehrheitlich (59%) gingen die Verletzungen sogar<br />
über Prellungen und blaue Flecken (die ja bei heftigen Schlägen durchaus schon<br />
gravierend sein können) hinaus. Bei Frauen geht Gewalt in Paarbeziehungen auch<br />
häufiger mit Verletzungsfolgen einher als dies in anderen Täter-Opfer-Kontexten<br />
der Fall ist.<br />
Die gesundheitlichen Auswirkungen reichen jedoch erheblich weiter. Alle erhobenen<br />
Formen von Gewalt (auch sexuelle Belästigung und Nachstellungen) können<br />
psychische und psychosomatische Folgebeschwerden auch über längere Zeit haben.<br />
Die jeweils schlimmste Situation körperlicher Gewalt hatte für fast zwei Drittel der<br />
Betroffenen psychische Folgen, aber bei 83% der Fälle psychischer Gewalt war<br />
dies der Fall: Dauerndes Grübeln, Niedergeschlagenheit, Depression und vermindertes<br />
Selbstwertgefühl wurden am häufigsten bei psychischer Gewalt genannt.<br />
Scham- und Schuldgefühle waren nach sexueller Gewalt mit 38% am häufigsten,<br />
wurden aber bei allen Gewaltformen bei mehr als 15% der Betroffenen angegeben.<br />
Schlafstörungen und Albträume nannten zwischen 25% und 33% je nach Gewaltform,<br />
erhöhte Ängste nannten zwischen 18% und 28%; erhöhte Krankheitsanfälligkeit,<br />
Antriebslosigkeit, Schwierigkeiten in Beziehungen und bei der Arbeit nannten<br />
beträchtliche Anteile. Zu den Folgen zählen auch Selbstmordgedanken (5% bis<br />
8%), Selbstverletzungen (2%-3%) und Ess-Störungen (7% bis 10%).<br />
Über die gesundheitliche Lage von Frauen, die aktuell in einer Gewaltsituation<br />
leben, gibt es wenig eigenständige deutsche Literatur. Erstmals im Modellprojekt<br />
S.I.G.N.A.L. zur Intervention bei Gewalt gegen Frauen (vgl. S. 71) wurden in einer<br />
Klinik systematisch Misshandlungsverletzungen erhoben. Ausländische Studien<br />
verweisen darauf, dass misshandelte Frauen besonders häufig zur medizinischen<br />
Versorgung abends oder am Wochenende erscheinen, in der Notaufnahme, mit Verletzungen<br />
am Kopf, im Gesicht, oder am Ober- oder Unterleib; sie ziehen sich aus<br />
sozialen Beziehungen zurück, haben z.B. starke Ängste ohne erkennbaren Anlass.<br />
Die Dokumentation des Berliner Modellprojekts zeichnet ein ähnliches Bild und<br />
unterstreicht zudem, dass zwei Drittel der Frauen Mehrfachverletzungen aufweisen<br />
(Hellbernd, Wieners 2002). In allen Studien, so stellt Campbell (2002) in ihrem<br />
Gesundheitliche<br />
Beschwerden bei Opfern<br />
Häuslicher Gewalt weitaus<br />
höher<br />
Körperliche Verletzungen<br />
Folgebeschwerden reichen<br />
noch viel weiter<br />
Modellprojekt S.I.G.N.A.L.<br />
9<br />
C11