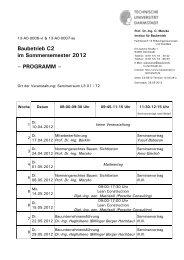Institutsbericht Institut für Baubetrieb 2007-2009
Institutsbericht Institut für Baubetrieb 2007-2009
Institutsbericht Institut für Baubetrieb 2007-2009
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
�����������������������<br />
������������<br />
��������������������������������������������������
Herausgeber:<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko<br />
Anschrift:<br />
Technische Universität Darmstadt<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
El-Lissitzky-Straße 1<br />
64287 Darmstadt<br />
Telefon +49 (0) 61 51 / 16 - 30 42<br />
Telefax +49 (0) 61 51 / 16 - 66 93<br />
sekretariat@baubetrieb.tu-darmstadt.de<br />
http://www.baubetrieb.tu-darmstadt.de<br />
ISBN 978-3-941925-03-8<br />
2<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
Inhalt<br />
1 Forschung ................................................................................................................. 10<br />
1.1 Abgeschlossene Promotionen ........................................................................................................ 10<br />
1.2 Ausgewählte Berichte zur Forschung – abgeschlossene und laufende Projekte .......................... 11<br />
1.3 Simulation in der Bauwirtschaft – Arbeitsgruppe Unikatprozesse ............................................... 55<br />
1.4 Preise und Auszeichnungen ............................................................................................................ 56<br />
1.4.1 GEFMA-Förderpreis 2008 – Auszeichnung <strong>für</strong> Dr.-Ing. Jörg Klingenberger .................................. 56<br />
1.4.2 Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ <strong>2009</strong> – Auszeichnung <strong>für</strong> Dr.-<br />
Ing. Jens Elsebach .......................................................................................................................... 57<br />
1.5 Kooperationen ................................................................................................................................. 58<br />
1.5.1 Summer School 2008 des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> und der Tongji University<br />
Shanghai ......................................................................................................................................... 58<br />
1.5.2 Kooperationsabkommen zwischen dem Research <strong>Institut</strong>e of Project Administration<br />
and Management der Tongji University Shanghai und dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> .................... 60<br />
1.5.3 Verleihung des Titels Advisory Professor der Tongji University Shanghai an Prof.<br />
Motzko ............................................................................................................................................. 61<br />
1.5.4 Kompetenzzentrum Bürgerhäuser ................................................................................................... 62<br />
2 Tagungen .................................................................................................................. 63<br />
2.1 22. Treffen der Universitätsprofessoren <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft und<br />
Bauverfahrenstechnik <strong>2007</strong> ............................................................................................................ 63<br />
2.2 19. Treffen der Universitätsassistenten der Bereiche <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft und<br />
Bauverfahrenstechnik 2008 ............................................................................................................ 64<br />
2.3 Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar ................................................................................................... 66<br />
2.4 GSV-TUD-Fachtagung 2008 „Gefährdungsbeurteilung in der Praxis“ ........................................... 66<br />
2.5 GSV-TUD-Fachtagung <strong>2009</strong> „Neue Normen im Bauwesen“ ......................................................... 68<br />
2.6 Kassel-Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar Schalungstechnik ......................................................... 69<br />
2.7 Graz-Darmstädter Intensivseminar Sichtbeton .............................................................................. 70<br />
2.8 Sonstige Veranstaltungen .............................................................................................................. 70<br />
2.8.1 Land der Ideen ................................................................................................................................. 70<br />
2.8.2 VDI Fachtagung „Verfahrenstechnik im Ingenieurbau“ ................................................................. 70<br />
2.8.3 Deutscher Bautechnik-Tag <strong>2009</strong> in Dresden .................................................................................. 71<br />
3 Lehre ......................................................................................................................... 72<br />
3.1 Lehrveranstaltungen des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> .......................................................................... 72<br />
3.2 Grundlagen des Planens, Entwerfens und Konstruierens .............................................................. 75<br />
3.3 Bachelor of Science Bauingenieurwesen und Geodäsie ............................................................... 76<br />
3.4 Master of Science Bauingenieurwesen ......................................................................................... 77<br />
3.5 Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen, technische Fachrichtung<br />
Bauingenieurwesen ........................................................................................................................ 77<br />
3.6 Master of Science Wirtschaftsingenieurwesen, technische Fachrichtung<br />
Bauingenieurwesen ........................................................................................................................ 78<br />
3.7 Workshop zur Übungsbearbeitung im <strong>Baubetrieb</strong> ......................................................................... 78<br />
3.8 Gastvorträge im Rahmen von Lehrveranstaltungen ....................................................................... 79<br />
3.9 Sonstige Veranstaltungen .............................................................................................................. 80<br />
3.9.1 Lehrgänge zur Arbeitssicherheit ..................................................................................................... 80<br />
3.9.2 Goldbeck Fallstudien ....................................................................................................................... 81<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 3
3.9.3 Exkursionen zum Kraftwerk Biblis ................................................................................................... 81<br />
3.9.4 Workshop mit Bilfinger Berger Hochbau in Frankfurt ..................................................................... 82<br />
3.9.5 Werksbesichtigungen von Peri in Weißenhorn .............................................................................. 82<br />
3.9.6 Exkursionen zum Justiz- und Verwaltungszentrum in Wiesbaden ................................................. 82<br />
3.9.7 Exkursion zum Mercedes Benz Museum Stuttgart ......................................................................... 82<br />
3.9.8 Exkursion zum Lufthansa Training & Conference Center in Seeheim ............................................ 83<br />
3.9.9 Fachtagung Sichtbeton: Planung, Gestaltung, Ausführung ............................................................ 83<br />
3.9.10 Workshop mit Peri in Darmstadt ..................................................................................................... 84<br />
3.10 Preise und Auszeichnungen ............................................................................................................. 84<br />
4 Publikationen ............................................................................................................. 85<br />
4.1 Dissertationen am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ...................................................................................... 85<br />
4.2 Bücher, Buchbeiträge, Artikel, publizierte Vorträge 2004-<strong>2009</strong> ..................................................... 90<br />
4.2.1 Bücher und Buchbeiträge ................................................................................................................ 90<br />
4.2.2 Schriftenreihe des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ..................................................................................... 90<br />
4.2.3 Fachartikel, publizierte Vorträge ..................................................................................................... 91<br />
4.2.4 Schriftenreihe GSV-TUD-Fachtagungen .......................................................................................... 97<br />
4.2.5 Schriftenreihe des Güteschutzverbandes Betonschalungen e.V. ................................................... 97<br />
4.3 Referate von Prof. Motzko ............................................................................................................... 98<br />
4.3.1 Dissertationen .................................................................................................................................. 98<br />
4.3.2 Habilitationsschriften ...................................................................................................................... 99<br />
4.4 Gutachten ......................................................................................................................................... 99<br />
5 Absolventen ............................................................................................................ 100<br />
5.1 Absolventen mit Abschlussarbeiten im Fach <strong>Baubetrieb</strong> sowie Absolventen des<br />
Hauptvertiefungsfachs <strong>Baubetrieb</strong> ................................................................................................ 100<br />
5.2 Studien- und Vertieferarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ...................................... 101<br />
5.3 Diplomarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ............................................................... 104<br />
5.4 Bachelorarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ............................................................ 106<br />
5.5 Masterarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ............................................................... 106<br />
6 Mandate.................................................................................................................. 108<br />
6.1 Mandate von Prof. Motzko innerhalb der Universität ................................................................... 108<br />
6.2 Mandate von Prof. Motzko außerhalb der Universität ................................................................. 108<br />
7 <strong>Institut</strong>sleben .......................................................................................................... 109<br />
7.1 2. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong> in München .................................................... 109<br />
7.2 3. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> 2008 in Hamburg .................................................... 109<br />
7.3 4. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2009</strong> im Kleinwalsertal .......................................... 110<br />
4<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
Editorial<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
verehrte Freunde unseres <strong>Institut</strong>s,<br />
mit Freude überreichen wir Ihnen den Bericht<br />
des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der<br />
Technischen Universität Darmstadt über<br />
den Zeitraum von <strong>2007</strong> bis <strong>2009</strong>. Dies<br />
umso mehr, da unser <strong>Institut</strong> zum Wintersemester<br />
<strong>2009</strong>/2010 das 30-jährige Bestehen<br />
feiert.<br />
Der Bericht kann nicht die 30 Jahre intensiven<br />
Forschens und Lehrens vollständig<br />
abbilden. Vielmehr ist es eine Impression<br />
über das Wirken einer generationenübergreifenden<br />
Gruppe von Wissenschaftlern<br />
und Lehrenden an der Technischen Universität<br />
Darmstadt, die einen Aufbruch der<br />
Disziplin <strong>Baubetrieb</strong> in immer neue Regionen<br />
darlegt und damit eine Multidisziplinarität<br />
begründet. In unserer Festschrift<br />
„<strong>Baubetrieb</strong>liche Aufgaben“ finden Sie<br />
hierzu weitere Berichte und Informationen.<br />
Die Jahre <strong>2007</strong> bis <strong>2009</strong> waren, wie die<br />
Jahre zuvor, ereignisreich und geprägt von<br />
einer engen und erfolgreichen Zusammenarbeit<br />
mit Industrie und Verwaltung.<br />
Durch diese Verbindungen wird der hohe<br />
Standard der theoretischen Ausbildung <strong>für</strong><br />
Bauingenieure und Wirtschaftsingenieure<br />
mit dem Schwerpunkt <strong>Baubetrieb</strong> durch<br />
frühzeitigen Kontakt der Studierenden mit<br />
der Praxis ergänzt. Analoges gilt <strong>für</strong> unse-<br />
re Forschung. Mit der Förderung der nachfolgend<br />
genannten Partner konnten wir<br />
Dissertationen, Studien-, Vertiefer- und<br />
Diplom- sowie Bachelor- und Masterarbeiten<br />
realisieren:<br />
• Arbeitsgemeinschaft industrieller<br />
Forschungsvereinigungen<br />
„Otto von Guericke e.V.“ (AiF),<br />
• Bilfinger Berger AG,<br />
• Bundesamt <strong>für</strong> Bauwesen<br />
und Raumordnung,<br />
• Deutscher Beton- und<br />
Bautechnikverein e.V.,<br />
• Energiewerke Nord GmbH,<br />
• Güteschutzverband<br />
Betonschalungen e.V.,<br />
• HOCHTIEF AG,<br />
• Kommserve gGmbH,<br />
• Kreis Offenbach,<br />
• Peri Polska Sp. z o.o.,<br />
• Stadt Seligenstadt,<br />
• Waibel KG,<br />
• Wayss & Freytag Ingenieurbau AG,<br />
• Xella Deutschland GmbH.<br />
Wir danken ganz herzlich unseren Partnern<br />
<strong>für</strong> die sehr gute Zusammenarbeit<br />
und das Vertrauen.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 5
Die Forschungsschwerpunkte des <strong>Institut</strong>s<br />
lagen im Berichtszeitraum in folgenden<br />
Bereichen:<br />
• Entwicklung digitaler Informationssysteme<br />
sowie Methoden der Bildverarbeitung<br />
<strong>für</strong> das Controlling, die Organisation,<br />
die Steuerung und die Simulation<br />
von Bauprozessen,<br />
• Zukunftsforschung zum Thema der<br />
Entwicklung von Bauunternehmen,<br />
• Bauen im Bestand mit dem Schwerpunkt<br />
im Rückbau von Kernkraftwerken,<br />
• Immobilienstrategien und Immobiliencontrolling<br />
der öffentlichen Hand einschließlich<br />
PPP,<br />
• Komplex der Qualitätssicherung mit<br />
den Schwerpunkten im Bereich des<br />
vorbeugenden baulichen Brandschutzes,<br />
• <strong>Baubetrieb</strong>liche Probleme der nationalen<br />
und internationalen Bauverträge,<br />
• Verfahrenstechnische Probleme mit<br />
dem Schwerpunkt im Bereich des<br />
Sichtbetons sowie des Stahlfaserbetons,<br />
• Planungsprozesse im Bereich von Infrastrukturprojekten.<br />
Unsere internationalen Aktivitäten wurden<br />
stetig ausgebaut. Im Berichtszeitraum<br />
wurde eine intensive Zusammenarbeit mit<br />
der Tongji University Shanghai durch ein<br />
Kooperationsabkommen, regelmäßige<br />
Summer-Schools und die Verleihung des<br />
Titels „Advisory Professor“ an meine Person<br />
begründet. Mit unseren Freunden von<br />
der Politechnika Warszawska realisieren<br />
wir ein großes EU-Projekt. Nach wie vor<br />
kooperieren wir stark mit der ETH Zürich<br />
sowie mit der TU Graz.<br />
Das Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar, das<br />
Kassel-Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar<br />
Schalungstechnik sowie die GSV-TUD-<br />
Fachtagungen runden die externen Aktivitäten<br />
des <strong>Institut</strong>s im jährlichen Rhythmus<br />
ab und belegen die Errungenschaften in<br />
Forschung und Praxis.<br />
Wir danken der Technischen Universität<br />
Darmstadt <strong>für</strong> die Schaffung von Randbedingungen,<br />
welche die Weiterentwicklung<br />
6<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
des <strong>Institut</strong>s garantieren. Trotzdem ist zu<br />
vermerken, dass die gegenwärtige Ausstattung<br />
mit einer Professur bei einer hohen<br />
Lehrbelastung und derzeit in Bearbeitung<br />
befindlichen 16 Promotionen am <strong>Institut</strong><br />
sowie weiteren 5 externen Promotionen<br />
die Grenze einer angemessenen<br />
Betreuung näher rückt, so dass in diesem<br />
Punkt eine Limitierung erkennbar wird.<br />
Die vielfältigen und zusätzlichen Aufgaben<br />
in der Lehre könnten nicht ohne die aktive<br />
Mitwirkung unserer Honorarprofessoren,<br />
Lehrbeauftragten und externen Referenten<br />
bewältigt werden. Durch diese Beiträge<br />
und den dabei stattfindenden intensiven<br />
Dialog wird die Aktualität der Lehre<br />
bereichert. Vielen Dank da<strong>für</strong>.<br />
Das 30-jährige Jubiläum ist Anlass, Herrn<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert <strong>für</strong><br />
den Aufbau des <strong>Institut</strong>s zu danken. Ferner<br />
danke ich den Akademischen Räten<br />
Herrn Dr.-Ing. Richard Schreiber (1979-<br />
2003), Herrn Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck<br />
(2004-2006, jetzt Professor an der TU<br />
Graz) sowie Herrn Dr.-Ing. Jörg Klingenberger<br />
<strong>für</strong> die ausgezeichnete Arbeit am<br />
<strong>Institut</strong>. Weiterhin danke ich Frau Valerie<br />
Gnielka und Frau Vera Spengler <strong>für</strong> die<br />
hervorragende Administration.<br />
Mein besonderer Dank gilt meinen jungen<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren<br />
Nachwuchswissenschaftlern, die mit<br />
höchstem Engagement ihre Aufgaben<br />
meistern.<br />
Mit dem vorliegenden Bericht erstatten<br />
wir Rechenschaft über die Arbeit des <strong>Institut</strong>s<br />
<strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der Technischen<br />
Universität Darmstadt <strong>für</strong> die Jahre <strong>2007</strong><br />
bis <strong>2009</strong>. Wir hoffen, eine Resonanz von<br />
Ihnen zu erfahren, danken <strong>für</strong> Ihr Vertrauen<br />
und laden Sie herzlich an unsere Universität<br />
ein.<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 7
8<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 9
1 Forschung<br />
1.1 Abgeschlossene Promotionen<br />
Im Berichtszeitraum (<strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>) wurden folgende Promotionen abgeschlossen:<br />
<strong>2007</strong> Klingenberger,<br />
Jörg<br />
<strong>2007</strong> Cichos,<br />
Christoph<br />
<strong>2007</strong> Fetzner,<br />
Torsten<br />
<strong>2007</strong> Elahwiesy,<br />
Ali Akbar<br />
<strong>2007</strong> Huppenbauer,<br />
Falk<br />
2008 Elsebach,<br />
Jens<br />
2008 Pflug,<br />
Christoph<br />
<strong>2009</strong> Demmler,<br />
Markus<br />
<strong>2009</strong> Maffini,<br />
Carola<br />
<strong>2009</strong> Hinrichs,<br />
Nils<br />
10<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von<br />
Gebäuden<br />
Untersuchungen zum zeitlichen Aufwand der<br />
Baustellenleitung<br />
Ein Verfahren zur Erfassung von Minderleistungen<br />
aufgrund witterungsbedingter Bauablaufstörungen<br />
Multiprojektmanagement <strong>für</strong> Infrastruktur-Bauprojekte<br />
Nachunternehmermanagement: Die Entwicklung<br />
eines prozessorientierten Entscheidungsmodells<br />
<strong>für</strong> die Beschaffung und das Controlling<br />
Bauwerksinformationsmodell mit vollsphärischen<br />
Fotografien – Ein Konzept zur visuellen<br />
Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen<br />
Ein Bildinformationssystem zur Unterstützung der<br />
Bauprozesssteuerung<br />
Risikomanagement im internationalen Tunnelbau unter<br />
Anwendung der Vertragsform FIDIC Red Book<br />
Konfliktbehandlung in Bauprojektorganisationen<br />
Strategien der öffentlichen Hand – Ein<br />
kompetenzorientierter Ansatz aus Sicht<br />
des Immobiliencontrollings
1.2 Ausgewählte Berichte zur Forschung – abgeschlossene<br />
und laufende Projekte<br />
• Dipl.-Ing. Matthias Bergmann<br />
Multiagentensimulation von Montageprozessen im Bauwesen<br />
• Dipl.-Ing. Erik Boska<br />
Prozessgestaltung bei Betonoberflächen<br />
mit erhöhten Anforderungen an das Aussehen<br />
• Dipl.-Ing. Felix Bothmann<br />
Technical Due Diligence – Berücksichtigung des Brandschutzes<br />
bei der Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
• Dr.-Ing. Christopher Cichos<br />
Untersuchungen über den Aufwand der Baustellenleitung<br />
auf der Baustelle – Ermittlung von Aufwandswerten <strong>für</strong><br />
ausgewählte Tätigkeiten der Bauleitung auf der Baustelle<br />
• Dr.-Ing. Jens Elsebach<br />
Bauwerksinformationsmodelle mit vollsphärischen<br />
Fotografien – Ein Konzept zur visuellen<br />
Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen<br />
• Dipl.-Ing. Ingo Giesa<br />
Kundenorientiertes Prozessmodell <strong>für</strong> den Lebenszyklus von Immobilien<br />
• Dr.-Ing. M.Sc. Nils Hinrichs<br />
Strategien der öffentlichen Hand – Ein kompetenzorientierter Ansatz<br />
aus Sicht des Immobiliencontrollings<br />
• Dr.-Ing. Falk Huppenbauer<br />
Nachunternehmermanagment<br />
• Dipl.-Ing. Mathias Jakob<br />
Stahlfaserbeton aus baubetrieblicher Sicht<br />
• Dr.-Ing. Jörg Klingenberger<br />
Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von Gebäuden<br />
• M.Sc. Svetlana Kometova<br />
Controllingaspekte langfristiger Projekte im Public Real Estate Management<br />
• Dipl.-Ing. Marcel Kremer<br />
Untersuchung von Standortfaktoren im Hinblick<br />
auf deren Einfluss auf baubetriebliche Aspekte<br />
• Dr.-Ing. Carola Maffini<br />
Möglichkeiten der Konfliktbehandlung durch die Bauvertragsparteien<br />
• Dipl.-Ing. Sebastian Maffini<br />
Leistungsfeststellung mittels Bildinformationssystemen<br />
• Dipl.-Ing. Oliver Mehr<br />
Polysensorale Bauprozessdetektion<br />
• Dipl.-Ing. Alexander Nolte<br />
Qualitätssicherung in der Schalungstechnik<br />
• Dipl.-Ing. Leif Pallmer<br />
Vorbeugender Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 11
• Dr.-Ing. Christoph Pflug<br />
Ein Bildinformationssystem zur Unterstützung der Bauprozesssteuerung<br />
• Dipl.-Ing. Markus Schäfer<br />
Optimierung von Planungsprozessen <strong>für</strong> Infrastrukturprojekte der DB AG<br />
• Dipl.-Ing. Julia Schömbs<br />
<strong>Baubetrieb</strong>liche Aspekte bei der Herstellung von Sichtbeton<br />
12<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
Dipl.-Ing. Matthias Bergmann<br />
Multiagentensimulation von Montageprozessen im Bauwesen<br />
Ausgangssituation<br />
Montageprozesse erfordern eine detaillierte<br />
Planung, um alle beteiligten Ressourcen<br />
optimal aufeinander abzustimmen. Bei<br />
Fertigteilen im Bauwesen ist vor allem die<br />
Verzahnung mit den Prozessen der Baulogistik<br />
von Bedeutung.<br />
Während in der stationären Industrie hierzu<br />
leistungsstarke Simulationssoftware<br />
zum Einsatz kommt, basiert die Arbeitsvorbereitung<br />
im Bauwesen noch weitgehend<br />
auf traditionellen Methoden.<br />
Hintergrund<br />
Beispielhaft wird im Rahmen der Forschung<br />
eine agentenbasierte Bauablaufsimulation<br />
<strong>für</strong> ein neuartiges modulares<br />
System zur energetischen Fassadenmodernisierung<br />
implementiert.<br />
Abb. 1: Transport eines Fassadenmoduls<br />
Ein Agent ist eine virtuelle Entität, die autonom<br />
ist, selbstbestimmt handelt und<br />
sich in einer Umwelt befindet, auf die sie<br />
reagiert.<br />
Abb. 2: Eigenschaften von Agenten<br />
Eine Multiagentensimulation (MAS) ist<br />
eine individuenbasierte Computersimulation,<br />
in der viele Agenten untereinander und<br />
mit einer simulierten Umwelt interagieren,<br />
um das Verhalten eines realen Multiagentensystems<br />
nachzubilden.<br />
Mit der Multiagentensimulation ist es<br />
möglich einen inhomogenen Raum, Interaktionen<br />
und Rückkopplungseffekte sowie<br />
eigenständiges Verhalten der Agenten<br />
darzustellen.<br />
Ziele<br />
Ziel der Forschung ist die detaillierte agentenorientierte<br />
Modellierung und Simulation<br />
des Prozesses der Montage eines modularen<br />
Fassadensystems. Insbesondere<br />
sollen die Kooperation und Kommunikation<br />
sowie Unterbrechungen und andere<br />
produktivitätshemmende Faktoren betrachtet<br />
werden. Zugleich wird die Einbindung<br />
zeitnaher Baustellendaten untersucht.<br />
Es werden folgende Resultate angestrebt:<br />
• Identifikation und Nutzung von<br />
Optimierungspotentialen<br />
• Integration von zeitnahen<br />
Baustelleninformationen<br />
• Realitätsnahe Abbildung von<br />
Leistungseinflussfaktoren<br />
Vorgehensweise<br />
Beim strukturierten Erstellen eines Modells<br />
der Prozesse beginnt man zunächst<br />
mit einer abstrakten Modellierung. Diese<br />
wird danach in ein ausführbares, reales<br />
Modell überführt, das als Grundlage <strong>für</strong><br />
die Simulation dient.<br />
Abb. 3: Modellbildung und Simulation<br />
Einen besonderen Stellenwert hat die Kalibrierung<br />
des Modells, um realitätsnahe<br />
Simulationsergebnisse zu erhalten.<br />
Die Integration arbeitswissenschaftlicher<br />
Techniken nach REFA ermöglicht die<br />
Übertragung erprobter baubetrieblicher<br />
Methoden und vorhandener Erkenntnisse.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 13
Zugleich wird angestrebt die Bauablaufprognosen<br />
mit Systemen der Sensorik auf<br />
der Baustelle zu verknüpfen, um Planbzw.<br />
Soll-Abläufe zeitnah mit Ist-<br />
Informationen abzugleichen und ggf.<br />
steuernd eingreifen zu können.<br />
Ergebnisse<br />
Die grundlegende Aufgabe bei der Erstellung<br />
des Multiagentenmodells zur Simulation<br />
des Bauablaufs besteht in der Identifikation<br />
der Agenten und der Beschreibung<br />
deren Verhaltens. Auf der Baustelle<br />
handelt es sich hierbei um die gewerblichen<br />
Arbeitskräfte sowie die im Einsatz<br />
befindlichen Baugeräte.<br />
Zur Beschreibung des Agentenverhaltens<br />
bieten sich auf der abstrakten Ebene<br />
UML-Aktivitätsdiagramme an, die Aktivitäten<br />
und deren Abfolge respektive Vorbedingungen<br />
anschaulich darstellen.<br />
14<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
START<br />
Modul & Monteur<br />
setzen<br />
Fassadenmodul<br />
aufnehmen<br />
Warten<br />
Anfahrt zum<br />
Montageort<br />
Abb. 4: Verhalten des Transport-Agenten<br />
Rückfahrt zur<br />
Anlieferstelle<br />
Fassadenmodul <strong>für</strong><br />
Befestigung halten<br />
Fassadenmodul an die<br />
Wand anheben<br />
Die Implementierung erfolgt im Rahmen<br />
dieser Arbeit mit dem an der Universität<br />
Würzburg entwickelten SeSAm (Shell for<br />
Simulated Agent Systems).<br />
Durch die detaillierte Darstellung der Arbeitsprozesse,<br />
das Vorhandensein von<br />
Kommunikationsstrukturen und die Formulierung<br />
gegenseitiger Abhängigkeiten<br />
ist es möglich die Auswirkung der verfügbaren<br />
Produktionsfaktoren auf den Baufortschritt<br />
nachzubilden und damit zu<br />
prognostizieren.<br />
Eine baubetriebliche Bewertung des Fassadensystems<br />
liefert schließlich einen<br />
Beitrag zur ganzheitlichen Einordnung des<br />
Systems im Marktumfeld.
Dipl.-Ing. Erik Boska<br />
Prozessgestaltung bei Betonoberflächen mit erhöhten Anforderungen<br />
an das Aussehen<br />
Ausgangssituation<br />
Die Renaissance von Betonoberflächen<br />
mit erhöhten Anforderungen an das Aussehen<br />
(Sichtbeton) in der Architektur des<br />
21. Jahrhunderts hat die Bauindustrie,<br />
insbesondere aufgrund der Forderung<br />
nach glatten und porenarmen Betonoberflächen<br />
mit einem einheitlichen Grauton,<br />
vor neue Herausforderungen gestellt.<br />
Seit der erneuten Verwendung von Sichtbeton<br />
als gestalterisches Element ist eine<br />
Entwicklung in der Bauverfahrenstechnik,<br />
der verwendeten Materialien sowie der<br />
Regelwerke im Zusammenhang der Sichtbetontechnologie<br />
festzustellen. Als zentrales<br />
Regelwerk zur Beschreibung und objektiven<br />
Beurteilung der Betonoberflächen<br />
in Deutschland ist das Merkblatt Sichtbeton<br />
des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins<br />
e.V. in der Fassung vom August<br />
2008 zu erwähnen.<br />
Trotz der technologischen Weiterentwicklung<br />
beispielsweise einer Schalungshaut,<br />
die keinen Trennmittelauftrag erfordert<br />
sowie der mittlerweile großen Fülle an<br />
Erfahrungswerten in den Bauunternehmen<br />
unterliegt das Ergebnis der Sichtbetonoberflächen<br />
großen Schwankungen.<br />
Dies ist u.a. auf die Vielzahl der Einflussfaktoren<br />
aus dem Herstellungsprozess<br />
zurückzuführen.<br />
Ziel<br />
Auf dem dargelegten Zusammenhang sind<br />
die Ziele der Forschungsarbeit begründet.<br />
Im Fokus stehen die Entwicklung eines<br />
Verfahrens zur Beurteilung des Alterungsprozesses<br />
der Schalungshaut einerseits<br />
und andererseits die Wechselwirkungen<br />
zwischen der Bauausführung und der Betonoberfläche.<br />
Im Schwerpunkt des Beurteilungsverfahrens<br />
der Schalungshaut liegen der reale<br />
Alterungsprozess der bisher untersuchten<br />
Schalungshauttypen auf Baustellen und<br />
die Ableitung von Simulationsprozessen<br />
<strong>für</strong> das Laboratorium.<br />
Zur Beurteilung der Baustelleneinflussgrößen<br />
des Herstellprozesses ist die Erarbeitung<br />
einer präzisen Prozessbeschreibung<br />
in Form einer Arbeitsanweisung angedacht.<br />
Die zu entwickelnde Arbeitsanweisung<br />
soll als Grundlage <strong>für</strong> die Gestaltung<br />
der Prozesse der Produktionsplanung<br />
(Arbeitsvorbereitung) und der Prozessgestaltung<br />
auf der Baustelle dienen.<br />
Weiterhin sollen die vorhandenen Erkenntnisse<br />
der Wechselwirkungen zwischen<br />
den verwendeten Materialien und<br />
der Qualität von Sichtbetonoberflächen<br />
vertieft werden. Insbesondere interessiert<br />
der Zusammenhang zwischen dem Einsatz<br />
von Selbstverdichtenden Betonen<br />
(SVB) und der Qualität von Sichtbetonoberflächen.<br />
Abb. 1: Sichtbetonbauteile mit SVB hergestellt<br />
Vorgehensweise<br />
Nach der Grundlagenermittlung und dem<br />
Eingliedern der augenblicklich vorhandenen<br />
Erkenntnisse aus der Forschung und<br />
Praxis setzt sich die Forschungsarbeit aus<br />
den folgenden Arbeitsschritten zusammen:<br />
• Baustellenuntersuchungen<br />
• Simulation des Alterungsprozesses der<br />
Schalungshaut<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 15
• Aufstellen der Qualitätssicherungselemente<br />
/ Arbeitsanweisungen<br />
Die Baustellenuntersuchungen erfolgen<br />
nach den Methoden der REFA-Lehre.<br />
Hierbei wird der Herstellungsprozess getrennt<br />
nach seinen Arbeitssystemen dokumentiert<br />
und analysiert. Die Baustelleneinflussgrößen<br />
sind zu quantifizieren und<br />
mit den bereits bekannten Größen zusammenzuführen.<br />
Zur Simulation des Alterungsprozesses<br />
der Schalungshaut wird, basierend auf den<br />
bisherigen Erkenntnissen zum mechani-<br />
16<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
schen Angriff im realen Baustellenbetrieb,<br />
eine Versuchsanordnung festgelegt, mit<br />
welcher bei der Entwicklung der Prüfprozedur<br />
der mechanische Angriff realitätsnah<br />
abgebildet wird.<br />
Die Forschungsarbeit wird innerhalb eines<br />
durch die Arbeitsgemeinschaft industrieller<br />
Forschungsvereinigungen „Otto von<br />
Guericke“ e.V. (AiF) geförderten Forschungsvorhabens<br />
durchgeführt.
Dipl.-Ing. Felix Bothmann<br />
Technical Due Diligence – Berücksichtigung des Brandschutzes bei<br />
der Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
Ausgangssituation<br />
Der Wert eines Bestandsgebäudes wird<br />
von zahlreichen Faktoren in unterschiedlichem<br />
Maße beeinflusst. Brandschutztechnische<br />
Aspekte werden bei der Wertermittlung<br />
– auch bei einer „Due Diligence“-Prüfung<br />
– erfahrungsgemäß nicht ausreichend<br />
berücksichtigt, obwohl brandschutztechnische<br />
Mängel zu merklichen<br />
Wertminderungen führen können. Insbesondere<br />
bei genehmigungspflichtigen Änderungen<br />
am Gebäude – einem Eingriff in<br />
die bauliche Substanz, einer Sanierung<br />
oder Nutzungsänderung – kann die mangelhafte<br />
brandschutztechnische Qualität<br />
des Gebäudes ein K.O.-Kriterium <strong>für</strong> das<br />
geplante Vorhaben sein.<br />
Da das Thema „Brandschutz“ aufgrund<br />
der gestiegenen Verantwortung <strong>für</strong> Eigentümer<br />
und Betreiber auch weiterhin eine<br />
große Bedeutung besitzt, erscheint es<br />
gerechtfertigt, zukünftig brandschutztechnische<br />
Aspekte bei der Wertermittlung<br />
von Bestandsgebäuden detailliert zu berücksichtigen.<br />
Die Ermittlung des Gebäudewertes<br />
und die Schätzung von Kosten<br />
zur Behebung brandschutztechnischer<br />
Mängel ergeben sich u.a. aufgrund folgender<br />
Motivationen:<br />
• Erfordernis der Instandhaltung und Instandsetzung<br />
gemäß Baurecht<br />
• Aufnahme des Immobilienportfoliowerts<br />
• Transaktion (Kauf/Verkauf)<br />
• Genehmigungspflichtige Veränderungen<br />
des Gebäudes infolge Eingriff in<br />
die bauliche Substanz, Sanierung, Nutzungserweiterung<br />
bzw. Veränderung<br />
des Gefahrenpotenzials (Nutzungsänderung,<br />
Brandlasterhöhung)<br />
Ziel<br />
Zur präzisen Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
soll ein datenbankbasiertes<br />
System entwickelt werden, mit dem<br />
sich brandschutztechnische Aspekte in<br />
bestehende Wertermittlungsverfahren<br />
integrieren lassen. Um finanzielle Risiken<br />
im Umgang mit Bestandsgebäuden zu<br />
minimieren, kann dieses bei der Strategiefindung<br />
<strong>für</strong> ein Gebäude (Sanierung, Nutzungsänderung,<br />
Transaktion) als wichtige<br />
Entscheidungshilfe dienen. Auf Basis von<br />
Untersuchungen der Brandschutzmängelsituation<br />
von Bestandsgebäuden und einer<br />
differenzierten Analyse mit Hinterlegung<br />
der Mangelbehebungskosten sollen nachvollziehbare<br />
Aussagen zur Kostentendenz<br />
bereits zu einem frühen Untersuchungszeitpunkt<br />
möglich sein. Mit fortschreitender<br />
brandschutztechnischer Untersuchungstiefe<br />
am Objekt verringert sich mit<br />
zunehmender Datenmenge die Spannweite<br />
der Kosten <strong>für</strong> potenzielle Brandschutzmaßnahmen<br />
stetig, so dass detaillierte<br />
Kostenangaben direkt nach der Begehung<br />
möglich werden. Das finanzielle<br />
Risiko <strong>für</strong> den potenziellen Bauherrn, Kaufinteressenten<br />
oder zukünftigen Gebäudebetreiber<br />
kann damit frühzeitig eingeschätzt<br />
werden. Letztendlich sollen die<br />
geschätzten Kosten dem Wert des Gebäudes<br />
gegenübergestellt werden, um<br />
zukünftig auch die sicherheits- und genehmigungsrelevantebrandschutztechnische<br />
Qualität in die Wertermittlung einfließen<br />
zu lassen.<br />
Vorgehensweise<br />
Im Rahmen der Forschungsarbeit wird<br />
zunächst untersucht, inwieweit Ansätze<br />
zur Einbeziehung brandschutztechnischer<br />
Qualitäten bei bestehenden Verfahren zur<br />
Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
vorhanden sind. Daraufhin wird an geregelten<br />
Sonderbauten einer Nutzungsart<br />
mit regelmäßigen Gebäudestrukturen –<br />
z.B. an Büro- und Verwaltungsgebäuden –<br />
untersucht, wie ein System zur Berücksichtigung<br />
der brandschutztechnischen<br />
Qualität aufzubauen und in bestehenden<br />
Wertermittlungsverfahren zu integrieren<br />
ist.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 17
Die Forschungsgrundlage bildet neben der<br />
quantitativen und qualitativen Untersuchung<br />
der brandschutztechnischen Qualität<br />
von Bestandsgebäuden eine durchzuführende<br />
detaillierte Analyse der Kosten,<br />
die bei der Behebung von Brandschutzmängeln<br />
entstehen. Hierbei liegt das Augenmerk<br />
auf besonders häufig auftretenden<br />
Mangelarten und solchen, deren Beseitigungsmaßnahmen<br />
sehr kostenintensiv<br />
sind. Diese Daten werden in einer Datenbank<br />
abgelegt. Über mobile Eingabegeräte,<br />
die bei der brandschutztechnischen<br />
Untersuchung weiterer Bestandsgebäude<br />
eingesetzt werden, können fortlaufend<br />
18<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Daten eingepflegt werden. Durch entsprechende<br />
Datenverknüpfungen sind<br />
zukünftig <strong>für</strong> Bestandsgebäude, <strong>für</strong> die ein<br />
Instandsetzungserfordernis oder ein Änderungswunsch<br />
besteht, nachvollziehbare<br />
Aussagen zur Kostentendenz <strong>für</strong> Brandschutzmaßnahmen<br />
zeitnah möglich.<br />
Die Einbeziehung weiterer Sonderbauten<br />
mit anderen Gebäudestrukturen und Nutzungsarten<br />
in das zu entwickelnde Bewertungssystem<br />
soll nach ersten Erfahrungen<br />
mit Büro- und Verwaltungsgebäuden geschehen.
Dr.-Ing. Christopher Cichos<br />
Untersuchungen über den Aufwand der Baustellenleitung auf der<br />
Baustelle – Ermittlung von Aufwandswerten <strong>für</strong> ausgewählte<br />
Tätigkeiten der Bauleitung auf der Baustelle<br />
Ausgangssituation<br />
In der heutigen Zeit, die geprägt ist von<br />
einer lang anhaltenden Rezession in der<br />
Bauwirtschaft, werden nicht nur immer<br />
anspruchsvollere Projekte und komplexere<br />
Techniken gefordert, sondern auch immer<br />
kürzere Ausführungszeiten, kurzum verschärfte<br />
Randbedingungen <strong>für</strong> das Bauen.<br />
Für die Baustellenleitung sind aus dieser<br />
Entwicklung die Belastungen neben beispielsweise<br />
der Verantwortung <strong>für</strong> einen<br />
sinnvollen Einsatz der Mitarbeiter, ein rationelles<br />
Arbeiten, eine Prüfung von Ausführungsunterlagen,<br />
eine nachvollziehbare<br />
Dokumentation enorm gestiegen. Besonders<br />
daraus leitet sich die Bedeutung der<br />
Kenntnis der tatsächlichen Aufwendungen<br />
der Bauleitung ab.<br />
Dies wird umso wesentlicher, als der zunächst<br />
geplante Bauablauf oftmals durch<br />
interne und externe Einflüsse gestört<br />
wird. Daraus entstehen zusätzliche Kosten,<br />
insbesondere Lohnkosten, die entweder<br />
die Baukosten <strong>für</strong> den Auftraggeber<br />
erhöhen, ohne dass das Objekt eine<br />
Aufwertung erfährt, oder das finanzielle<br />
Ergebnis des Auftragnehmers verschlechtern.<br />
Eine ursachengerechte Kostenverteilung<br />
gewinnt also zusätzliche Bedeutung.<br />
Hinzu kommt, dass heute oftmals die allgemeinen<br />
Geschäftskosten sowie die<br />
Baustellengemeinkosten auf ein Minimum<br />
reduziert werden müssen, um dem Preisdruck<br />
auf dem Markt standzuhalten und<br />
Aufträge zu erhalten. Damit ist sehr oft<br />
auch eine Unterbesetzung der Baustellenleitung<br />
verbunden. Dies hat zur Folge,<br />
dass die Baustellenleitung ihre Aufgaben<br />
nicht mehr mit aller <strong>für</strong> einen fehlerfreien<br />
Bauablauf gebotenen Aufmerksamkeit<br />
erfüllen kann. Hilfreich hier<strong>für</strong> sind verlässliche<br />
Anhaltswerte, aus denen sich die<br />
mögliche Gefährdung erkennen lässt.<br />
Mittlerweile sind <strong>für</strong> nahezu alle – auch<br />
kleinste – Teilarbeiten, die von gewerblichen<br />
Arbeitnehmern ausgeführt werden,<br />
Richtzeitwerte bekannt, die die Grundlage<br />
einer Kalkulation bilden. Diese Werte<br />
schwanken nur gering von Unternehmen<br />
zu Unternehmen. Die Leistungen der Baustellenleitung<br />
zur Organisation der Baustelle<br />
hingegen sind noch nicht hinreichend<br />
erfasst. Für die Ermittlung des zeitlichen<br />
Aufwands der Baustellenleitung ist<br />
daher eine detaillierte Untersuchung notwendig.<br />
Ziel<br />
Ziel der Dissertation ist es, die Teilleistungen<br />
der Baustellenleitung zu ermitteln,<br />
bewertet zu quantifizieren und nachvollziehbar<br />
darzustellen, die eine sichere Bewältigung<br />
des geschuldeten Bausolls ermöglichen.<br />
Vorgehensweise<br />
Zunächst müssen die Aufgaben der Baustellenleitung<br />
vor, während und nach der<br />
Bauphase detailliert erfasst und gegliedert<br />
werden. Naturgemäß wird dabei der größte<br />
Teil der Bauleitungsarbeiten während<br />
der Bauphase zu erbringen sein, der deshalb<br />
den Schwerpunkt der Untersuchung<br />
bildet. Die einzelnen Arbeitsschritte der<br />
Einzeltätigkeiten der Bauleitung werden in<br />
Prozessablaufketten dargestellt. Diese<br />
verdeutlichen, welche Arbeitsschritte andere<br />
wiederum nach sich ziehen bzw.<br />
ausschließen.<br />
Anhand einer umfangreichen persönlichmündlichen<br />
Befragung von Bauleitern<br />
werden durchschnittliche Aufwandswerte<br />
<strong>für</strong> die Bauleitungstätigkeiten ermittelt.<br />
Dazu werden die Bauleiter zu ihrem alltäglichen<br />
Arbeitsablauf auf der Baustelle ausführlich<br />
befragt. Anzugeben sind jeweils<br />
im Durchschnitt die zeitlichen Aufwendungen<br />
<strong>für</strong> die notwendigen Einzeltätig-<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 19
keiten der Bauleitung hauptsächlich während<br />
der Rohbauphase.<br />
Mit Hilfe einer anschließenden Analyse<br />
soll herausgefunden werden, welche Annahmen<br />
und Randbedingungen die Bauleiter<br />
ihren Aussagen wissentlich oder unwissentlich<br />
zugrunde gelegt haben, um<br />
sie treffend bewerten zu können. Starke<br />
Schwankungen der angegebenen Aufwandswerte<br />
können sich eventuell aus<br />
den unterschiedlichen Arbeitsgebieten der<br />
Bauleiter ergeben, wie z.B. der Tätigkeit in<br />
großen oder kleinen Unternehmen, <strong>für</strong><br />
Einfamilien- oder Hochhäuser.<br />
Daneben spielen auch persönliche Fähigkeiten<br />
eine Rolle, die stark von Bauleiter<br />
zu Bauleiter variieren können. Diese sind<br />
aber kaum gemeingültig zu erfassen. Sie<br />
liegen vielmehr innerhalb einer unvermeidlichen<br />
Bandbreite und charakterisieren<br />
20<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
letztlich die Qualifikation eines Unternehmens.<br />
Durch die abschließenden Beobachtungen<br />
von Bauleitungstätigkeiten werden die<br />
Zeitaufwendungen <strong>für</strong> Bauleitungsaufwendungen<br />
gemessen. Diese Zeitaufnahmen<br />
sollen die Ergebnisse aus der<br />
umfangreichen Befragung festigen. Beobachtet<br />
werden dabei Bauleiter vornehmlich<br />
während der Rohbauphase auf Baustellen.<br />
Aus der Bewertung der Ergebnisse folgen<br />
die gesuchten durchschnittlichen Aufwandswerte.<br />
Ebenso lassen sich auf dieser<br />
Basis die Ursachen der Streuung der<br />
Aufwandswerte genauer begründen. Darüber<br />
hinaus können letztlich auch sinnvolle<br />
Leistungsbilder <strong>für</strong> die täglichen, wöchentlichen<br />
und monatlichen Tätigkeiten<br />
der Bauleitung erstellt werden.
Dr.-Ing. Jens Elsebach<br />
Bauwerksinformationsmodelle mit vollsphärischen<br />
Fotografien – Ein Konzept zur visuellen Langzeitarchivierung<br />
von Bauwerksinformationen<br />
Einleitung<br />
Im gesamten Bauwerkslebenszyklus werden<br />
durch verschiedene Stellen Informationen<br />
erzeugt, die als aktuelle und verlässliche<br />
Grundlage der Ideenentwicklung, der<br />
Aufgabenausführung, der Planung und des<br />
Controllings von hohem Wert sein können.<br />
Grundlage eines effektiven und effizienten<br />
Gebäudemanagements sind die vorliegenden<br />
relevanten Bauwerksinformationen<br />
aus der Planungs- und Erstellungsphase.<br />
Obwohl eine direkte Übernahme<br />
aus den vorhergehenden Lebensphasen<br />
die einfachste und zugleich günstigste<br />
Variante zur Beschaffung relevanter Informationen<br />
darstellt, ist in der aktuellen<br />
Praxis, einhergehend mit einem nahezu<br />
kompletten Wechsel der Beteiligten, ein<br />
maßgeblicher Informationsverlust an den<br />
Übergängen der Lebenszyklusphasen<br />
festzustellen (Abb. 1).<br />
Abb. 1: Informationsverlust im Bauwerkslebenszyklus [1, 2]<br />
Ziel einer jeden Bauwerksdokumentation<br />
muss es daher sein, die relevanten Informationen<br />
ganzheitlich zu archivieren und<br />
dem Bedarf entsprechend zur Verfügung<br />
zu stellen. Informationsverluste sind zu<br />
vermeiden (Abb. 2).<br />
Derzeitige Dokumentationssysteme sind<br />
durch ihre aufgabenspezifische und proprietäre<br />
Ausrichtung meist ungeeignet,<br />
ganzheitlich und lebenszyklusübergreifend<br />
Bauwerksinformationen <strong>für</strong> eine breite<br />
Nutzerschicht nachvollziehbar darzustellen.<br />
Abb. 2: Verlustfreie Dokumentation in Raumbüchern [1, 2]<br />
Ziel<br />
Viele Informationen, wie beispielsweise<br />
der tatsächlich ausgeführte Verlauf von<br />
Versorgungsleitungen, die in der Bauphase<br />
als nicht dokumentationswürdig erachtet<br />
werden, können Jahre später bei einer<br />
Umbaumaßnahme von besonderer Bedeutung<br />
sein und müssen dann, oft unter<br />
sehr hohem Aufwand, nachträglich ermittelt<br />
werden.<br />
Geeignete Informationen im Lebenszyklus<br />
einer Immobilie zu identifizieren, diese<br />
aufzubereiten und in den folgenden Lebensphasen<br />
bereitzustellen kommt in der<br />
modernen Wissensgesellschaft eine stetig<br />
steigende Bedeutung zu. Das angestrebte<br />
Ziel der Arbeit ist die ganzheitliche Informationserfassung<br />
und Informationsdarstellung<br />
über den gesamten Bauwerkslebenszyklus<br />
in einem intuitiv zu bedienenden<br />
Bauwerksinformationsmodell. Die<br />
erzeugten und archivierten Bauwerksinformationen<br />
sollen durch eine geeignete<br />
visuelle Darstellung einer breiten Nutzerschicht<br />
zugänglich gemacht werden.<br />
Ergebnis<br />
Die Arbeit stellt einen praxisnahen Ansatz<br />
dar, das Produktwissen über das Bauwerk<br />
mit modernen IT-Werkzeugen in einer<br />
intuitiv verständlichen Struktur – als visualisiertes<br />
Raumbuch – im Sinne einer lebenszyklusübergreifendenLangzeitarchi-<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 21
vierung darzustellen. Neu an dem entwickelten<br />
Verfahren ist sowohl die Vorgehensweise<br />
bei der Erfassung als auch bei<br />
der Bereitstellung der Informationen. Vollsphärische<br />
Fotografien, in denen die gesamte<br />
Kameraumgebung in 360° horizontal<br />
und 180° vertikal allgemeinverständlich<br />
dokumentiert ist, werden als zentrale Nutzeroberfläche<br />
der entstehenden Bauwerksdokumentationen<br />
verwendet.<br />
In Form eines visualisierten Raumbuchs<br />
können die baubegleitend erstellten vollsphärischen<br />
Fotografien zu „virtuellen<br />
Abb. 4: Das raumbuchgestützte Dokumentationssystem<br />
Beliebige weiterführende Bauwerksinformationen<br />
wie Pläne, Berichte, Herstellerzulassungen,<br />
Protokolle usw. können in<br />
den vollsphärischen Fotografien direkt mit<br />
ihrem „Entstehungsort“ visuell verknüpft<br />
werden (Abb. 5).<br />
Mit den im Rahmen der Arbeit entwickelten<br />
Softwaresystemen „Raumbuchgestütztes<br />
Berichtswesen“ und „Raumbuchgestützter<br />
Leistungsviewer“ wird<br />
beispielhaft aufgezeigt, wie Bauwerksinformationen<br />
in aufgabenspezifischen Do-<br />
22<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Begehungen“ des Bauwerks zusammengefasst<br />
werden.<br />
Abb. 3: Vollsphärische Fotografien mit Scannerkamera<br />
kumentationssystemen der Bauphase<br />
ohne erhöhten Aufwand mit einem Raumbuchbezug<br />
versehen und einer Langzeitarchivierung<br />
zugeführt werden können.<br />
Nutzen<br />
Mit dem entwickelten und in der Praxis<br />
erprobten Verfahren ist es möglich, die<br />
verschiedenen Informationen der Planungs-<br />
und Bauphase <strong>für</strong> eine dritte Person<br />
jederzeit nachvollziehbar zu archivieren.<br />
Eine nach dem Verfahren baubegleitend<br />
erstellte visuelle Bestandsdokumen-
tation kann als eine ideale Informationsgrundlage<br />
<strong>für</strong> das folgende Gebäudemanagement<br />
dienen.<br />
Die Informationen der Planungs- und Bauphase<br />
können mit dem entwickelten Verfahren<br />
verlustfrei an die folgende Nutzungsphase<br />
weitergegeben werden.<br />
Abb. 5: Navigation im visualisierten Raumbuch<br />
Literatur<br />
[1] Mehlis: Analyse des Datenentstehungsprozesses<br />
und Entwicklung eines Entscheidungsmodells<br />
<strong>für</strong> eine wirtschaftliche Vorgehensweise<br />
bei der lebenszyklusorientierten Immobiliendatenerfassung<br />
und -pflege, Dissertation, Universität<br />
Leipzig 2005<br />
Die Voraussetzungen zur erfolgreichen<br />
visuellen Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen<br />
sind mit dem entwickelten<br />
Verfahren gegeben. Relevante<br />
Bauwerksinformationen werden <strong>für</strong> eine<br />
breite Nutzerschicht ergonomisch günstig<br />
und intuitiv – denn visuell – erfassbar dargestellt.<br />
[2] Elsebach: Bauwerksinformationsmodelle mit<br />
vollsphärischen Fotografien – Ein Konzept zur<br />
visuellen Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen,<br />
Dissertation, Technische Universität<br />
Darmstadt 2008<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 23
Dipl.-Ing. Ingo Giesa<br />
Kundenorientiertes Prozessmodell <strong>für</strong> den Lebenszyklus<br />
von Immobilien<br />
Ausgangssituation<br />
Seit den neunziger Jahren des vergangenen<br />
Jahrhunderts ist am deutschen Baumarkt<br />
ein immer stärkerer Trend zum Abbau<br />
eigener Kapazitäten bzw. zum Einkauf<br />
von Nachunternehmerleistungen festzustellen.<br />
So konnten sich bestimmte Geschäftsmodelle<br />
(z.B. Projektentwicklung)<br />
und Funktionen (z.B. Projektsteuerung)<br />
erst in diesem Zusammenhang am Markt<br />
etablieren.<br />
Dieser Trend ist auch in den vorgelagerten<br />
sowie nachgelagerten Prozessen im Lebenszyklus<br />
von Immobilien (z.B. kaufmännisches<br />
Gebäudemanagement) zu beobachten<br />
(Abb. 1).<br />
Abb. 1: Lebenszyklusphasen einer typischen Büroimmobilie<br />
Jeder Beteiligte am Lebenszyklus von<br />
Immobilien optimiert im Zuge des kostengetriebenen<br />
Prozessmanagements zuallererst<br />
seine eigene Leistung. Weiterhin<br />
werden in komplexen Projektstrukturen an<br />
den Schnittstellen vor allem eigene Ziele<br />
verfolgt, so dass eine ganzheitliche Optimierung<br />
der Lebenszykluskosten nur sehr<br />
selten gelingt.<br />
In der jüngeren Vergangenheit haben vor<br />
allem drei Entwicklungen dazu beigetragen,<br />
dass die ganzheitliche Betrachtung<br />
der Lebenszykluskosten am deutschen<br />
Baumarkt stetig an Bedeutung gewinnt:<br />
• zunehmende Verbreitung von PPP-<br />
Projekten seit 2003,<br />
24<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
• enorm gestiegene Energiekosten bis<br />
Sommer 2008,<br />
• Etablierung von Zertifizierungsstandards<br />
<strong>für</strong> nachhaltiges Bauen seit <strong>2007</strong>.<br />
Ziele der Arbeit<br />
Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen<br />
dieser Forschungsarbeit die folgenden<br />
Ziele verfolgt:<br />
• Erarbeitung eines Prozessmodells <strong>für</strong><br />
den gesamten Lebenszyklus von Immobilien,<br />
mit dem besonderen Fokus<br />
auf die frühen Projektphasen und die<br />
Interaktion zwischen Kunden und Bauunternehmen.<br />
• Entwicklung von Kundenprofilen vor<br />
dem Hintergrund der jeweiligen Investitionsziele<br />
und der zeitlichen Investitionshorizonte.<br />
• Erarbeitung der unterschiedlichen Kundenanforderungen<br />
hinsichtlich der Teilprozesse<br />
in der Planungs- und Ausführungsphase.<br />
• Kundenorientierte Gestaltung der maßgebenden<br />
Funktionen in Bezug auf<br />
Kompetenzen und Qualifikationen.<br />
Vorgehensweise<br />
Nach einer umfassenden Schwachstellenanalyse<br />
der aktuellen Projektbearbeitung<br />
in verschiedenen Abwicklungsformen verfolgt<br />
diese Forschungsarbeit einen iterativen<br />
Ansatz (Abb. 2).<br />
1. Grundlegende theoretische Modellierung<br />
des kundenorientierten Prozessmodells.<br />
2. Empirische Studien mittels semistrukturierter<br />
Interviews in verwandten<br />
Branchen sowie bei verschiedenen Akteuren<br />
in der Bau- und Immobilienwirtschaft<br />
zur Anreicherung und Validierung<br />
der zuvor entwickelten Prozesselemente.<br />
3. Kontinuierliche Weiterentwicklung des<br />
Prozessmodells und Viabilitätstests in<br />
einem großen deutschen Baukonzern.
Abb. 2: Iterativer Forschungsansatz<br />
Aktuelle Ergebnisse<br />
In drei empirischen Studien, die zeitlich<br />
und inhaltlich miteinander verknüpft sind,<br />
konnten bisher mehr als 60 Interviews mit<br />
Fach- und Führungskräften aus der Bauund<br />
Immobilienwirtschaft, dem Großanlagenbau<br />
sowie der chemischen und pharmazeutischen<br />
Industrie geführt werden.<br />
Die Studie in der Bauindustrie lieferte<br />
wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich der<br />
Schwachstellen in der gegenwärtigen Projektbearbeitung.<br />
Darauf aufbauend konnte eine gezielte<br />
Befragung von Führungskräften im Großanlagenbau<br />
durchgeführt werden, bei der<br />
Vertreter von Kunden und von Kontraktoren<br />
involviert waren. Auf diese Art und<br />
Weise konnten vielfältige Anregungen zur<br />
Gestaltung des kundenorientierten Prozessmodells<br />
generiert werden.<br />
Parallel zur Ausgestaltung dieses Prozessmodells<br />
findet aktuell eine permanente<br />
Überprüfung der Erkenntnisse mittels<br />
einer Befragung von Unternehmen, die im<br />
Lebenszyklus von Immobilien tätig sind,<br />
statt. Dieser universelle Ansatz, bei dem<br />
u.a. die Sichtweisen von Projektentwicklern,<br />
Planern, Investoren, Projektsteuerern,<br />
Bauunternehmen und Facility Managern<br />
integriert werden, bietet die Möglichkeit<br />
zur Gestaltung von umfassend<br />
nachhaltigen Prozessen.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 25
Dr.-Ing. M.Sc. Nils Hinrichs<br />
Strategien der öffentlichen Hand – Ein kompetenzorientierter Ansatz<br />
aus Sicht des Immobiliencontrollings<br />
Ausgangssituation<br />
Die öffentliche Hand ist einer der größten<br />
Immobilieneigentümer des Landes, ihr<br />
Immobilienportfolio setzt sich aus unterschiedlichen<br />
Liegenschaften zusammen.<br />
Die hiermit verbundenen immobilienbezogenen<br />
Kosten stellen den drittgrößten<br />
Ausgabenblock der öffentlichen Hand dar.<br />
Die Finanznot der Kommunen bewirkt,<br />
dass dringend benötigte Investitionen und<br />
Maßnahmen im Bereich der öffentlichen<br />
Immobilien nicht realisiert werden können.<br />
Dies hat zur Folge, dass die ordnungsgemäße<br />
Erfüllung der kommunalen Aufgaben<br />
– zumindest in Teilen – gefährdet ist.<br />
Die kommunalen Immobilien haben einen<br />
potenziell großen Hebel in Bezug auf eine<br />
Verbesserung der finanziellen Situation<br />
der öffentlichen Hand. Oftmals fehlt es<br />
jedoch an einer strategischen Ausrichtung<br />
des kommunalen Immobilienbestandes, ja<br />
der öffentlichen Hand im Allgemeinen.<br />
Dies lässt sich u.a. auf fehlende Transparenz,<br />
sprich mangelndes Controlling, im<br />
Immobilienmanagement zurückführen. So<br />
ist die Informationsversorgung, aber auch<br />
die Informationsverarbeitung, d.h. das<br />
finanzielle Rechnungswesen und insbesondere<br />
aber das betriebliche Rechnungswesen,<br />
vielerorts unterentwickelt.<br />
Ziel der Arbeit<br />
Es sollte ein Beitrag zur Formulierung von<br />
Strategien <strong>für</strong> die öffentliche Hand und<br />
ihre Immobilien erarbeitet werden.<br />
Hier<strong>für</strong> war zu prüfen, ob entsprechende<br />
Ansätze <strong>für</strong> die öffentliche Hand bereits<br />
formuliert sind und welchen Beitrag diese<br />
ggf. leisten. Soweit notwendig sollte ein<br />
Ansatz aus der Betriebswirtschaftslehre<br />
auf den Bereich der öffentlichen Hand<br />
übertragen werden. Hierbei sind die sich<br />
aus der kommunalen Aufgabenerfüllung<br />
und den Immobilien ergebenden Übertragungskriterien<br />
zu berücksichtigen.<br />
26<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Im Ergebnis sollte eine Methodik entwickelt<br />
werden, die einen inhaltlichen Erklärungsbeitrag<br />
in Bezug auf die strategische<br />
Ausrichtung der Kommune und ihrer Immobilien<br />
liefern kann.<br />
Als Voraussetzung hier<strong>für</strong> war die Frage zu<br />
beantworten, worauf solche Strategien zu<br />
gründen seien. Ein wichtiges Element<br />
stellen hier die Ziele und Inhalte der kommunalen<br />
Aufgabenerfüllung dar, da sich in<br />
der kommunalen Aufgabe letztlich der<br />
kommunale Immobilienbedarf begründet.<br />
Daher war es ein voraus zu stellendes<br />
Ziel, zunächst die Inhalte der kommunalen<br />
Aufgabenerfüllung genau zu erarbeiten.<br />
Um Strategien quantitativ ausreichend<br />
belegen zu können, ist es zudem wichtig,<br />
dass das kommunale Immobiliencontrolling<br />
weiter ausgebaut wird und es so zu<br />
mehr Transparenz im kommunalen Immobilienmanagement<br />
kommt. Daher sollten<br />
ausgewählte Aspekte des kommunalen<br />
Immobiliencontrollings vertieft diskutiert<br />
werden. In diesem Bereich hat sich insbesondere<br />
auch der praktische Teil der Forschungsarbeit<br />
angesiedelt. So war im<br />
Rahmen einer Beratung der öffentlichen<br />
Hand durch eine praktische Übertragung<br />
an einem konkreten Immobilientyp nachzuweisen,<br />
dass die Prozesskostenrechnung<br />
auf die Immobilien der öffentlichen<br />
Hand sinnvoll Anwendung finden kann.<br />
Forschungsmethodik<br />
In Bezug auf die Forschungsmethodik<br />
wurde u.a. ein modernes Verfahren der<br />
Gemeinkostenumlage, die Prozesskostenrechnung,<br />
aus der Betriebswirtschaftslehre<br />
auf die öffentliche Hand übertragen und<br />
am Beispiel der Immobilie Bürgerhaus<br />
angewandt. Ferner wurde mittels einer<br />
empirischen Vorgehensweise eine Analyse<br />
der Informationsversorgung bei der<br />
öffentlichen Hand durchgeführt. Zur Anwendung<br />
kam hier u.a. das Expertengespräch.<br />
Schließlich wurde der kompetenz-
orientierte Strategieansatz in Bezug auf<br />
die öffentliche Hand diskutiert und übertragen.<br />
Ergebnisse<br />
Es konnte der Zusammenhang zwischen<br />
kommunaler Immobilie und Aufgabenerfüllung<br />
unter Bezugnahme des Begriffs<br />
der kommunalen Einrichtung dargestellt<br />
werden.<br />
Aus Sicht des kommunalen Immobiliencontrollings<br />
konnten zwei wichtige Erkenntnisbeiträge<br />
erarbeitet werden.<br />
(1) Informationsversorgung: In Kooperation<br />
mit einer Kommune mittlerer Größe<br />
konnte die bestehende kommunale Informationsversorgung<br />
unter Zuhilfenahme<br />
von Expertengesprächen analysiert und<br />
Handlungsempfehlungen gegeben werden.<br />
Die hierbei entwickelte Methodik<br />
kann zukünftig bei anderen Einrichtungen<br />
der öffentlichen Hand zur Analyse und<br />
Optimierung der Informationsversorgung<br />
angewendet werden.<br />
(2) Informationsverarbeitung: Die aus der<br />
stationären Industrie stammende Prozesskostenrechnung<br />
konnte in einer Forschungskooperation<br />
beispielhaft am Immobilientyp<br />
Bürgerhaus angewendet werden.<br />
Hiermit wurde der Nachweis der<br />
Anwendbarkeit dieser Methodik in Bezug<br />
auf die öffentliche Verwaltung geführt. Die<br />
Prozesskostenrechnung ermöglicht es<br />
dabei, <strong>für</strong> bisher nicht anzutreffende<br />
Transparenz bei den Kosten und Erlösen<br />
zu sorgen. Kostenverursacher lassen sich<br />
genau identifizieren, externe oder interne<br />
Verrechnungssätze können entsprechend<br />
der zugrunde liegenden Kosten genau<br />
festgelegt werden. Somit leistet die Prozesskostenrechnung<br />
einen Beitrag zu einer<br />
gerechteren Verwendung der von der<br />
Kommune verwalteten finanziellen Mittel.<br />
Darüber hinaus kann die Prozesskostenrechnung<br />
die kommunalen Führungsgremien<br />
bei einer genaueren kostenbasierten<br />
Budgetierung unterstützen.<br />
Im Rahmen der Entwicklung und Übertragung<br />
eines kompetenzbasierten Strategieansatzes<br />
auf die öffentliche Hand wurden<br />
die bestehenden strategischen Ansätze<br />
aus dem Bereich öffentlicher Hand einer<br />
kritischen Diskussion unterzogen. Da<br />
im Besonderen festzustellen war, dass es<br />
an konkreten Methoden zu einer Identifikation<br />
kommunaler Erfolgspotenziale und<br />
Verfahren zu deren Konkretisierung in<br />
Form von Erfolgsfaktoren mangelt, wurde<br />
aus den in der Betriebswirtschaftlehre<br />
anzutreffenden Ansätzen ein kompetenzorientierter<br />
Ansatz gewählt. Als wichtige<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> eine erfolgreiche Übertragung<br />
galt es dabei, den Betrachtungsraum<br />
vom kommunalen Immobilienmanagement<br />
auf die gesamte Kommunalverwaltung<br />
zu erweitern. Somit wurde der<br />
vorgeschlagene, kompetenzorientierte<br />
Strategieansatz in Bezug auf seine Eignung<br />
<strong>für</strong> die gesamte öffentliche Hand<br />
diskutiert. Schließlich konnte er auf den<br />
Bereich der öffentlichen Verwaltung übertragen<br />
und in das bestehende Konzept der<br />
KGSt integriert werden.<br />
Unter Zuhilfenahme der vorgestellten Methodik<br />
der Informationsversorgung mittels<br />
Experteninterviews lassen sich dabei die<br />
in der Kommune zur Aufgabenerfüllung<br />
anzutreffenden, notwendigen Kompetenzen<br />
identifizieren. Bei der Bewertung dieser<br />
kommunalen Kompetenzen wird anstelle<br />
der sonst im kompetenzorientierten<br />
Ansatz üblicherweise herangezogenen<br />
Vergleichsgröße der „Marktattraktivität“<br />
die „Aufgabenrelevanz“ als Vergleichsgröße<br />
etabliert und entwickelt. Damit ist<br />
ein Verfahren vorgestellt worden, das es<br />
der öffentlichen Hand ermöglicht, kommunale<br />
Kompetenzen zu identifizieren und<br />
anhand des durch sie geleisteten Beitrags<br />
zur Aufgabenerfüllung zu bewerten.<br />
Der kompetenzorientierte Ansatz betont<br />
dabei die internen, in der Kommune vorhandenen<br />
Fähigkeiten und Ressourcen<br />
sowie die in Eigenleistung erfüllbaren<br />
kommunalen Aufgaben. Die Kompetenzen<br />
der öffentlichen Verwaltung sind somit als<br />
wertsteigernde Faktoren anzusehen. Daher<br />
kann zukünftig und zumindest auf theoretischer<br />
Ebene in Bezug auf die Außendarstellung<br />
der Kommune ebenfalls diskutiert<br />
werden, ob ein Goodwill in der kommunalen<br />
Bilanz anzusetzen ist, der die in<br />
der Kommune vorhandenen Kompetenzen<br />
sowie Informations- und Wissensbestände<br />
monetär erfasst und bewertet.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 27
Dr.-Ing. Falk Huppenbauer<br />
Nachunternehmermanagement<br />
Ausgangssituation<br />
Der zunehmende europäische Wettbewerb,<br />
die steigende Nachfrage nach<br />
Dienstleistungen aber auch die Vernichtung<br />
der eigenen handwerklichen Kompetenz<br />
durch den Einsatz billiger Fremdarbeitskolonnen<br />
bzw. Nachunternehmer<br />
stellt Bauunternehmen vor wichtige Herausforderungen.<br />
Davon ist insbesondere<br />
der Leistungserstellungsprozess der Bauwirtschaft<br />
betroffen, denn dieser ist i.d.R.<br />
mit einem umfangreichen Einsatz von<br />
Nachunternehmern verbunden.<br />
Die gegenwärtige Situation und die Entwicklungstendenzen<br />
gestalten sich wie<br />
folgt:<br />
• Internationalisierung des Wettbewerbs,<br />
• Zunahme von Komplettleistungen,<br />
• zunehmende Komplexität der Projekte,<br />
• Konzentration auf Kernkompetenz bzw.<br />
Spezialisierung,<br />
• Zunahme von Dienstleistungen,<br />
• schwache Ertragslage der Unternehmen<br />
(Rendite),<br />
• Konsolidierung der Baubranche, u.a.<br />
durch zahlreiche Insolvenzen.<br />
Die durch diese Tendenzen verursachten<br />
Probleme wurden u.a. dadurch verstärkt,<br />
dass viele Entscheidungsträger in der<br />
Bauwirtschaft jahrzehntelang der Ansicht<br />
waren, dass keine Notwendigkeit bestünde,<br />
sich mit Unternehmensplanung, Strategie<br />
oder verursachungsgerechter Kalkulation<br />
zu beschäftigen.<br />
Die Bereitschaft sich mit solchen Themen<br />
auseinanderzusetzen hat in den letzten<br />
Jahren zugenommen. Man erkannte, dass<br />
entsprechende Strategien zu entwickeln<br />
sind und dass nur anpassungsfähige, innovative<br />
Unternehmen in der Lage sind,<br />
ihre verlorene Wettbewerbsfähigkeit<br />
rechtzeitig und nachhaltig wiederzugewinnen<br />
und dass nur die Unternehmen am<br />
Markt bestehen, welche sich durch individuelle<br />
Vorgehensweisen am besten an die<br />
sich ändernden Rahmenbedingungen an-<br />
28<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
passen können. Aufgrund der oft schlechten<br />
wirtschaftlichen Situation waren viele<br />
Unternehmen nicht in der Lage der hohen<br />
Umweltdynamik mit entsprechenden<br />
Maßnahmen zu begegnen und ihre Strategie<br />
bzw. ihre Prozesse an die neuen<br />
Herausforderungen anzupassen. Wirth [1]<br />
weist darauf hin, dass Unternehmen, die<br />
sich nicht schnell genug auf die veränderten<br />
Marktverhältnisse einstellen, vom<br />
Markt verschwinden werden. Dies belegt<br />
u.a. auch die hohe Zahl von Insolvenzen<br />
bzw. der Niedergang zahlreicher namhafter<br />
Bauunternehmen. Durch den Wandel<br />
hat sich auch die Struktur der Unternehmen<br />
geändert. Unternehmen, welche sich<br />
geschickt an die Bedingungen anpassen<br />
konnten, können heute gestärkt aus dieser<br />
Krise die zukünftigen Herausforderungen<br />
annehmen.<br />
Die oben genannten Entwicklungstendenzen<br />
haben u.a. auch zu der Entwicklung<br />
des schlüsselfertigen Bauens beigetragen.<br />
Bei der mit dem schlüsselfertigen Bauen<br />
verbundenen Generalunternehmereinsatzform<br />
übernimmt der Auftragnehmer neben<br />
der Kosten-, Termin-, Qualitätsgarantie<br />
auch die Verantwortung <strong>für</strong> die Funktionalität<br />
des Objektes. Verbunden ist diese<br />
Einsatzform mit der Übernahme erhöhter<br />
Risiken <strong>für</strong> den Generalunternehmer. Die<br />
Risiken resultieren einerseits aus der<br />
Marktausrichtung „Schlüsselfertiges Bauen“<br />
und andererseits aus der Übernahme<br />
von Garantien.<br />
Die Entwicklung der Generalunternehmereinsatzform<br />
führt bei Bauunternehmen<br />
meistens zu einer Verringerung ihrer<br />
Wertschöpfungstiefe. Durch den mit der<br />
Generalunternehmereinsatzform verbundenen<br />
Trend zum Outsourcing von Leistungen<br />
stieg auch der Anteil an Nachunternehmerleistungen<br />
kontinuierlich an.<br />
Die mit der Bauwirtschaft verbundene<br />
Auftrags- und Einzelfertigung stellt die<br />
Unternehmen vor große Herausforderun-
gen. So wechseln die Rahmenbedingungen<br />
von Projekt zu Projekt, wie beispielsweise<br />
der Ort, das zu erstellende Objekt<br />
oder die Zusammensetzung der Beteiligten.<br />
Durch den unmittelbaren Einfluss des<br />
Kunden, der in umfassender Weise über<br />
die Verwendung der Produktionsfaktoren<br />
und über die produktrelevanten Parameter,<br />
wie Termine, zu verwendende Materialen<br />
und Produktionsverfahren entscheidet,<br />
haben die Unternehmen der Braubranche<br />
oftmals nur geringen Einfluss auf<br />
den Bauprozess. Durch die notwendige<br />
Einzelfertigung ist eine Wiederholbarkeit<br />
von Arbeitsvorgängen bzw. eine Standardisierung<br />
nur in vergleichsweise geringem<br />
Umfang gegeben. Auf den Einsatz industrieller<br />
und standardisierter Produktionsverfahren<br />
muss bis auf die Fertigung bestimmter<br />
Einzelelemente weitgehend verzichtet<br />
werden. [2]<br />
Um mehr Einfluss auf die produktrelevanten<br />
Parameter zu gewinnen, versuchen<br />
viele Unternehmen frühzeitiger auf den<br />
Projektverlauf einzuwirken. Dies gelingt<br />
u.a. indem sie bereits in frühen Projektphasen<br />
Ihre Erfahrungen den potenziellen<br />
Kunden anbieten oder mit neuen Vertragsmodellen<br />
bzw. Vertragsformen verstärkten<br />
Einfluss auf die Ausgestaltung<br />
der Projekte gewinnen.<br />
Durch den Trend der Unternehmen zur<br />
Ausführung immer komplexerer Leistungen<br />
mit höheren terminlichen und qualitativen<br />
Anforderungen sowie der stärkeren<br />
Integration von Nachunternehmern in den<br />
Leistungserstellungsprozess steigt auch<br />
der Bedarf nach geeigneten Nachunternehmern.<br />
Diese zu identifizieren, auszuwählen,<br />
in den Leistungserstellungsprozess<br />
zu integrieren und deren Leistung zu<br />
kontrollieren, stellt eine besonders anspruchsvolle<br />
Aufgabe dar.<br />
In diesem Kontext ist auch zu beachten,<br />
dass oft die Verhältnisse zwischen den<br />
Vertragspartnern konfliktbelastet sind und<br />
teilweise beide Seiten konträre Ziele verfolgen<br />
und somit die Projektziele oft nicht<br />
auf allen Seiten wunschgemäß erfüllt<br />
werden können.<br />
Aus der Sicht des Generalunternehmers<br />
ist es deshalb notwendig, geeignete Strategien<br />
und Konzepte zu entwickeln, die es<br />
ihm ermöglichen, die zu vergebenden<br />
Leistungen über den gesamten Prozess<br />
mit den notwendigen Hilfsmitteln zu begleiten.<br />
Denn nur durch geeignete baubetriebliche<br />
Konzeptionen, welche die besonderen<br />
Bedürfnisse der Unternehmen<br />
berücksichtigen, können die vielfältigen<br />
Herausforderungen bewältigt werden.<br />
Diese Prozesse dem Zufall zu überlassen<br />
führt nicht zum erwünschten Ziel. Aus<br />
diesem Grund sollte möglichst umgehend<br />
mit der Gestaltung geeigneter Maßnahmen<br />
begonnen werden.<br />
Ziel<br />
Wie aus Ausgangssituation abzuleiten ist,<br />
erfordern die dargestellten Entwicklungstendenzen<br />
eine Anpassung bzw. eine Änderung<br />
in der Strategie der Unternehmen.<br />
Der Trend zur Generalunternehmerstruktur,<br />
der sich in Zukunft vermutlich noch<br />
verstärken wird, ist mit einer zunehmenden<br />
Zahl interner Schnittstellen verbunden.<br />
Die Bewältigung dieser Schnittstellen<br />
ist eine komplexe Aufgabe <strong>für</strong> den Generalunternehmer,<br />
da er mit Unternehmen<br />
und Gewerken zu tun hat, die er selbst<br />
nicht ausführen will oder kann, diese aber<br />
trotzdem gegenüber dem Bauherren verantworten<br />
muss. Für eine bessere Bewältigung<br />
dieser Schnittstellen benötigt der<br />
Generalunternehmer funktionierende<br />
Controllingkonzepte.<br />
Dabei muss das Controlling auf die Gegebenheiten<br />
der jeweiligen Branchen und<br />
Unternehmen abgestimmt sein. Aus diesem<br />
Grund können i.d.R. bestehende<br />
Konzeptionen nicht einfach von einem<br />
Unternehmen auf das andere übertragen<br />
werden. Die Umsetzung erfordert Strukturentwürfe,<br />
die auf die spezifischen<br />
Rahmenbedingungen bzw. Bedürfnisse<br />
der Betriebe zugeschnitten sind. [3]<br />
Für Unternehmen mit Massen, Sorten-<br />
und Großfertigung existieren sowohl in<br />
der betriebswirtschaftlichen Literatur als<br />
auch in der Praxis Strategien und zahlreiche<br />
differenzierte Systeme <strong>für</strong> die ganzheitliche<br />
Unternehmensführung, <strong>für</strong> teilbetriebliche<br />
Prozesse sowie das entsprechende<br />
Controlling. Für Unternehmen mit<br />
vorwiegender Projektleistung finden sich<br />
hingegen nur partielle Ansätze, bei denen<br />
zudem organisatorische und ablauftechni-<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 29
sche Probleme im Zusammenhang mit der<br />
Abwicklung eines einzelnen Auftrages im<br />
Vordergrund stehen. [3]<br />
Oft sind <strong>für</strong> den Bereich Controlling weder<br />
strategische Ansätze noch Modelle zur<br />
Umsetzung vorhanden. Dies kann u.a. auf<br />
folgende Defizite zurückgeführt werden:<br />
• Fehlende Strukturierung der Bauprozesse,<br />
• sich ständig ändernde Anforderungen,<br />
• nicht vorhandenes Know-how der Mitarbeiter,<br />
• fehlende Bereitschaft zur Einarbeitung<br />
in die Problematik.<br />
Das Fehlen geeigneter Ansätze ist auch in<br />
der Baubranche zu erkennen. Dabei sind<br />
insbesondere bei der Generalunternehmerstruktur<br />
zur Planung, Kontrolle und<br />
Steuerung der Nachunternehmerleistungen<br />
geeignete Strategien und Konzepte<br />
notwendig.<br />
Die vorliegende Forschungstätigkeit soll<br />
einen Beitrag zur Behebung dieses Defizits<br />
beim Nachunternehmermanagement<br />
und dabei insbesondere beim Projektcontrolling<br />
darstellen. In diesem Zusammenhang<br />
müssen zuerst aus dem Blickwinkel<br />
30<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
der Forschung theoretische Überlegungen<br />
erfolgen. Diese werden im nächsten<br />
Schritt auf ihre praktische Anwendbarkeit<br />
hin überprüft. Als Ergebnis wird ein prozessorientiertes<br />
Modell <strong>für</strong> Unternehmen<br />
entwickelt, die als Generalunternehmen<br />
Planungs- und Bauleistungen in der Baubranche<br />
erbringen, wobei sich die Ausarbeitung<br />
auf die Schnittstelle Generalunternehmer-Nachunternehmer<br />
beschränkt.<br />
Durch die Analyse der Prozesse des<br />
Nachunternehmermanagements wird versucht,<br />
die wesentlichen Prozesse eines<br />
Generalunternehmers zu beschreiben, zu<br />
systematisieren und eine entsprechende<br />
Strategie bzw. ein Konzept zu entwickeln.<br />
Durch die Implementierung und Anwendung<br />
des entwickelten Konzeptes sollen<br />
die Prozesse der Beschaffung von Nachunternehmerleistungen<br />
sowie die Kontrolle<br />
dieser Leistungen qualitativ und quantitativ<br />
verbessert werden.<br />
Literatur<br />
[1] Wirth, V.: Controlling Baupraxis 2006<br />
[2] Nebe, L.: Kennzahlengestütztes Projekt-Controlling,<br />
2003<br />
[3] Lachnit, L.: Controllingkonzeption, 1994
Dipl.-Ing. Mathias Jakob<br />
Stahlfaserbeton aus baubetrieblicher Sicht<br />
Baustoff Stahlfaserbeton<br />
Stahlfaserbeton ist ein Beton nach DIN EN<br />
206-1 / DIN 1045-2, dem zur Möglichkeit<br />
der Aufnahme von Zugspannungen Stahlfasern<br />
in Form von gefrästen Fasern,<br />
Draht- oder Blechfasern als Betonzusatzstoff<br />
zugegeben werden.<br />
Abb. 1: Stahlfasern<br />
Im Merkblatt Stahlfaserbeton des Deutschen<br />
Beton- und Bautechnik-Vereins e.V.<br />
vom Oktober 2001 wird Stahlfaserbeton<br />
anhand von Leistungsklassen <strong>für</strong> Gebrauchstauglichkeits-<br />
und Tragfähigkeitsnachweise<br />
eingeordnet.<br />
Abb. 2: Stahlfaserbeton<br />
Zurzeit wird im Deutschen Ausschuss <strong>für</strong><br />
Stahlbeton die DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton<br />
erarbeitet. Sie befindet sich in<br />
der Schlussfassung und wird stahlfaserbetonbezogene<br />
Ergänzungen und Änderungen<br />
der Teile 1 bis 4 der DIN 1045 und der<br />
DIN EN 206-1 zum Inhalt haben. Mit der<br />
Veröffentlichung der Richtlinie und mit<br />
ihrer bauaufsichtlichen Einführung sind<br />
zum Einsatz des Stahlfaserbetons allgemeine<br />
bauaufsichtliche Zulassungen oder<br />
Zustimmungen im Einzelfall nicht mehr<br />
nötig, soweit die Regelungen der Richtli-<br />
nie eingehalten werden. Durch die Richtlinie<br />
wird sich das momentane Einsatzspektrum<br />
des Stahlfaserbetons, vor allem<br />
die Herstellung von Industrieböden und<br />
Tübbingen, wesentlich erweitern.<br />
Der Baustoff Stahlfaserbeton wird sich<br />
vermutlich aus seinem Nischendasein<br />
„befreien“, so er sich als die technisch<br />
und wirtschaftlich günstigere Alternative<br />
zum konventionell bewehrten und betonierten<br />
Bauteil erweist.<br />
Ziel<br />
Zahlreiche Untersuchungen und Veröffentlichungen<br />
haben sich bisher ausgiebig mit<br />
der technischen Seite des Stahlfaserbetons<br />
beschäftigt, eine wissenschaftliche<br />
Untersuchung der baubetrieblichen Aspekte<br />
blieb jedoch weitgehend aus.<br />
In dem Forschungsvorhaben der TU Darmstadt<br />
in Zusammenarbeit mit der WAIBEL<br />
KG sollen die baubetrieblichen Aspekte<br />
des Stahlfaserbetons im Vergleich zu konventionell<br />
bewehrten Bauteilen analytisch<br />
herausgearbeitet werden. Insbesondere<br />
sollen die Ablaufprozesse, der Aufwand<br />
der Herstellung und des Einbaus <strong>für</strong> Personal<br />
und Gerät, die Qualitätssicherung,<br />
die Kosten und Interaktionen beispielsweise<br />
mit der Logistik oder der technischen<br />
Gebäudeausrüstung betrachtet<br />
werden.<br />
Das Ziel ist die Aufstellung einer Matrix<br />
und/oder Entscheidungshilfe, mit der sich<br />
eine genormte Variantenprüfung von konventionell<br />
und mit Stahlfaserbeton hergestellten<br />
Bauteilen durchführen lässt.<br />
Das Forschungsvorhaben wird in Zusammenarbeit<br />
mit der WAIBEL KG durchgeführt.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 31
Dr.-Ing. Jörg Klingenberger<br />
Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von Gebäuden<br />
Ausgangssituation<br />
Die Notwendigkeit und die Bedeutung der<br />
Pflege des Bauwerksbestandes werden<br />
durch die Tatsache, dass viele Gebäude<br />
durch einen Zustand großer materieller<br />
Abnutzung geprägt sind, hervorgehoben.<br />
Die Ursache kann in der Praxis des Betreibens<br />
und Bewirtschaftens von Gebäuden<br />
vermutet werden. Oft wird dabei der Instandhaltung<br />
nicht die notwendige Aufmerksamkeit<br />
gewidmet. Entscheidungen<br />
zur Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen<br />
werden i.d.R. weder aus<br />
strategischen noch aus technischen Gesichtspunkten<br />
getroffen. Sie werden vielmehr<br />
durch ökonomische Randbedingungen<br />
sowie durch gesetzliche Vorgaben<br />
bestimmt. Daher wird häufig auf vorbeugende<br />
Maßnahmen verzichtet und der<br />
Ausfall von Gebäudekomponenten abgewartet.<br />
Auftretende Schäden sind dann<br />
der Initiator <strong>für</strong> die Instandhaltung. Dieses<br />
reaktive Handeln über Jahrzehnte hat zur<br />
Folge, dass bei vielen Gebäuden ein<br />
Instandhaltungsstau festzustellen ist. Ein<br />
solcher kann nur mit großem Ressourcenaufwand<br />
und bei den beschränkt zur Verfügung<br />
stehenden Finanzmitteln nur mittel-<br />
bis langfristig behoben werden.<br />
[1, 2, 3]<br />
Zielsetzung<br />
Die dargelegte Ausgangssituation unterstreicht<br />
den Forschungsbedarf hinsichtlich<br />
der Konzeption der Instandhaltung von<br />
Gebäuden. Ziel des Forschungsvorhabens<br />
ist es, Eigentümern und Betreibern von<br />
Liegenschaften einen Beitrag zur systematischen<br />
Gebäudeinstandhaltung in<br />
Form eines Werkzeugs zur Bildung von<br />
Instandhaltungsstrategien zur Verfügung<br />
zu stellen.<br />
Forschungsmethodik<br />
Als Forschungsmethodik ist ein denklogisches<br />
Vorgehen gewählt worden, das auf<br />
der Annahme beruht, dass bei Gebäuden<br />
ein Instandhaltungsstau durch die Verfolgung<br />
von Strategien der Instandhaltung<br />
32<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
als Bausteine eines systematischen<br />
Instandhaltungskonzeptes vermieden<br />
werden kann. Es wird davon ausgegangen,<br />
dass das Bilden von Instandhaltungsstrategien<br />
mit Hilfe eines Denkmodells,<br />
das nachfolgende Randbedingungen einbezieht,<br />
erfolgen kann:<br />
• Als Untersuchungsgegenstand ist nicht<br />
das Gesamtgebäude heranzuziehen.<br />
Vielmehr sind als Betrachtungseinheiten<br />
Gebäudekomponenten, die so genannten<br />
Instandhaltungsobjekte, zu<br />
identifizieren, die individuelle Anforderungen<br />
an ihre Instandhaltung aufweisen.<br />
• Eine geeignete Instandhaltungsstrategie<br />
<strong>für</strong> eine Gebäudekomponente kann<br />
nur im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung,<br />
welche die komponentenindividuellen<br />
Anforderungen an die Instandhaltung<br />
berücksichtigt, identifiziert<br />
werden.<br />
• Das Bilden einer Instandhaltungsstrategie<br />
erfolgt durch ein Abwägen der<br />
Vor- und der Nachteile der zur Verfügung<br />
stehenden Handlungsalternativen.<br />
Grundlage hier<strong>für</strong> sind existierende Anforderungen<br />
an das Gebäude, definierte<br />
Ziele der Instandhaltung sowie geeignete<br />
bei der Strategiewahl zu berücksichtigende<br />
Kriterien.<br />
Modell zur Bildung von Strategien der<br />
Instandhaltung <strong>für</strong> Gebäude<br />
Das konzipierte Denkmodell dient der Bildung<br />
von geeigneten Strategien der Instandhaltung<br />
<strong>für</strong> einzelne Instandhaltungsobjekte<br />
eines Gebäudes und gliedert<br />
sich in fünf Schritte (Abb. 1). Im ersten<br />
Schritt sind die grundsätzlichen Anforderungen<br />
an den Zustand des zu untersuchenden<br />
Gebäudes festzulegen. Dazu<br />
werden Anforderungskategorien definiert,<br />
die es ermöglichen, durch die Zuordnung<br />
eines Gebäudes zu einer Kategorie die Art<br />
und die Intensität der Gebäudenutzung zu<br />
berücksichtigen. Diese Anforderungen<br />
beeinflussen die relevanten Ziele der In-
standhaltung, die im zweiten Schritt <strong>für</strong><br />
das zu untersuchende Instandhaltungsobjekt<br />
zu identifizieren respektive zu definieren<br />
sind. Den Kernbestandteil des Modells<br />
bilden verschiedene Prinzipien der Strategiewahl.<br />
Diese unterstützen die eigentliche<br />
Aufgabe des Festlegens einer geeigneten<br />
Instandhaltungsstrategie. Sie unterscheiden<br />
sich hinsichtlich der <strong>für</strong> das Vorschlagen<br />
einer Strategie zu berücksichtigenden<br />
Kriterien. Im dritten Schritt ist ein<br />
zu untersuchendes<br />
Gebäude<br />
- Art der Gebäudenutzung<br />
- Intensität der Gebäudenutzung<br />
Anforderungskategorie<br />
an den Gebäudezustand<br />
festlegen<br />
Kategorie<br />
- 1: langfristig bestehenden<br />
Standard halten – neuesten<br />
Standard realisieren<br />
- 2: mittelfristig Nutzung<br />
gewährleisten<br />
- 3: kurzfristig Nutzung<br />
sicherstellen<br />
zu untersuchendes<br />
Instandhaltungsobjekt<br />
relevante<br />
Instandhaltungsziele<br />
definieren<br />
geeignete<br />
Instandhaltungsstrategie<br />
ableiten<br />
Strategie der<br />
- vorausbestimmten<br />
- voraussagenden<br />
- zustandsbestimmten<br />
- ausfallbestimmten<br />
- aufgeschobenen<br />
Instandhaltung<br />
Abb. 1: Struktur des Modells zur Bildung einer geeigneten Instandhaltungsstrategie [4]<br />
Literatur<br />
[1] Lennerts, K.: Werterhalt von Gebäuden und<br />
baulichen Anlagen. In: Die Bauwirtschaft als<br />
Terra Incognita Aedificatoris. Festschrift zum<br />
80. Geburtstag von Professor Dr. K. Pfarr;<br />
S. 165-168. Berlin: DVP <strong>2007</strong>.<br />
[2] Spilker, R.: Oswald, R.: Konzepte <strong>für</strong> die praxisorientierte<br />
Instandhaltungsplanung im Wohnungsbau.<br />
Stuttgart: Fraunhofer IRB 2000.<br />
<strong>für</strong> das zu untersuchende Instandhaltungsobjekt<br />
geeignetes Prinzip der Strategiewahl<br />
zu bestimmen, das im vierten<br />
Schritt zur Anwendung kommt. Der Einsatz<br />
des gewählten Prinzips führt im fünften<br />
Schritt durch das Gegenüberstellen<br />
und Abwägen der zur Verfügung stehenden<br />
Strategiealternativen zu einem Vorschlag<br />
<strong>für</strong> eine geeignete Instandhaltungsstrategie.<br />
[4]<br />
geeignetes Prinzip<br />
der Strategiewahl<br />
bestimmen<br />
- verfügbarkeitsorientiertes<br />
- nutzungsbezogenes<br />
- nutzerzufriedenheitsbezogenes<br />
- risikobasiertes<br />
Prinzip der Strategiewahl<br />
gewähltes Prinzip<br />
der Strategiewahl<br />
anwenden<br />
[3] Tomm, A. et al.: Geplante Instandhaltung. Ein<br />
Verfahren zur systematischen Instandhaltung<br />
von Gebäuden. Aachen: Landesinstitut <strong>für</strong><br />
Bauwesen und angewandte Bauschadensforschung<br />
1995.<br />
[4] Klingenberger, J.: Ein Beitrag zur systematischen<br />
Instandhaltung von Gebäuden. Darmstadt,<br />
Technische Universität, Dissertation<br />
<strong>2007</strong>.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 33
M.Sc. Svetlana Kometova<br />
Controllingaspekte langfristiger Projekte<br />
im Public Real Estate Management<br />
Ausgangssituation<br />
Nach Angaben der Kommunalen Gemeinschaftsstelle<br />
<strong>für</strong> Verwaltungsmanagement<br />
(KGSt) verursacht die Bewirtschaftung des<br />
Immobilienbestandes der öffentlichen<br />
Hand zwischen 15 und 20 Prozent der<br />
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.<br />
Gleichzeitig bilden die immobilienbezogenen<br />
Kosten nach den Personalaufwendungen<br />
den zweitgrößten Block der Arbeitsplatzkosten<br />
der öffentlichen Verwaltung.<br />
Aufgrund einer weiterhin angespannten<br />
Haushaltslage und eines fortschreitenden<br />
demographischen Wandels<br />
kommt der Immobilie, als wesentlicher<br />
kommunaler Ressource, die Funktion einer<br />
elementaren Stellschraube in Bezug<br />
auf eine erfolgreiche Aufgabenerfüllung<br />
zu.<br />
Dieser besonderen Herausforderung kann<br />
die öffentliche Hand gegenwertig jedoch<br />
nur schwer Rechnung tragen, da ihr Immobilienmanagement<br />
als defizitär gilt und<br />
wesentliche Voraussetzungen <strong>für</strong> eine erfolgreiche<br />
Steuerung nicht gegeben sind.<br />
In der seit langem vorherrschenden Kritik<br />
werden insbesondere ineffiziente Aufbauund<br />
Ablauforganisationsstrukturen, mangelndes<br />
Kostenbewusstsein, ungenügende<br />
Steuerungsinformationen aufgrund<br />
fehlender professioneller Controllingsysteme<br />
und ein stets wachsender Investitionsstau<br />
angeführt.<br />
Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung<br />
wird versucht, Antworten auf die<br />
zuvor genannten Probleme zu liefern. Darüber<br />
hinaus kommt es in den vergangenen<br />
Jahren vermehrt zu einer Rückbesinnung<br />
der öffentlichen Hand auf eigene<br />
Kernaufgaben sowie Kompetenzen. Dies<br />
zeigt sich in dem vermehrt zur Anwendung<br />
kommenden Prinzip der Beweislastumkehr,<br />
das aus den Ansätzen der Public-<br />
Choice-Theorie stammt. Dabei gilt es, solche<br />
abtretbaren öffentlichen Aufgaben,<br />
34<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
die der Private besser erfüllen kann, im<br />
freien Wettbewerb zu vergeben. Dies betrifft<br />
insbesondere auch immobilienbezogene<br />
Aufgaben: So sind im Hochbau von<br />
2002 bis heute insgesamt 110 Projekte<br />
mit einem Investitionsvolumen von über<br />
3,2 Milliarden Euro in Form so genannter<br />
Public Private Partnerships (PPP) vergeben<br />
worden.<br />
Das Public Real Estate Management und<br />
ein auf die Immobilienverwaltung bezogenes<br />
New Public Management streben an,<br />
zunächst die Problemfelder und Optimierungspotentiale<br />
zu identifizieren und im<br />
Anschluss tragfähige Lösungsansätze zu<br />
erarbeiten. In diesem Kontext sind auch<br />
die flächenmäßige Einführung der doppelten<br />
Buchführung und des Controllings in<br />
der öffentlichen Verwaltung zu nennen.<br />
Vor dem Hintergrund der skizzierten Entwicklungen<br />
ist festzustellen, dass PPP-<br />
Projekte bzw. langfristige Projekte anderer<br />
Art der öffentlichen Hand hinsichtlich des<br />
Immobiliencontrollings bisher kaum untersucht<br />
sind. Eine Literaturrecherche zeigt,<br />
dass der Bedeutung des Controllings im<br />
Rahmen von PPP-Projekten ein wichtiger<br />
Stellenwert beigemessen wird. Man findet<br />
dabei jedoch keine konkreten Gestaltungshinweise,<br />
wie man ein ganzheitliches<br />
und systematisches Controlling unter<br />
Berücksichtigung der Belange des öffentlichen<br />
Sektors aufbauen sollte. Beachtet<br />
man das Marktvolumen der PPP-Projekte,<br />
so zeigt sich die Bedeutung, die bestehenden,<br />
unmittelbar in der Praxis entwickelten<br />
Controllingansätze, einer Analyse<br />
zu unterziehen.<br />
Ziel der Arbeit<br />
Primäres Ziel der Arbeit ist die Entwicklung<br />
eines Modells <strong>für</strong> das Controlling in<br />
der Abwicklung langfristiger immobilienbezogener<br />
Projekte aus methodischer und<br />
inhaltlicher Sicht, inklusive praxisorientierter<br />
Gestaltungsempfehlungen. Um das
gesetzte Ziel zu erreichen, sollen Zielplanung<br />
und Zielkontrolle der öffentlichen<br />
Hand hinsichtlich langfristiger Projekte<br />
untersucht werden. Basierend darauf soll<br />
ein Zielsystem entwickelt werden, das<br />
einem Controllingsystem zu Grunde gelegt<br />
werden soll. Die identifizierten<br />
Controllingprozesse sollen anschließend<br />
modelliert werden.<br />
Vorgehensweise und<br />
Forschungsmethodik<br />
Im ersten Schritt wird die einschlägige<br />
Literatur ausgewertet. Zudem werden die<br />
Experteninterviews und Fallstudien durchgeführt,<br />
um basierend auf dem Zielsystem<br />
des öffentlichen Sektors die relevanten<br />
Controllingformen zu identifizieren.<br />
Die vorhandene Datenbasis bezüglich<br />
existierender PPP-Projekte erlaubt keine<br />
fundierte Analyse des Entwicklungsstandes<br />
der Controllingsysteme. Aus diesem<br />
Grund ist es erforderlich eine umfangreiche<br />
Primärdatenerhebung durchzuführen.<br />
Die Analyse der Controllingformen bzw.<br />
Controllingaufgaben erlaubt die Identifikation<br />
der im Rahmen der PPP-Projekte einzusetzenden<br />
Controllinginstrumente. Es<br />
wird ein Fragenbogen konzipiert, um den<br />
Status Quo sowie vorhandene Trends hinsichtlich<br />
des Controllings bei der öffentlichen<br />
Hand zu analysieren und aufzunehmen.<br />
Anhand der Datenauswertung lassen sich<br />
die vorhandenen Controllingprozesse in<br />
Bezug auf ihre Schwachstellen überprüfen.<br />
Beim Aufbau des Modells ist aus instrumentaler<br />
Sicht darauf zu achten, dass<br />
die anzuwendenden Instrumente nicht nur<br />
die Informationen zum operativen Controlling<br />
liefern, sondern auch zum strategischen<br />
projektübergreifenden Controlling<br />
liefern. Schließlich soll das entworfene<br />
Modell verifiziert werden.<br />
Bezüglich der Forschungsmethodik handelt<br />
es sich um die Exploration in Form<br />
einer Triangulation aus Expertengesprächen,<br />
Projektunterlagen und Literaturanalyse.<br />
Bei der Konstruktion sowie Auswertung<br />
des Fragenbogens werden die gängigen<br />
Methoden angewendet. Vor dem<br />
Beginn der Umfrage werden die Fragen<br />
anhand der Pilotinterviews auf Verständlichkeit<br />
und Vollständigkeit überprüft.<br />
Aktueller Stand<br />
Die auf den Zielen des öffentlichen Sektors<br />
basierenden Motive lassen sich in<br />
folgende Gruppen aufteilen:<br />
• Kontrolle der Leistungserfüllung,<br />
• begleitende und abschließende Wirtschaftlichkeitskontrolle,<br />
• Liquiditätsplanung und<br />
• Informationsversorgung.<br />
Aus den Motiven der öffentlichen Hand<br />
wurden Controllingformen mit unterschiedlichen<br />
Aufgaben abgeleitet:<br />
• Baucontrolling,<br />
• FM-Controlling,<br />
• Vertragscontrolling und<br />
• begleitende Erfolgskontrolle.<br />
Hinsichtlich der Vorbereitung der Umfrage<br />
wurde festgestellt, dass in Theorie und<br />
Praxis ein unterschiedliches Verständnis<br />
der Termini in Bezug auf Controllingformen<br />
sowie Controllingaufgaben herrscht.<br />
Dies wurde bei der Fragenbogenkonzeption<br />
berücksichtigt.<br />
Anschließend wurde im Rahmen einer<br />
Studie der aktuelle Stand des Controllings<br />
im Facility Management bei der öffentlichen<br />
Hand und bei Non-Property-Unternehmen<br />
untersucht, um die angewendeten<br />
Controllinginstrumente zu identifizieren<br />
sowie das vorherrschende Aufgabenverständnis<br />
des Controllings in der Praxis<br />
abzubilden.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 35
Dipl.-Ing. Marcel Kremer<br />
Untersuchung von Standortfaktoren im Hinblick auf deren Einfluss auf<br />
baubetriebliche Aspekte<br />
Ausgangssituation<br />
Die nunmehr seit Jahren anhaltende Rezession<br />
in der deutschen Bauwirtschaft<br />
führt zu nachhaltigen Veränderungen der<br />
Rahmenbedingungen in der Immobilienwirtschaft<br />
mit der Konsequenz, dass die<br />
Margen der Bauunternehmen schrumpfen<br />
und Investoren die zur Auswahl stehenden<br />
Projektentwicklungen, insbesondere<br />
aufgrund der äußerst schwierigen Refinanzierungssituation,<br />
sehr genau untersuchen<br />
müssen.<br />
Über Zustimmung oder Ablehnung einer<br />
Investition entscheidet die jeweils zu erzielende<br />
Rendite bzw. Rentabilität. Diese<br />
obersten Projektziele sind somit in erster<br />
Linie abhängig von den Kosten, die durch<br />
die Planung und Erstellung eines Bauwerks<br />
entstehen. Die zu erwartenden<br />
Kosten müssen dem Bauherren bzw. dem<br />
Investor somit weit vor der Realisierung<br />
des Bauwerks bekannt sein.<br />
Bei der Ermittlung der Kosten zu einem<br />
relativ frühen Planungsstadium ist eine<br />
exakte Kostenschätzung nur schwer möglich.<br />
Dennoch müssen zu diesem Zeitpunkt<br />
die geschätzten Kosten mit den<br />
Vorstellungen über Angemessenheit und<br />
Finanzierbarkeit verglichen werden, da<br />
eine weiterführende Planung bei einem<br />
nicht rentablen Projekt nur zu unnötigen<br />
Kosten führen würde. Auf dieser Grundlage<br />
wird somit entschieden, ob die Investition<br />
in dieser Größenordnung rentabel,<br />
finanzierbar, in Relation zu Vergleichsobjekten<br />
vertretbar und ob sie <strong>für</strong> den entsprechenden<br />
Zweck überhaupt notwendig<br />
ist. Dementsprechend hoch ist die Bedeutung<br />
der Kostenschätzung in der Immobilienwirtschaft.<br />
Aber auch <strong>für</strong> den Auftragnehmer ist eine<br />
möglichst genaue Kostenschätzung unabdingbar,<br />
da er oftmals auf der Grundlage<br />
dieser Kostenschätzung in einem frühen<br />
Planungsstadium sein Angebot an den<br />
36<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Investor abgeben und auch entscheiden<br />
muss, ob er das Projekt <strong>für</strong> sein Unternehmen<br />
gewinnbringend realisieren kann.<br />
Ziel<br />
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist das<br />
Entwickeln eines Verfahrens, mit dem die<br />
Baukosten von Gewerbeimmobilien relativ<br />
genau im Rahmen der Projektkostenschätzung<br />
zu ermitteln sind. Im Gegensatz<br />
zu den in der Fachliteratur bekannten Verfahren,<br />
die in erster Linie die bauwerksindividuellen<br />
Eigenschaften berücksichtigen,<br />
werden hier die Besonderheiten und Eigenschaften<br />
des Grundstücks mit in die<br />
Berechnungen einbezogen.<br />
Die Eigenschaften des Grundstücks werden<br />
im Rahmen der aus der Immobilienwirtschaft<br />
stammenden Standortanalyse<br />
anhand von Standortfaktoren strukturiert<br />
beschrieben.<br />
Vorgehensweise<br />
Da das zu entwickelnde Verfahren eine<br />
Kombination aus Elementen der Immobilienwirtschaft<br />
(Standortanalyse und Standortfaktoren)<br />
und des <strong>Baubetrieb</strong>s (Kosten<br />
und Kostenschätzung) darstellt, werden<br />
zunächst die wesentlichen Grundlagen der<br />
Immobilienwirtschaft <strong>für</strong> das Verständnis<br />
der Arbeit dargestellt. Hierbei handelt es<br />
sich in erster Linie um die in diesem<br />
Fachbereich gebräuchlichen Termini, Definitionen<br />
und historischen Standorttheorien.<br />
Ausgangspunkt des zu entwickelnden<br />
Verfahrens ist eine detaillierte Standortanalyse<br />
eines Grundstücks. Im Verständnis<br />
dieser Arbeit ist diese aber mehr als<br />
nur ein reines Bewertungsinstrument zur<br />
Untersuchung eines Standortes in Abhängigkeit<br />
einer geplanten Nutzung. Vielmehr<br />
soll mit Hilfe der Standortanalyse erreicht<br />
werden, die Eigenschaften eines Grundstücks<br />
so transparent, strukturiert und <strong>für</strong><br />
einen Dritten so nachvollziehbar wie mög-
lich darzustellen. Dies geschieht dadurch,<br />
dass der komplexe Begriff Lage in einzelne,<br />
messbare, intersubjektiv vergleichbare<br />
Kriterien zerlegt wird, die so genannten<br />
Standortfaktoren.<br />
Daran anschließend werden die erarbeiteten<br />
Standortfaktoren auf deren Einfluss<br />
auf die Baukosten untersucht und somit<br />
eine Verbindung zwischen den Grundstückseigenschaften<br />
und den Baukosten<br />
hergestellt.<br />
Zuletzt wird untersucht, welche Modifikationen<br />
<strong>für</strong> das Verfahren vorgenommen<br />
werden müssen, um dessen Akzeptanz<br />
und Handhabbarkeit in der Praxis zu gewährleisten.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 37
Dr.-Ing. Carola Maffini<br />
Möglichkeiten der Konfliktbehandlung durch die Bauvertragsparteien<br />
Hintergrund<br />
Die Abwicklung von Bauvorhaben geht<br />
meist mit Konflikten einher. Konflikte am<br />
Bau und deren Regulierung sind vermehrt<br />
Gegenstand baubetrieblicher und baujuristischer<br />
Literatur.<br />
Für die Lösung von Konflikten existiert<br />
eine Vielzahl von Konfliktregulierungsmechanismen.<br />
Dadurch kommt es aber nicht<br />
zu weniger Konflikten, da diese Mechanismen<br />
erst greifen, wenn der Konflikt<br />
schon vorhanden ist. Aus diesem Grund<br />
werden <strong>für</strong> die Vermeidung von Konflikten<br />
in jüngster Zeit vermehrt so genannte<br />
partnerschaftliche Vertragsmodelle propagiert.<br />
Diese haben zum Ziel, schon im Vorfeld<br />
Streitigkeiten zu vermeiden.<br />
Keiner der Lösungsansätze hat aber bislang<br />
dazu geführt, die Anzahl von Konflikten<br />
am Bau nachhaltig zu verringern.<br />
Gegenstand<br />
Im Rahmen der Arbeit erfolgen eine Einteilung<br />
von Konflikten und die Darstellung<br />
verschiedener Konflikttheorien. Da der<br />
Bauprozess ohne Kommunikation nicht<br />
funktioniert und im Konfliktfall meist auch<br />
eine Kommunikationsstörung vorliegt,<br />
werden weiterhin diverse Kommunikationsmodelle<br />
vorgestellt.<br />
38<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Da es immer die Person ist, die –unabhängig<br />
woher ein Konflikt rührt – in bestimmten<br />
Situationen im Konflikt und damit<br />
vor der Aufgabe steht, ihn zu bewältigen,<br />
werden personenbezogene Maßnahmen<br />
zur präventiven Konfliktbehandlung<br />
vorgestellt.<br />
Durch eine Literaturrecherche werden<br />
bautypische Konfliktgegenstände und<br />
Konfliktursachen gesammelt. Diese werden<br />
den Projektphasen zugeordnet. Zur<br />
Behandlung dieser Konfliktursachen und<br />
Konfliktgegenstände werden präventive<br />
und kurative Maßnahmen vorgeschlagen.<br />
Ziel präventiver Maßnahmen ist es, dass<br />
es nicht zum Konflikt kommt oder der<br />
Konflikt auf einer niedrigen Eskalationsstufe<br />
gehalten wird. Ziel einer kurativen<br />
Maßnahme soll es sein, dass die Bauvertragsparteien<br />
wieder in die Lage versetzt<br />
werden ergebnisorientiert arbeiten zu<br />
können. Um Konflikte frühzeitig zu erkennen,<br />
werden in den einzelnen Projektphasen<br />
Indikatoren identifiziert, die dies ermöglichen.<br />
Ziel<br />
Ziel der Arbeit ist es zuerst, die verschiedenen<br />
Dimensionen von Konflikten, die<br />
bei der Abwicklung eines Bauprojektes<br />
eine Rolle spielen, aufzuzeigen.<br />
Ein weiteres Ziel ist es, Konflikte frühzeitig<br />
erkennen und vermeiden zu können. Dabei<br />
wird sich nicht nur auf bautypische<br />
Konflikte beschränkt, sondern es wird<br />
auch auf die Erkennung und Vermeidung
von organisatorischen wie sozialen Konflikten<br />
eingegangen, die einen Einfluss auf<br />
das Konfliktpotenzial beim Bauen haben.<br />
Weiterhin werden Wege aufgezeigt, wie<br />
die Bauvertragsparteien einen Konflikt<br />
selbständig behandeln können.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 39
Dipl.-Ing. Sebastian Maffini<br />
Leistungsfeststellung mittels Bildinformationssystemen<br />
Ausgangssituation<br />
Die zeitnahe Feststellung der Baustellenleistung<br />
ist von maßgebender Bedeutung<br />
<strong>für</strong> das baubegleitende Controlling von<br />
Projekten. Die zum Stichtag erbrachte<br />
Bauleistung dient als Grundlage <strong>für</strong> die<br />
Identifikation von Schwachstellen im Bauablauf<br />
sowie zur Kosten- und Terminkontrolle.<br />
Die möglichst genaue Feststellung<br />
der Baustellenleistung wird gegenwärtig<br />
durch zeitaufwendige händische Messmethoden<br />
in meist monatlichen Intervallen<br />
durchgeführt. Für ein steuerndes Eingreifen<br />
in den Bauablauf ist eine derartige<br />
Leistungsfeststellung aufgrund der mangelnden<br />
Zeitnähe meist nicht ausreichend.<br />
Um dem Bedürfnis nach kurzfristiger Kontrolle<br />
Rechnung zu tragen, wurden in der<br />
Vergangenheit am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
diverse Systeme erprobt, die es ermöglichen,<br />
die erbrachte Leistung schnell und<br />
einfach zu dokumentieren und zu quantifizieren.<br />
Das Bauwerk wird zunächst aus<br />
verschiedenen Perspektiven fotografisch<br />
erfasst. Mittels entsprechender Software<br />
können die Bilder dann zu einem dreidimensionalen<br />
Modell zusammengesetzt<br />
werden. Somit kann mit Hilfe der Photogrammetrie<br />
einerseits der bereits vorhandene<br />
Baubestand ermittelt, andererseits<br />
durch regelmäßige Wiederholung der Aufnahmen<br />
der Baufortschritt dokumentiert<br />
werden. Die bisherigen Untersuchungen<br />
beschränkten sich auf Rohbau- und Erdbauarbeiten.<br />
Da es sich dabei um relativ<br />
grob strukturierte Oberflächen handelt,<br />
konnten dort gute Ergebnisse erzielt werden.<br />
Die Möglichkeit, ein qualitativ gutes<br />
Abbild der Leistung zu schaffen, führt nun<br />
zu der Überlegung, dieses Verfahren auch<br />
bei Ausbaugewerken oder im Ingenieurbau<br />
zu erproben. Gerade im Hochbau, wo<br />
der Ausbau und die technische Gebäudeausrüstung<br />
einen wichtigen Anteil der<br />
Gesamtbauleistung darstellen, ist es notwendig,<br />
eine einfache Möglichkeit zur<br />
40<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
zeitnahen Leistungsfeststellung zu entwickeln.<br />
Ziele<br />
Ziel ist es, ein Controllinginstrument zu<br />
schaffen, mit dem die Leistungsentwicklung<br />
einer Baustelle in kurzen Intervallen<br />
überwacht und dokumentiert werden<br />
kann. Auf der Basis der diskreten Leistungsdaten<br />
soll ein Frühwarnsystem entwickelt<br />
werden, welches sowohl terminliche<br />
als auch ökonomische Fehlentwicklungen<br />
aufzeigt. Auf diese Weise soll im<br />
Sinne eines effizienten Baustellencontrollings<br />
die Früherkennung von Ablaufschwächen<br />
stattfinden und ein rasches<br />
Gegensteuern ermöglicht werden.<br />
Vorgehensweise<br />
Neben den bereits bekannten Erfassungsmethoden<br />
sollen neue Techniken wie z.B.<br />
das Laserscanning oder die Nutzung von<br />
Panoramaaufnahmen im Hinblick auf deren<br />
Eignung zur Erfassung von Bauleistungen<br />
untersucht werden.<br />
Die verschiedenen Verfahren der Leistungsfeststellung<br />
mittels digitaler Methoden<br />
sollen dann auch <strong>für</strong> die Gewerke des<br />
Ausbaus, der technischen Gebäudeausrüstung<br />
aber auch bei Ingenieurbauwerken<br />
erprobt werden.<br />
Um ein Abbild der Leistungsentwicklung<br />
zu schaffen, ohne dabei alle Leistungsbestandteile<br />
detailliert zu reproduzieren,<br />
müssen die erfassbaren Leitgrößen der<br />
Leistungsentwicklung identifiziert und so<br />
definiert werden, dass untergeordnete<br />
Größen mit abgedeckt werden. Weiterhin<br />
gilt es zu untersuchen, inwiefern die Genauigkeit<br />
und die Häufigkeit der Messungen<br />
das Abbild der Leittätigkeiten in seiner<br />
Aussagekraft beeinflussen.<br />
Die Zuordnung der erfassten Daten mit<br />
den Soll-Vorgaben stellt eine große Herausforderung<br />
dar. Im Bereich der Bildinterpretation<br />
stehen gegenwärtig noch<br />
nicht ausreichend leistungsfähige Algo-
ithmen zur Verfügung, so dass eine globale<br />
Automation der Zuordnung noch nicht<br />
möglich ist. Als Alternativen sollen verschiedene<br />
optische und funkbasierende<br />
Codierungen zur Leistungsidentifikation<br />
erprobt werden. Parallel soll über die automatisierte<br />
Lokalisierung der Aufnahmen<br />
eine Vereinfachung und Teilautomatisierung<br />
des manuellen Abgleichs zwischen<br />
Soll- (CAD-Modell) und Ist-Daten (Aufnahmen)<br />
herbeigeführt werden.<br />
Schließlich sollen die durch Bildinformationssysteme<br />
gewonnen Daten zu einem<br />
diskreten Projektmodell zusammengeführt<br />
werden, welches automatisiert auf<br />
Schwachstellen in der Leistungsentwicklung<br />
der Baustelle hinweist.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 41
Dipl.-Ing. Oliver Mehr<br />
Polysensorale Bauprozessdetektion<br />
Ausgangssituation<br />
Die Bauindustrie hat in den vergangenen<br />
Jahrzehnten durch Normierung von Arbeitsmaterialien<br />
und Prozessabläufen<br />
enorme Produktivitätssteigerungen erzielt.<br />
Innerhalb immer kürzerer Zeit werden<br />
immer höhere Investitionssummen in Bauwerke<br />
umgesetzt. Die Kontrolle von Qualität<br />
und Quantität der ausgeführten Leistungen<br />
dagegen erfolgt noch immer mit<br />
einfachsten Mitteln des Aufmaßes vor Ort<br />
respektive mit Hilfe von Planauszügen in<br />
zu großen Zeitabständen. Ein zeitnaher<br />
Vergleich der Ist-Bauleistung mit den Planrespektive<br />
Sollgrößen findet nicht statt.<br />
Dies ist u.a. mit dem Fehlen automatisierter<br />
Leistungserfassungsmethoden begründet.<br />
Ziel<br />
Die Baufortschrittserfassung in Echtzeit<br />
bietet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.<br />
Abweichungen vom quantitativen und<br />
zeitlichen Ziel des Bauvorhabens können<br />
bei Eintreten frühzeitig detektiert oder<br />
durch Simulation vorausgesehen und bestenfalls<br />
vermieden werden. Die digitale<br />
Erfassung der Vorgänge auf der Baustelle,<br />
von Personen, Material und Arbeitsmitteln<br />
ist eine der Voraussetzungen <strong>für</strong> die Unterstützung<br />
derselben durch eine künstliche<br />
Intelligenz. Durch die Loslösung der<br />
Abb. 1: Prinzip Sensorverteilung<br />
42<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Informationen vom Mensch ist eine Objektivierung<br />
des Zustands der Baustelle<br />
möglich. Durch einen veränderten Detaillierungsgrad<br />
der Erfassung der Vorgänge<br />
können neue Kennzahlen zu zeitnahen<br />
Prognosen der Ergebnisse des Bauvorhabens<br />
in Bezug auf Quantität, Termintreue<br />
und Kosten führen.<br />
Vorgehensweise<br />
Die Erfassung von Bauzuständen findet<br />
bisher händisch statt. Die der digitalen<br />
Datenverarbeitung zugeführten Informationen<br />
lassen keine objektive Deutung des<br />
Baugeschehens oder gar eine Prognose<br />
des wirtschaftlichen Erfolgs des Bauprojekts<br />
zu. Um eine Informationsbasis <strong>für</strong> ein<br />
computergestütztes Verständnis der Bauprozesse<br />
zu schaffen, müssen Vorgangselemente<br />
erfasst, dem jeweiligem generischen<br />
Vorgang zugeordnet und in ein dem<br />
Computer verständliches Format überführt<br />
werden. Bestehende Soll-Vorgaben wie<br />
Terminpläne, Baupläne und die Kostenplanung<br />
müssen ebenfalls an dieses Format<br />
angepasst werden. Die Erfassung der<br />
Vorgänge auf der Baustelle durch Sensoren<br />
unter Zuhilfenahme der Planvorgaben<br />
bildet den Kern bisheriger Forschung.
Das Sensorsystem soll sich, ohne<br />
menschliches Eingreifen zu erfordern,<br />
kalibrieren und die Messwerte der unterschiedlichen<br />
Sensoren empfangen, auswerten<br />
und Rückschlüsse <strong>für</strong> eine Neuausrichtung<br />
ziehen. Planvorgaben werden<br />
zur Steuerung der Sensoren und im Auswertungsprozess<br />
zur Deutung der Messwerte<br />
herangezogen.<br />
Sensoren sind per se mit Imperfektionen<br />
behaftet. Unsicherheit in Bezug auf den<br />
Messwert, Ungenauigkeit desselben, Unvollständigkeit<br />
der Informationen, Mehrdeutigkeit<br />
der Informationen, Konflikte<br />
und Redundanzen sind zu berücksichtigen.<br />
An den Kontext der Baustelle angepasste<br />
Auswertungsalgorithmen werden entwickelt.<br />
Verschiedene Sensoren können verschiedene<br />
Vorgangselemente messen. So kann<br />
z.B. aufgrund der Auswertung von Messwerten<br />
eines Erschütterungssensors am<br />
Schalelement auf die Vorgangsstufe „Be-<br />
Abb. 2: Überlagerung von Plan- und Sensordaten<br />
Bei dem Projekt werden räumlich verortete<br />
Kameras eingesetzt, die computergesteuert<br />
die Baustelle nach relevanten Informationen<br />
abtasten. Die Kameras stellen<br />
sowohl Bewegungsinformationen als auch<br />
Bilder bereit.<br />
Die Bewegungsinformationen geben Aufschluss<br />
über den aktuellen Fokus der Arbeiten.<br />
Der Inhalt der Bilder wird mit einem Objektkatalog<br />
abgeglichen, der die dreidimensionalen<br />
Abbildungen der von Peri<br />
Polska eingesetzten Schalelementtypen<br />
enthält. Die identifizierten Schalelementtypen<br />
werden anhand ihrer identifizierten<br />
Lage im Raum, unter Berücksichtigung<br />
des in der Vorbereitungsphase aus den<br />
ton verdichten“ und damit auf den Vorgang<br />
„betonieren“ geschlossen werden.<br />
Durch die Verknüpfung der Position des<br />
Sensors mit dem Bauplan kann auf den<br />
Ort des Vorgangs und damit eindeutig auf<br />
das Bauteil geschlossen werden, das<br />
durch den Vorgang verändert wird.<br />
Umgekehrt muss die Erwartung der<br />
Betonage, die aus dem Terminplan abgeleitet<br />
wird, zu einem Kalibrieren des Sensors<br />
auf genau diesen Vorgang führen. Die<br />
Prognose des Ereignisses führt somit zu<br />
einer besseren Erfassung desselben.<br />
Referenzprojekt<br />
Im 3. Quartal 2008 wurde die Integration<br />
von Sensorinformationen an einem Referenzprojekt<br />
in Zusammenarbeit mit Peri<br />
Polska Sp. z o.o getestet. Dabei wurde die<br />
Entstehung eines Bauwerks in der Rohbauphase<br />
von unterschiedlichen Sensoren<br />
beobachtet.<br />
Bauplänen erstellten 3D-Modells, einzelnen<br />
Bauteilen zugeordnet.<br />
Das Ergebnis ist die automatische Detektion<br />
des Baufortschritts und Berechnung<br />
der Massen der hergestellten Bauteile.<br />
Aufgrund von Verdeckung nicht detektierte<br />
Herstellungsvorgänge von Bauteilen<br />
können mit guter Genauigkeit anhand von<br />
regelbasierter Auswertung des Geometriemodells<br />
hergeleitet werden.<br />
Als weiteres Sensorsystem kommt ein<br />
Lokales Positionierungssystem, LPS, zum<br />
Einsatz. Das LPS besteht aus einzelnen<br />
Transmitter / Receiver (Transceiver) Elementen,<br />
die ihre Abstände zueinander<br />
durch Laufzeitmessung elektromagnetischer<br />
Wellen bestimmen. Mit Hilfe von<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 43
eingemessenen Referenztransceivern<br />
wird mit dem LPS jeder an einem Schalelement<br />
angebrachter Transceiver räumlich<br />
und zeitlich verortet. Damit ist es mög-<br />
Abb. 3: Messwert des LPS mit Plandaten überlagert<br />
44<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
lich, den Aufenthaltsort eines Schalelements<br />
zu einem bestimmten Zeitpunkt zu<br />
dokumentieren und auch auf vor den Kameras<br />
verdeckte Vorgänge zu schließen.
Dipl.-Ing. Alexander Nolte<br />
Qualitätssicherung in der Schalungstechnik<br />
Ausgangssituation<br />
Die kontinuierliche Veränderung in der<br />
Baubranche wird substanziell von den unterschiedlichen<br />
Prozessen im Kerngeschäft,<br />
den Baustellen, geprägt. Trotz<br />
stärkerer Anteile der Ausbaugewerke spielen<br />
der Stahlbetonbau und die damit verbundene<br />
Schalungstechnik weiterhin eine<br />
elementare Rolle.<br />
Neben dem klassischen Verkaufsgeschäft<br />
hat sich <strong>für</strong> die Schalungshersteller in den<br />
letzten Jahrzehnten das Vermieten von<br />
Schalung zu einem zusätzlichen Geschäftsfeld<br />
weiterentwickelt. Diese Entwicklung<br />
basiert im Wesentlichen auf betriebswirtschaftlichen<br />
Optimierungen seitens<br />
der Bauunternehmen wie der Minimierung<br />
von Lagerbeständen und reduzierten<br />
Vorhalte- und Lagerkosten. Ferner<br />
sind hier die Einsatzvariabilität und die<br />
hohe Qualität der Mietschalung aufzuführen.<br />
Der Betrieb eines modernen Schalungsmietparks<br />
ist komplex: Die Logistik, Abrechnung<br />
und Instandhaltung der Schalung<br />
sind neben der herstellereigenen<br />
Schalungstechnologie wesentliche Punkte<br />
<strong>für</strong> den erfolgreichen Betrieb eines Mietparks.<br />
Vorgegebene Qualitätsstandards<br />
wie die des Güteschutzverbandes Betonschalungen<br />
e.V. statuieren Vorgaben <strong>für</strong><br />
den Betrieb und Abwicklung von Mietschalungen.<br />
Die Kosten <strong>für</strong> das Mieten einer Schalung<br />
bestehen neben den Abwicklungs- und<br />
Logistikkosten sowie den Kosten <strong>für</strong> Zusatzleistungen<br />
primär aus den Mietkosten<br />
<strong>für</strong> das Schalungsmaterial, die orientiert an<br />
der BGL nach dem monatlichen Neupreis<br />
abgerechnet werden. Im Gegensatz zu<br />
dem betriebenen Mietmodell entstehen<br />
die „wahren“ Kosten nicht zeitabhängig,<br />
da der Verschleiß des Schalungssystems<br />
primär von der Anzahl der Betonagen abhängig<br />
ist. Die nicht bedarfsgerechte Abrechnung<br />
und der nicht ordnungsgemäße<br />
Einsatz von Mietmaterial auf Baustellen<br />
führen oft zu schwerwiegenden Konflikten<br />
zwischen Mietparkbetreiber und Mieter.<br />
Ziele<br />
Der Einfluss der Schalung als formbildendes<br />
Element ist elementar <strong>für</strong> die Ausführung<br />
im <strong>Baubetrieb</strong> und die Qualität des<br />
finalen Beton-Produktes. Da die Schalungshersteller<br />
abgesehen vom Produktdesign,<br />
der projektbezogenen Unterstützung<br />
durch Schalungsingenieure und der<br />
Bereitstellung im Rahmen des Mietgeschäftes<br />
nur geringe Einflüsse auf die eigentliche<br />
Bauausführung haben, wird der<br />
Fokus der Arbeit auf die Prozesse im Bereich<br />
der Mietschalungsabwicklung gelegt.<br />
Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines<br />
Modells zur bedarfsgerechten Abrechnung<br />
von Mietschalung. Dies erfordert Untersuchungen<br />
in folgenden Bereichen:<br />
• Prozessidentifikation und Optimierung<br />
auf Mietlager- und Baustellenebene,<br />
• Entwicklung eines Systems zur Erfassung<br />
von Betonagen,<br />
• branchenübergreifende Analyse von<br />
Mietmodellen,<br />
• Klassifizierung von Schalung,<br />
• Logistikmanagement und Dokumentation<br />
von Schalungstransaktionen.<br />
Vorgehensweise<br />
Im ersten Arbeitsschritt wurde eine Prozessdarstellung<br />
des Lebenszyklus von<br />
Mietschalungselementen, folgend als<br />
Schalungszyklus bezeichnet, entwickelt.<br />
Als Basis der Arbeit dient der Schalungszyklus<br />
<strong>für</strong> die Entwicklung eines bedarfsgerechten<br />
Abrechnungsmodells <strong>für</strong> Mietschalung.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 45
Abb. 1: Schalungszyklus (Deckenelemente)<br />
Zur Realisierung der bedarfsgerechten Abrechnung<br />
ist ein System zur Erfassung<br />
von Betonagen und der Individualisierung<br />
von Schalungselementen zu konzipieren.<br />
Neben der technischen Entwicklung sind<br />
die baubetrieblichen Prozessgrößen zu<br />
definieren sowie potentielle Einflussfaktoren<br />
und Rahmenbedingungen auf der<br />
Baustelle zu erfassen.<br />
46<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Die Weiterentwicklung des bestehenden<br />
Mietmodells ist ein weiterer Fokus der<br />
Arbeit. Branchenübergreifend sind Mietmodelle,<br />
die auf einer bedarfsgerechten<br />
Abrechnung basieren, zu identifizieren und<br />
Prozesse detailliert zu analysieren. In einem<br />
weiteren Arbeitsschritt sind die<br />
Mietprozesse zu adaptieren und in das<br />
Modell des Schalungsmietparks zu implementieren.
Dipl.-Ing. Leif Pallmer<br />
Vorbeugender Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie<br />
Ausgangssituation<br />
Gemäß jeweiliger Landesbauordnung sind<br />
bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten,<br />
zu ändern und instand zu halten,<br />
dass<br />
• der Entstehung eines Brandes und<br />
• der Ausbreitung von Feuer und Rauch<br />
(Abschottungsprinzip) vorgebeugt wird<br />
und<br />
• bei einem Brand die Rettung von Menschen<br />
und Tieren sowie<br />
• wirksame Löscharbeiten möglich sind.<br />
Abb. 1: Übersicht zur Gliederung des Brandschutzes<br />
Der vorbeugende bauliche Brandschutz<br />
mit Schwerpunkt in der Projektphase<br />
Neubau einer Immobilie nimmt zur Erfüllung<br />
o.g. Forderungen eine entscheidende<br />
und <strong>für</strong> die Immobilie mitbestimmende<br />
Stellung ein.<br />
Eine weitergehende ganzheitliche Lebenszyklusbetrachtung<br />
wurde auf diesem<br />
Fachgebiet in Deutschland bislang noch<br />
nicht vorgenommen.<br />
Abb. 2: Interaktion Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie<br />
Diese Untersuchung ist jedoch Schlüssel<br />
zur Nutzung von Optimierungspotenzialen,<br />
zur dauerhaften Qualitätssicherung, zur<br />
Wirtschaftlichkeit sowie weitergehend zur<br />
Ressourceneffizienz.<br />
Ziele<br />
Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, den<br />
Brandschutz durch eine ganzheitliche Betrachtung<br />
über alle Lebenszyklusphasen<br />
der Immobilie zu beleuchten und zu analysieren.<br />
Die Schwerpunkte hierbei sind:<br />
• Vorbeugender baulicher Brandschutz in<br />
den jeweiligen Lebenszyklusphasen,<br />
• Schnittstellen sowie übergreifende Einflüsse<br />
und Wechselwirkungen,<br />
• Aufstellung eines allgemeinen Kataloges<br />
mit Handlungsempfehlungen und<br />
Optimierungsansätzen <strong>für</strong> den Planungs-<br />
und Bauprozess im Kontext mit<br />
den Lebenszyklusanforderungen,<br />
• Darstellung sowie (Weiter-)Entwicklung<br />
von Prozessabläufen und Werkzeugen<br />
zur Förderung und Sicherstellung der<br />
Qualität in der Planungs- und Bauphase,<br />
auch im Hinblick auf die Betriebsphase<br />
und ggf. die Revitalisierung.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 47
Dr.-Ing. Christoph Pflug<br />
Ein Bildinformationssystem zur Unterstützung<br />
der Bauprozesssteuerung<br />
Ausgangssituation<br />
Das Errichten von Bauwerken erfordert,<br />
dass eine Vielzahl von Daten und Informationen<br />
erfasst, verwaltet, analysiert und<br />
auch präsentiert werden müssen. Dies<br />
erzeugt komplexe Strukturen und stellt<br />
hohe Anforderungen an die bestehenden<br />
und auch an die zu entwickelnden Informationssysteme.<br />
Die gegenwärtig üblich verwendeten Systeme<br />
der Dokumentation und Steuerung<br />
von Bauprozessen sind mit einem großen<br />
Arbeitsaufwand <strong>für</strong> das Baustellenmanagement,<br />
welches direkt vor Ort die Verantwortung<br />
<strong>für</strong> das technische und wirtschaftliche<br />
Ergebnis der Bauproduktion<br />
trägt, verbunden. So ist das Baustellenmanagement<br />
oftmals nicht in der Lage alle<br />
prozessrelevanten Daten und Informationen<br />
mit dem gebotenen zeitlichen Bezug<br />
Abb. 1: Bildaufnahmesystem<br />
Die Arbeit beruht auf den Ergebnissen<br />
eines Verbundforschungsvorhabens zwischen<br />
dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der<br />
Technischen Universität Darmstadt, dem<br />
Geodätischen <strong>Institut</strong> der Technischen<br />
Universität Darmstadt und einem Industriepartner.<br />
48<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
<strong>für</strong> eine aktive Bauprozesssteuerung zu<br />
erfassen und entsprechend auszuwerten.<br />
In der Dissertation mit dem Titel „Ein Bildinformationssystem<br />
zur Unterstützung der<br />
Bauprozesssteuerung“ wird die technische<br />
Entwicklung eines Bildinformationssystems<br />
vorgestellt, welches eine neuartige<br />
Möglichkeit der Erfassung von Daten<br />
und Gewinnung von Informationen auf<br />
Basis von Digitalfotografien ermöglicht.<br />
Das Bildinformationssystem ist als ein<br />
unterstützendes Werkzeug <strong>für</strong> die Dokumentation<br />
und Steuerung von Ausführungs-<br />
und Wartungsprozessen über den<br />
gesamten Lebenszyklus entwickelt worden.<br />
Bei der technischen Entwicklung<br />
handelt es sich um einen Prototyp, der<br />
eine vollständige Funktionsfähigkeit aufweist.<br />
Basiselemente des entwickelten Bildinformationssystems<br />
Die Basiselemente des entwickelten Bildinformationssystems<br />
sind ein Bildaufnahmesystem<br />
und ein Softwaresystem. Das<br />
Bildaufnahmesystem besteht aus einer<br />
handelsüblichen Digitalkamera sowie ei-
nem dazugehörigen Positionierungssystem<br />
<strong>für</strong> die Ermittlung des Standortes und<br />
der Aufnahmerichtung der Digitalkamera<br />
(Abb. 1). Das Positionierungssystem ist<br />
eine Entwicklung des Geodätischen <strong>Institut</strong>s,<br />
welches die benötigten Raumdaten<br />
auf Basis der Ultrabreitbandtechnik ermittelt.<br />
Mit dem Bildaufnahmesystem können<br />
georeferenzierte und orientierte Digitalfotografien<br />
in einem lokalen Koordinatensystem<br />
einer Baustelle erstellt werden.<br />
Das Softwaresystem übernimmt die Funktion<br />
einer automatisierten Verknüpfung<br />
und präzisen Überlagerung der georeferenzierten<br />
und orientierten Digitalfotografien<br />
mit einem objektorientierten 3D-<br />
Modell. Das 3D-Modell wird mithilfe des<br />
Softwaresystems um objektbezogene<br />
Daten, die sich aus Zeitwerten und weiteren<br />
Attributen ergeben, zu einem so genannten<br />
4D-Modell entwickelt.<br />
Abb. 2: links: Georeferenzierte und orientierte Digitalfotografie, rechts: Perspektivische Ansicht des 4D-Modells<br />
In Abb. 2 sind exemplarisch links eine<br />
georeferenzierte und orientierte Digitalfotografie<br />
von einer realen Szene einer Baustelle<br />
und rechts die perspektivische Ansicht<br />
des 4D-Modells abgebildet. Die Objekte<br />
des 4D-Modells sind entsprechend<br />
ihres Fertigungszustandes farblich gekennzeichnet.<br />
Ergänzend zu der grafischen<br />
Darstellung der Objekte werden<br />
deren Objektklasse, deren Identitäten sowie<br />
der Fertigungszustand im 4D-Modell<br />
angezeigt.<br />
Da die perspektivische Ansicht des 4D-<br />
Modells mit der georeferenzierten und<br />
orientierten Digitalfotografie sowohl grafisch<br />
als auch inhaltlich identisch ist, können<br />
beide Abbildungen koordinatenecht<br />
Grundprinzip des Bildinformationssystems<br />
Im Rahmen einer baubegleitenden Baustellendokumentation<br />
werden mit dem<br />
Bildaufnahmesystem georeferenzierte und<br />
orientierte Digitalfotografien erstellt und<br />
mit dem Softwaresystem ausgewertet.<br />
In einem ersten Arbeitsschritt werden mit<br />
dem Softwaresystem die Objekte des 4D-<br />
Modells des zu erstellenden Baukörpers<br />
mit Zeitwerten und Fertigungszuständen,<br />
die dem realen Ist-Bauzustand entsprechen,<br />
attributiert. Dies geschieht im Sinne<br />
einer Leistungsfeststellung. Mit den bekannten<br />
Werten über den Standort, die<br />
Aufnahmerichtung und die innere Abbildungsgeometrie<br />
der verwendeten Digitalkamera<br />
wird in einem weiteren Arbeitsschritt<br />
die entsprechende perspektivische<br />
Ansicht vom 4D-Modell <strong>für</strong> eine georeferenzierte<br />
und orientierte Digitalfotografie<br />
erzeugt.<br />
überlagert und deren Informationen in<br />
einer Datenbank miteinander verknüpft<br />
werden. Die Informationen beziehen sich<br />
auf die attributierten Objekte des 4D-<br />
Modells. Es wird in diesem Sinne eine<br />
automatisierte Objekterkennung einschließlich<br />
einer Zustandsbeschreibung<br />
<strong>für</strong> die Digitalfotografie mit dem Softwaresystem<br />
realisiert. Dies ermöglicht eine<br />
systematische und automatisierte Ordnung<br />
von Digitalfotografien.<br />
In Abb. 3 ist die Überlagerung der georeferenzierten<br />
und orientierten Digitalfotografie<br />
mit der perspektivischen Ansicht<br />
des 4D-Modells dargestellt. Es werden<br />
somit zwei Abbildungen definierter Realitäten<br />
in einem System zusammengeführt.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 49
Abb. 3: Überlagerung der Digitalfotografie mit dem 4D-Modell<br />
Anwendungsmöglichkeiten des Bildinformationssystems<br />
Das entwickelte Bildinformationssystem<br />
ermöglicht mit den abstrakten Abbildungen<br />
des 4D-Modells und den realistischen<br />
Abbildungen der Digitalfotografien die Darstellung<br />
von Bauprozessen. Es lässt sich<br />
eine Bestandsdokumentation entwickeln,<br />
die einen transparenten und glaubwürdigen<br />
Nachweis von Ist-Bauzuständen bietet.<br />
Das System kann somit als ein unabhängiges<br />
Kommunikationsmedium <strong>für</strong> die<br />
Bauprojektorganisation verwendet werden.<br />
Die vorhandenen Bilddaten liefern<br />
z.B. wertvolle Informationen <strong>für</strong> die Inter-<br />
50<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
pretation von Sachverhalten bei Streit- und<br />
Mängelsituationen und können zur Ursachenanalyse<br />
bei Störungen im Bauablauf<br />
dienen.<br />
Weiterhin können die erfassten Bauzustände<br />
dem geplanten Baufortschritt, welcher<br />
mit dem 4D-Modell abgebildet werden<br />
kann, im Sinne eines Soll-Ist-<br />
Vergleiches gegenübergestellt werden. Es<br />
sind somit Abweichungen in den raumzeitlichen<br />
Strukturen des 4D-Modells erkennbar<br />
und dokumentierbar.<br />
Mit der Visualisierung der Bauprozesse<br />
(Soll- und Ist-Bauzustände) und den verbundenen<br />
Interaktionsmöglichkeiten des<br />
4D-Modells ist eine <strong>für</strong> den Menschen<br />
intuitiv zu verstehende Arbeitsumgebung<br />
gegeben, welche eine Navigation in Raum<br />
und Zeit ermöglicht.<br />
Das Bildinformationssystem bildet somit<br />
ein sehr effizientes Dokumentations- und<br />
Bewertungsmedium <strong>für</strong> den gesamten<br />
Lebenszyklus von Bauobjekten und kann<br />
zu einer Verbesserung der Prozesse beitragen.
Dipl.-Ing. Markus Schäfer<br />
Optimierung von Planungsprozessen <strong>für</strong> Infrastrukturprojekte<br />
der DB AG<br />
Ausgangsbasis<br />
In den vergangenen Jahren sind im Rahmen<br />
von Infrastrukturprojekten der Deutschen<br />
Bahn AG (DB AG) immer wieder,<br />
gemessen an den Baukosten, zu hohe<br />
Ausgaben <strong>für</strong> Planungsleistungen angefallen.<br />
Insbesondere <strong>für</strong> kleinere und mittlere<br />
Baumaßnahmen der DB Station & Service<br />
AG (in der Größenordnung bis 5 Mio. €)<br />
waren Planungskosten von mehr als 15 %<br />
keine Seltenheit.<br />
Die Planungsaufgaben zum Bau von Infrastrukturanlagen<br />
der Bahn werden vor allem<br />
unter Berücksichtigung der Leistungsphasen<br />
der HOAI ausgeführt. Neben<br />
rechtlichen Prämissen – vor allem die Eisenbahn<br />
Bau- und Betriebsordnung – sind<br />
auch die technischen Randbedingungen,<br />
wie DIN Normen etc. zu beachten. Das<br />
Eisenbahn-Bundesamt (EBA), das als<br />
Bundesoberbehörde sowohl <strong>für</strong> die Bewilligung<br />
von Bundesfinanzierungen als auch<br />
<strong>für</strong> Plan- und Baugenehmigungen von Eisenbahninfrastrukturanlagen<br />
zuständig ist,<br />
gibt auf Basis der eingangs erwähnten<br />
Randbedingungen die Planungsparameter<br />
vor, innerhalb denen die internen und externen<br />
Planungsabteilungen ihre Leistungen<br />
erbringen müssen.<br />
Unter dem enormen, u.a. von den defizitären<br />
öffentlichen Haushalten ausgehenden<br />
Kostendruck der Bauindustrie steht seit<br />
Jahren auch das Preisrecht der Architekten<br />
und Ingenieure (HOAI) auf dem Prüfstein.<br />
Hier sind sich die öffentlich und privat<br />
motivierten Fachleute nicht einig, wie<br />
die zukünftige Entwicklung aussehen sollte.<br />
In diesem Kontext wurden Denkmodelle<br />
diskutiert, die von einer Novellierung bis<br />
zur Abschaffung der HOAI reichen. Einen<br />
eher praxisbezogenen Beitrag zu diesem<br />
Thema liefert die AHO mit dem Vorschlag<br />
zur Vereinfachung bzw. Straffung der Planungsphasen.<br />
Um die Wertschöpfung und die Qualität<br />
aus dem gesamten Lebenszyklus eines<br />
Bauwerks nachhaltig zu sichern, haben<br />
neben den öffentlichen <strong>Institut</strong>ionen auch<br />
große Baukonzerne begonnen, die Chancen<br />
zur Reduzierung von Planungskosten<br />
zu betrachten. Dabei werden außer den<br />
aus den Planungsentscheidungen resultierenden<br />
Baukosten auch Betriebs-,<br />
Instandhaltungs- und Finanzierungskosten<br />
analysiert, um sämtliche Leistungen aus<br />
„einer Hand“ anzubieten.<br />
These<br />
Grundsätzlich sollte ein geändertes Informations-<br />
und Wissensmanagement mit<br />
Hilfe einer aussagekräftigen Datenanalyse<br />
der Projektkosten und des Projektnutzens,<br />
abhängig von der jeweiligen Planungstiefe,<br />
eine Extrapolation zur Minimierung der<br />
Planungskosten bei gleichzeitiger Maximierung<br />
der Bauqualität ermöglichen. Im<br />
Rahmen dieser Arbeit wird untersucht,<br />
wie die Verkettung von Einzelaktivitäten<br />
unter Berücksichtigung der Dimensionen<br />
(Durchlauf-) Zeit, (Prozess-) Kosten und<br />
Qualität, in Anlehnung an den logistischen<br />
Ansatz in der stationären Industrie des<br />
„supply chain managements“, je Leistungsphase<br />
und Komplexität sowohl des<br />
einzelnen Bauwerks als auch seines Umfeldes<br />
am Beispiel von Eisenbahninfrastrukturanlagen<br />
der Deutschen Bahn definiert<br />
werden müssten.<br />
Zielsetzung<br />
Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung<br />
eines Modells, das abhängig von den spezifischen<br />
und vielfältigen Randbedingungen<br />
bei Neubauten während des laufenden<br />
Bahnbetriebs, also „unter rollendem<br />
Rad“, eine zeitnahe, möglichst perfekte<br />
Steuerung und Risikobetrachtung in den<br />
einzelnen Synergieeffekte ausnutzenden<br />
Planungsphasen hinsichtlich einer korrekten<br />
Ausführungsplanung und damit die<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 51
Grundlage <strong>für</strong> die Erstellung mangelfreier<br />
Bauwerke schafft.<br />
Gegenstand der Forschung<br />
In der vorzulegenden Arbeit werden infolgedessen<br />
die analytische Betrachtung von<br />
Bauvorhaben bzw. deren Planungsphasen<br />
im Vordergrund stehen. Dabei soll der<br />
Fokus insbesondere auf Planungsfehler<br />
und die daraus resultierenden Probleme<br />
bei der Ausführung gerichtet, und es sollen<br />
die wesentlichen Abläufe analysiert<br />
werden. Zur Absicherung der Ergebnisse<br />
werden die planungserstellenden und planungsprüfenden<br />
Abteilungen sowie die <strong>für</strong><br />
die Ausführung zuständigen Bauüberwacher,<br />
Bauherrenvertreter und Projektleiter<br />
befragt und zurate gezogen.<br />
Die Planungszeiträume <strong>für</strong> die einzelnen<br />
Phasen der <strong>für</strong> die Untersuchung auszu-<br />
52<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
wählenden Projekte sind dabei ebenso zu<br />
berücksichtigen, wie die Zusammensetzung<br />
des jeweiligen Planerstabes. Denn<br />
wegen des hohen Spezialisierungsgrades,<br />
der <strong>für</strong> die Zulassungen gemäß der Verwaltungsvorschriften<br />
des Eisenbahn-<br />
Bundesamtes erforderlich ist, ist bisher<br />
eine Eisenbahninfrastrukturanlage von nur<br />
einem Planungsbüro kaum zu bewerkstelligen,<br />
ohne dass Subunternehmerleistungen<br />
in Anspruch genommen werden.<br />
Neben den äußeren und inneren Planungsparametern<br />
werden die Projektkosten<br />
in den einzelnen Phasen exemplarisch<br />
erfasst, um die Stundenaufwendungen<br />
mit den Leistungsanforderungen abzugleichen.
Dipl.-Ing. Julia Schömbs<br />
<strong>Baubetrieb</strong>liche Aspekte bei der Herstellung von Sichtbeton<br />
Ausgangssituation<br />
In den letzten Jahren ist eine Renaissance<br />
des Sichtbetons als Gestaltungsinstrument<br />
der modernen Architektur zu verzeichnen.<br />
Die großen Weiterentwicklungen im Bereich<br />
der Stahlbetontechnologie ermöglichen<br />
mittlerweile eine nahezu unbegrenzte<br />
Formenvielfalt der Baukörper mit flexiblen<br />
Geometrien und filigranen Bauteilen.<br />
Dadurch gewinnt die architektonische<br />
Form des gestalteten Objekts an Bedeutung,<br />
welche durch eine dezente, zurückgenommene<br />
Oberflächentextur in den<br />
Vordergrund der Wahrnehmung gestellt<br />
werden soll. Gleichzeitig wünschen viele<br />
Architekten die Verwendung „naturbelassener“<br />
Baustoffe, um durch die Eigenschaften<br />
der eingesetzten Materialien den<br />
Charakter des Bauwerks zu unterstreichen.<br />
So erklärt sich die steigende Beliebtheit<br />
des Sichtbetons als gestalterisches Element,<br />
wobei im Gegensatz zu den schalungsrauen<br />
Sichtbetonoberflächen der<br />
60er Jahre von Auftraggeberseite heute<br />
meist glatte, einheitliche Sichtbetonoberflächen<br />
gefordert werden. Hierbei ist hervorzuheben,<br />
dass diese Forderungen nach<br />
glatten, scharfkantigen, porenfreien und<br />
homogenen Oberflächen technisch sehr<br />
anspruchsvoll sind und oftmals an die<br />
Grenzen des Machbaren führen.<br />
Die Auftragnehmerseite hingegen ist geprägt<br />
vom starken Konkurrenzkampf unter<br />
den ausführenden Bauunternehmen. Bedingt<br />
durch die anhaltende Rezession auf<br />
dem Baumarkt kommt es vor allem im<br />
Bereich des Rohbaus häufig dazu, dass<br />
Aufträge angenommen werden, die durch<br />
knapp kalkulierte Preise und ein hohes<br />
finanzielles Risiko gekennzeichnet sind.<br />
Hinzu kommt, dass vor allem durch die<br />
Auslagerung von gewerblichem Personal<br />
hin zu Nachunternehmern das in den Baufirmen<br />
vorhandene handwerkliche Know-<br />
how bezüglich der sachgerechten Ausführung<br />
von Stahlbetonarbeiten abnimmt.<br />
Dadurch ist auf Auftragnehmerseite teilweise<br />
ein zu geringes Bewusstsein über<br />
die Besonderheiten der Sichtbetontechnologie<br />
zu beklagen.<br />
Diese Konstellation erklärt, warum es immer<br />
häufiger zu Konflikten zwischen Auftraggeber<br />
und Auftragnehmer kommt, bei<br />
denen der Sichtbeton als Streitgegenstand<br />
zur Unzufriedenheit und häufig auch zu<br />
hohem zeitlichen und finanziellen Aufwand<br />
auf beiden Seiten beiträgt.<br />
Ziel der Arbeit<br />
Ziel der Arbeit ist es, zu einer Verminderung<br />
der oben erwähnten Konflikte bei der<br />
Herstellung von Sichtbeton beizutragen.<br />
Dazu beschäftigt sich die Arbeit mit der<br />
Verbesserung der Planungs- und Ausführungsbedingungen<br />
von Sichtbeton <strong>für</strong> ausführende<br />
Unternehmen. Hierzu gehört<br />
u.a.:<br />
• Förderung des Verständnisses über die<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Sichtbetonbauweise,<br />
• Empfehlung geeigneter Materialkombinationen<br />
<strong>für</strong> die Sichtbetonherstellung,<br />
• Schaffung bzw. Verbesserung von Kalkulationsgrundlagen<br />
<strong>für</strong> Sichtbeton,<br />
• stärkere Objektivierung der Beurteilung<br />
von Sichtbetonflächen unter optischen<br />
Gesichtspunkten.<br />
Gegenstand der Forschung<br />
Im Fokus der Forschungsarbeit steht die<br />
Prozessanalyse der Sichtbetonherstellung.<br />
Ziel hierbei ist zunächst die Identifikation<br />
der die Sichtbetonqualität beeinflussenden<br />
Faktoren und deren Auswirkungen auf die<br />
erstellten Sichtbetonflächen. Hierbei wird<br />
sowohl der Einfluss der Ausgangsmaterialien<br />
(z.B. Schalungshaut, Trennmittel,<br />
Frischbeton) als auch der Einfluss der<br />
baustellenspezifischen Rand- und Umweltbedingungen<br />
(z.B. Lage und Größe des<br />
Bauteils, Witterung) untersucht. Außerdem<br />
werden die Arbeitsabläufe bei der<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 53
Herstellung und deren Einfluss auf die<br />
Sichtbetonqualität einer ausführlichen<br />
Analyse unterzogen, mit besonderer Berücksichtigung<br />
der sichtbetonspezifischen<br />
Arbeitsanteile. Schließlich werden auf Basis<br />
der Prozessanalyse REFA-Studien anhand<br />
von Einzel- bzw. Gruppenzeitaufnahmen<br />
<strong>für</strong> sichtbetonrelevante Teilvorgänge<br />
durchgeführt.<br />
Die Auswertung der Untersuchungen ermöglicht<br />
dann zum einen die Empfehlung<br />
54<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
geeigneter Materialkombinationen <strong>für</strong> die<br />
Sichtbetonherstellung. Zusätzlich können<br />
Hilfen <strong>für</strong> eine sachgerechte Ausführung<br />
der Sichtbetonarbeiten abgeleitet werden.<br />
Zum anderen stellen die Ergebnisse der<br />
REFA-Studien eine wesentliche Hilfe bei<br />
der Einschätzung des zeitlichen und finanziellen<br />
Aufwands im Zuge der Kalkulation<br />
dar.
1.3 Simulation in der Bauwirtschaft – Arbeitsgruppe Unikatprozesse<br />
Der Forschungsschwerpunkt Simulation<br />
des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ist in einen<br />
Forschungsverbund Simulation integriert.<br />
Seit <strong>2007</strong> wurden die Ergebnisse und Visionen<br />
im Austausch mit <strong>Institut</strong>en der<br />
Bereiche <strong>Baubetrieb</strong>, Informatik und Geodäsie<br />
sowie Vertretern der Industrie in<br />
regelmäßigen Treffen diskutiert.<br />
Den Auftakt der Initiative bildete die Einladung<br />
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. V. Franz vom<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Bauwirtschaft der Universität<br />
Kassel zum Workshop „Simulation in der<br />
Bauwirtschaft“ am 13. September <strong>2007</strong>.<br />
Das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> nahm dies zum<br />
Anlass, die laufenden Arbeiten zum Thema<br />
Bauprozessdetektion und -simulation<br />
dem Fachpublikum zu präsentieren [1].<br />
Im Anschluss an den Workshop bildete<br />
sich eine Initiative von wissenschaftlichen<br />
Einrichtungen der Bereiche <strong>Baubetrieb</strong>,<br />
Informatik und Geodäsie mit dem Ziel,<br />
Entwicklungen und mögliche Synergien<br />
auf dem Feld der Simulation zu diskutieren.<br />
In zwei weiteren Treffen am 21./22.<br />
September <strong>2007</strong> in Berlin und am 21./22.<br />
Januar 2008 am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> in<br />
Darmstadt wurden die Visionen zur Simulation<br />
von Bauprozessen weiterentwickelt.<br />
Am 31. März 2008 wurde von der Initiative<br />
ein weiterer Workshop zur Simulation von<br />
Bauprozessen in Weimar, „Auf dem Weg<br />
zum digitalen (Bau-)Haus-Bau“, durchgeführt<br />
[2].<br />
Um der Initiative einen formellen Rahmen<br />
zu geben, wurde sie an die Arbeitsgemeinschaft<br />
Simulation (ASIM) der Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Informatik e.V. angegliedert.<br />
Dort bildet sie die „Arbeitsgruppe Unikatprozesse“,<br />
eine von drei aktiven Arbeitsgruppen<br />
der ASIM-Fachgruppe „Simulation<br />
in Produktion und Logistik“ (SPL).<br />
Am 26. Mai <strong>2009</strong> traf sich die Arbeitsgruppe<br />
Unikatprozesse am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong><br />
Bauwirtschaft der Universität Kassel zu<br />
ihrer konstituierenden Sitzung. Dabei wurden<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing. V. Franz und Univ.-<br />
Prof. Dr.-Ing. M.Sc. H. Bargstädt von der<br />
Bauhaus-Universität Weimar, Professur<br />
<strong>Baubetrieb</strong> und Bauverfahren, per Akkla-<br />
mation zum Sprecher bzw. zum stellvertretenden<br />
Sprecher gewählt. Am 15. September<br />
<strong>2009</strong> wurde eine weitere Sitzung<br />
der Arbeitsgruppe Unikatprozesse an der<br />
Bauhaus-Universität in Weimar durchgeführt.<br />
Die Arbeitsgruppe Unikatprozesse beschäftigt<br />
sich mit der ereignisdiskreten<br />
Simulation von Herstellungsprozessen.<br />
Dabei werden nicht nur die Bauindustrie,<br />
sondern auch verwandte Industrien wie<br />
z.B. der Schiffsbau betrachtet. Das verbindende<br />
Glied ist der Unikatcharakter des<br />
herzustellenden Produktes. Begonnen<br />
wurde damit, die Definition von Simulation<br />
herauszuarbeiten. Die Arbeitsgruppe Unikatprozesse<br />
hat sich dabei auf die Definition<br />
des Verbands Deutscher Ingenieure<br />
VDI, wie in der Richtlinie 3633 Blatt 1 in<br />
der jeweils gültigen Fassung festgelegt,<br />
geeinigt. Darin wird Simulation als „[...]<br />
das Nachbilden eines Systems mit seinen<br />
dynamischen Prozessen in einem experimentierfähigen<br />
Modell, um zu Erkenntnissen<br />
zu gelangen, die auf die Wirklichkeit<br />
übertragbar sind“ definiert [3]. Des Weiteren<br />
wird empfohlen, parallel die Definitionen<br />
der REFA – Verband <strong>für</strong> Arbeitsstudien,<br />
Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung<br />
e.V. – heranzuziehen.<br />
Die Arbeitsgruppe wird zu drei Sitzungen<br />
pro Jahr zusammenkommen. Einmal pro<br />
Jahr soll ein öffentlicher Workshop ausgerichtet<br />
werden. Des Weiteren sollen die<br />
ASIM Fachgruppentagungen durch eigene<br />
Sessions ergänzt werden.<br />
Literatur<br />
[1] Motzko, C.; Hinrichs, N.; Mehr, O.; Maffini, S.:<br />
Dokumentation und Simulation von Bauprozessen<br />
mithilfe von Bildverarbeitungssystemen. In:<br />
Simulation in der Bauwirtschaft. Hrsg.: V.<br />
Franz. Kassel: kassel university press Gmb,<br />
<strong>2007</strong>. Schriftenreihe Bauwirtschaft, 1. IBW-<br />
Workshop Simulation in der Bauwirtschaft.<br />
[2] Bargstädt, H. (Hrsg.): Auf dem Weg zum digitalen<br />
(Bau-)haus-Bau. Weimar: Blueprint kopie_druck_medien<br />
gmbh 2008. Schriften der<br />
Professur <strong>Baubetrieb</strong> und Bauverfahren Nr. 17.<br />
[3] VDI-Richtlinie 3633, Blatt 1: Simulation von<br />
Logistik-, Materialfluß- und Produktionssystemen,<br />
Grundlagen. Hrsg.: Verein Deutscher Ingenieure.<br />
1993.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 55
1.4 Preise und Auszeichnungen<br />
1.4.1 GEFMA-Förderpreis 2008 –<br />
Auszeichnung <strong>für</strong> Dr.-Ing. Jörg Klingenberger<br />
Die Dissertation von Herrn Dr.-Ing. Jörg<br />
Klingenberger „Ein Beitrag zur systematischen<br />
Instandhaltung von Gebäuden“ –<br />
ein Modell zur begründeten Bildung von<br />
geeigneten Instandhaltungsstrategien <strong>für</strong><br />
einzelne Gebäudekomponenten wurde im<br />
Mai 2008 durch den Deutschen Verband<br />
<strong>für</strong> Facility Management e.V. mit dem<br />
GEFMA-Förderpreis in der Fachkategorie<br />
Instandhaltung ausgezeichnet.<br />
56<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Abb. 1: Urkunde GEFMA-Förderpreis 2008<br />
Abb. 2: Die Preisträger des GEFMA-Förderpreises 2008, von links: Dr. Jörg Klingenberger: Frank Kiesewetter (<strong>für</strong> Anja Kaps), Peter Steinmayr, Dr. Philip Boll,<br />
Ulli Wörne, Stephan Liedel (Quelle: Uta Mosler, LichtEinfall)
1.4.2 Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ <strong>2009</strong> –<br />
Auszeichnung <strong>für</strong> Dr.-Ing. Jens Elsebach<br />
Die Dissertation von Herrn Dr.-Ing. Jens<br />
Elsebach „Bauwerksinformationsmodelle<br />
mit vollsphärischen Fotografien – Ein Konzept<br />
zur visuellen Langzeitarchivierung von<br />
Bauwerksinformationen“ wurde im Januar<br />
<strong>2009</strong> im Rahmen des Wettbewerbs „Auf<br />
IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ des<br />
Bundesministeriums <strong>für</strong> Wirtschaft und<br />
Technologie mit dem 2. Preis im Bereich<br />
<strong>Baubetrieb</strong>swirtschaft ausgezeichnet.<br />
Abb. 1: Urkunde Wettbewerb <strong>2009</strong> Auf IT gebaut – Bauberufe mit<br />
Zukunft<br />
Abb. 2: Die Verleihung des 2. Preises im Wettbewerb Auf IT gebaut, von links: Prof. Dr. Joaquin Diaz (Präsident Bundesverband Bausoftware e.V.), Dr. Jens<br />
Elsebach, Hartmut Schauerte (Staatssekretär beim BMWi) (Quelle: RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V.)<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 57
1.5 Kooperationen<br />
1.5.1 Summer School 2008 des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> und<br />
der Tongji University Shanghai<br />
Seit dem Jahr 1980 existiert eine durch<br />
ein Abkommen formalisierte Kooperation<br />
zwischen der Tongji University Shanghai<br />
und der TU Darmstadt. Diese Kooperation<br />
ist u.a. auf die Verbundenheit des ehemaligen<br />
Rektors der Tongji University, Herrn<br />
Prof. Li Guohao, zurückzuführen, der seinerzeit<br />
an der TH Darmstadt bei Herrn<br />
Prof. Klöppel (Bauingenieurwesen) promoviert<br />
und habilitiert hat.<br />
Die Verbindung zwischen der Tongji University<br />
und der TU Darmstadt wurde um<br />
ein neues Element bereichert. Im Zeitraum<br />
vom 29. August 2008 bis zum 2.<br />
September 2008 hat Herr Prof. Motzko<br />
auf Einladung der Herren Prof. Dr.-Ing.<br />
Ding Shizhao (1985 Promotion an der TH<br />
Darmstadt bei Herrn Prof. Schwarz), Prof.<br />
Dr.-Ing. Gao Xin sowie Prof. Dr.-Ing. Chen<br />
Jianguo sowie unter der ideellen Unterstützung<br />
der Vereinigung der Freunde der<br />
Abb. 1: Prof. Motzko im Kreis der Teilnehmer der Summer School 2008 an der Tongji University in Shanghai<br />
58<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Tongji Universität e.V. eine fünftägige<br />
Summer School zum Thema „Arbeitssicherheit<br />
im Bauwesen in der Bundesrepublik<br />
Deutschland“ durchgeführt.<br />
Das Thema wurde aus Gründen der besonderen<br />
Aktualität <strong>für</strong> die Volkswirtschaft<br />
und die Bauwirtschaft der Volksrepublik<br />
China gewählt.<br />
Innerhalb der fünf Tage wurden von Prof.<br />
Motzko 40 Vorlesungseinheiten sowie ein<br />
Workshop mit dem Schwerpunkt „Verantwortung<br />
des Bauherrn <strong>für</strong> die Arbeitssicherheit<br />
in der Europäischen Union“<br />
absolviert. Die etwa 40 chinesischen Teilnehmer<br />
rekrutierten sich aus dem Bereich<br />
der öffentlichen Bauverwaltung, der Bauindustrie<br />
sowie der Wissenschaft.<br />
Die ausgesprochen positive Resonanz auf<br />
die Summer School führte im Ergebnis zur<br />
Vereinbarung einer Fortsetzung.
Abb. 2: Bild mit dem Hauptinitiator: Prof. Shizhao Ding, Prof. Motzko<br />
Abb. 3: Bild mit den Gastgebern (v. l. n. r) Ass. Prof. Hu Wenfa, Master Cand. Danny Cong, Master Cand. Henry Lang, Dipl.-Ing. Zhou Xing, Gao Junior<br />
(Kleiner Kaiser☺), Prof. Motzko, Prof. Gao, Frau Gao, Prof. Chen<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 59
1.5.2 Kooperationsabkommen zwischen dem Research <strong>Institut</strong>e of Project<br />
Administration and Management der Tongji University Shanghai und<br />
dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
Aus Anlass des Besuches der Vertreter<br />
des Research <strong>Institut</strong>e of Project Administration<br />
and Management der Tongji<br />
University Shanghai (VR China) am <strong>Institut</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der TU Darmstadt wurde<br />
am 5. Dezember 2008 ein Kooperationsabkommen<br />
unterschrieben. Herr Prof. Dr.<br />
Chen Jianguo, Herr Prof. Dr.-Ing. Christoph<br />
Motzko sowie Herr Ltd. Ministerialrat<br />
60<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
a.D. Dietrich Blankenburg als Vorsitzender<br />
der Vereinigung der Freunde der Tongji<br />
University haben das Kooperationsabkommen<br />
unterzeichnet. Damit wird die<br />
fruchtbare Zusammenarbeit der Kooperationspartner<br />
statuiert, die mit der Durchführung<br />
der Summer School 2008 durch<br />
Herrn Prof. Motzko an der Tongji University<br />
begonnen hat.<br />
Abb. 1: (v. r. n. l.) Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko, Prof. Dr. Gao Xin, Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Linke (Dekan), Prof. Dr. Chen Jianguo, M.Sc. Zhou Xing
1.5.3 Verleihung des Titels Advisory Professor der Tongji University<br />
Shanghai an Prof. Motzko<br />
Die Zusammenarbeit zwischen der School<br />
of Economics & Management der Tongji<br />
University und dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
wurde im Jahr <strong>2009</strong> intensiv fortgesetzt.<br />
Prof. Motzko hat im Monat November<br />
Seminare mit Doktoranden und Studierenden<br />
in Shanghai durchgeführt sowie<br />
ein Treffen mit Vertretern von Bauindustrie<br />
und Immobilienwirtschaft absolviert.<br />
Die Bauwirtschaft Chinas befindet sich,<br />
trotz der weltweiten Krise, im Stadium<br />
eines stetigen Wachstums.<br />
Im Rahmen eines Festaktes wurde Herrn<br />
Prof. Motzko von Herrn Prof. Chen Xiao<br />
Long, dem Vizepräsidenten der Tongji<br />
University, sowie Herrn Prof. Ph.D. Huo<br />
Abb. 1: Vizepräsident Prof. Chen Xiao Long (mitte), Dean Prof. Huo Jia-Zhen (links), Prof. Motzko<br />
Abb. 2: Vizepräsident Prof. Chen Xiao Long verleiht die Urkunde an Prof. Motzko<br />
Jia-Zhen, dem Dean der School of Economics<br />
& Management der Titel „Advisory<br />
Professor“ verliehen.<br />
Im Anschluss wurden intensive Gespräche<br />
mit den zuständigen Professoren,<br />
Herrn Prof. Chen Jianguo, Herrn Prof. Gao<br />
Xin sowie Herrn Prof. Ding Shizhao über<br />
die Curricula in Shanghai und Darmstadt<br />
geführt.<br />
Die Kooperation wird mit einer Summer<br />
School 2010 sowie mit einem Studierenden-<br />
und Wissenschaftleraustausch fortgesetzt.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 61
1.5.4 Kompetenzzentrum Bürgerhäuser<br />
Zur Erfüllung kommunaler Aufgaben müssen<br />
entsprechende Räume bereit gestellt<br />
werden, daher verfügt die öffentliche<br />
Hand über ein beachtliches Immobilienportfolio.<br />
Ein bedeutendes Element innerhalb<br />
dieses Portfolios sind Bürgerhäuser.<br />
Sie stellen ein wichtiges Element der Daseinsvorsorge<br />
im Rahmen der kommunalen<br />
Selbstverwaltung dar. Angesicht der<br />
angespannten Lage der öffentlichen<br />
Haushalte bedarf es jedoch ganzheitlicher<br />
Betrachtungen der Immobilienbestände,<br />
insbesondere auch der Bürgerhäuser, um<br />
Optimierungspotenziale in Bezug auf die<br />
grundsätzliche Struktur sowie den Betrieb<br />
dieser Gebilde erschließen zu können.<br />
In Kooperation mit der Nassauischen<br />
Heimstätte gründete das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
der TU Darmstadt im Jahr 2008<br />
das Kompetenzzentrum „Bürgerhäuser“.<br />
Der Name ist patentrechtlich geschützt.<br />
Die Akquisition von Gemeinschaftsprojekten<br />
mit Kommunen verlief sehr gut. Im<br />
September 2008 lagen die Ergebnisse<br />
einer ersten Studie <strong>für</strong> eine Kommune<br />
mittlerer Größe vor, bei der sich die Subventionen<br />
<strong>für</strong> die drei dort anzutreffenden<br />
Bürgerhäuser auf rund 300.000 Euro jährlich<br />
beliefen. In der Studie wurden die<br />
Bürgerhäuser aus unterschiedlichen Perspektiven<br />
betrachtet. Das Spektrum reichte<br />
von Aspekten der Stadtentwicklung bis<br />
hin zu einer detaillierten Kostenanalyse<br />
der Betriebsprozesse dieses speziellen<br />
Immobilientypus unter Anwendung der<br />
Prozesskostenrechnung. Auf dieser<br />
Grundlage konnte <strong>für</strong> jedes Bürgerhaus<br />
ein Chancen- und Risikoprofil erarbeitet<br />
werden, welches in das abschließende<br />
Strategiepaket eingeflossen ist. Dabei<br />
wurden zum einen konkrete Entwicklungsziele<br />
<strong>für</strong> die Bürgerhäuser in Abstimmung<br />
mit der Kommune festgelegt,<br />
zum anderen wurden weiterreichende<br />
Entwicklungsszenarien aufgezeigt. Die<br />
62<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
angefertigte Studie bildet eine wichtige<br />
Grundlage in der politischen Diskussion<br />
über die Weiterentwicklung der Kommune.<br />
Am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> begann die<br />
Entwicklung des Forschungsfeldes „Bürgerhäuser“<br />
im Jahr 2005 mit der Anfertigung<br />
der Dissertation von Frau Dr.-Ing<br />
Julia Schultheis zum Thema „Public Private<br />
Partnership bei Stadthallen – Rahmenbedingungen<br />
und Gestaltungsmöglichkeiten<br />
in Deutschland“. Im Ergebnis wurden<br />
vier PPP-Grundmodelle mit diversen Untervarianten,<br />
inklusive beispielhaften Vertrags-<br />
und Organisationsstrukturen, entwickelt.<br />
Im Kontext dieser Arbeit stellte Prof.<br />
Motzko im Rahmen der Round-Table-<br />
Veranstaltung „PPP und Stadthallen“ des<br />
Vereins PPP in Hessen e.V. im September<br />
<strong>2009</strong> einzelne Untersuchungsergebnisse<br />
des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> aus dem Forschungsgebiet<br />
„Bürgerhäuser“ vor. Die<br />
gezeigten Studien trafen bei den Teilnehmern<br />
auf großes Interesse. Der Vorsitzende<br />
des Vereins PPP in Hessen e.V., Herr<br />
Landrat Walter, sprach in diesem Zusammenhang<br />
von „einer guten Praxishilfe <strong>für</strong><br />
die kommunalen Entscheidungsträger“.<br />
Herr Gerrit Kaiser, geschäftsführender<br />
Direktor des Hessischen Landkreistages,<br />
möchte das Kompetenzzentrum „Bürgerhäuser“<br />
deshalb stärker in den kommunalen<br />
Gremien bekannt machen. Veranstaltungen<br />
und Workshops der kommunalen<br />
Spitzenverbände könnten hier Informationsdefizite<br />
beseitigen.<br />
Weitere Kommunen haben bereits die<br />
Dienstleistungen des neu gegründeten<br />
Kompetenzzentrums „Bürgerhäuser“ angefragt.<br />
Gemeinsam mit der Nassauischen<br />
Heimstätte leistet das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Baubetrieb</strong> der TU Darmstadt somit einen<br />
wichtigen Beitrag zur Optimierung des<br />
Immobilienportfolios der öffentlichen<br />
Hand und damit zur nachhaltigen Verbesserung<br />
der ökonomischen Situation der<br />
Kommunen in Deutschland.
2 Tagungen<br />
2.1 22. Treffen der Universitätsprofessoren <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft und<br />
Bauverfahrenstechnik <strong>2007</strong><br />
Das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> war Veranstalter<br />
des 22. Treffens der Universitätsprofessoren<br />
<strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft<br />
und Bauverfahrenstechnik vom 20. bis 22.<br />
September <strong>2007</strong>.<br />
Den Auftakt bildete ein Abendessen im<br />
Jagdschloss Kranichstein. Der Gastgeber<br />
dieses Abends, Herr Prof. Hans Helmut<br />
Schetter, Vorstandsmitglied der Bilfinger<br />
Berger AG sowie Honorarprofessor an<br />
unserem <strong>Institut</strong>, lieferte einen sehr interessanten<br />
Vortrag zum Zustand der deutschen<br />
Bauindustrie.<br />
Am Folgetag, nach der Begrüßung durch<br />
den Studiendekan des Fachbereichs<br />
Bauingenieurwesen und Geodäsie der TU<br />
Darmstadt, Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rolf<br />
Katzenbach, stellte Herr Univ.-Prof. Dr.-<br />
Ing. Christoph Motzko das <strong>Institut</strong> in Forschung<br />
und Lehre vor. Danach wurden<br />
unter der Moderation des Sprechers der<br />
BBB-Professorenschaft, Herrn Univ.-Prof.<br />
Dr.-Ing. Gerhard Girmscheid von der ETH<br />
Zürich, aktuelle Themen diskutiert. Hierzu<br />
Abb. 1: Universitätsprofessoren <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft und Bauverfahrenstechnik<br />
wurden u.a. folgende Impulsvorträge geleistet:<br />
• Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Alfen:<br />
Internationale Aktivitäten der BBB-<br />
Lehrstühle und deren Sichtbarkeit,<br />
• Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner:<br />
Abgrenzung des Lehr- und Forschungsbereichs<br />
<strong>Baubetrieb</strong> und Bauwirtschaft<br />
zur Immobilienwirtschaft,<br />
• Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerhard Girmscheid:<br />
International Council for Research and<br />
Innovation in Building and Construction,<br />
• Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla:<br />
Bachelor- und Master-Studiengänge<br />
Bauingenieurwesen,<br />
• Univ.-Prof. DI Dr. techn.<br />
Arnold Tautschnig:<br />
Einordnung, Abgrenzung und Zusammenarbeit<br />
mit dem Immobiliensektor.<br />
Zum Ausklang der Tagung am Samstag<br />
wurde bei herrlichem Sonnenschein eine<br />
Wanderung durch den Staatspark Fürstenlager<br />
an der Bergstraße durchgeführt und<br />
eine Brotzeit eingenommen.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 63
Abb. 1: Wanderung und Brotzeit im Staatspark Fürstenlager an der Bergstraße<br />
2.2 19. Treffen der Universitätsassistenten der Bereiche <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft<br />
und Bauverfahrenstechnik 2008<br />
Vom 02. bis 04. April 2008 richtete das<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> das 19. Treffen der<br />
Universitätsassistenten der Bereiche <strong>Baubetrieb</strong>,<br />
Bauwirtschaft und Bauverfahrenstechnik<br />
an der TU Darmstadt aus.<br />
Rund 50 Teilnehmer der Lehrstühle aus<br />
Deutschland und Österreich, ein spannendes<br />
Programm mit wissenschaftlichen und<br />
baupraktischen Akzenten, die Möglichkeit<br />
zum informellen Austausch der Assistenten<br />
sowie eine anregende Atmosphäre<br />
machten den Erfolg dieser Veranstaltung<br />
aus.<br />
Nach der Begrüßung durch Professor<br />
Motzko standen am Mittwochnachmittag<br />
zuerst folgende Fachvorträge zu Forschungsprojekten<br />
der Teilnehmer auf dem<br />
Programm:<br />
• Eser, Bernd (Universität Wuppertal):<br />
Entscheidungsmodell <strong>für</strong> die Planungsoptimierung<br />
zur Erzielung nachhaltig<br />
hoher Immobilienwerte,<br />
• Jurecka, Andreas (TU Wien):<br />
Nachhaltigkeit von Brücken,<br />
• Maier, Christian (TU Wien):<br />
Berufsbild Bauingenieur/-in (Abb. 1).<br />
Anschließend erfolgte eine Besichtigung<br />
der Stadt Frankfurt/Main, bei der insbesondere<br />
die spektakulären Bauwerke des<br />
Bankenviertels und des Messegeländes<br />
sowie die Neuentwicklung des Europaviertels<br />
im Mittelpunkt standen. Mit einem<br />
gemeinsamen Abendessen im Darmstädter<br />
Ratskeller klang der erste Tag aus.<br />
64<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Abb. 1: Fachvortrag von Christian Maier (TU Wien)<br />
Der Donnerstag startete mit einem zweiten<br />
Block von folgenden Fachvorträgen<br />
der Teilnehmer:<br />
• Kaiser, Jörg (TU Darmstadt):<br />
Lean Construction – Prozess- und Organisationsoptimierung<br />
durch Einführung<br />
von schlanken Prinzipien und KVP,<br />
• Loskant, Denis (RWTH Aachen):<br />
Der wettbewerbliche Dialog im Kontext<br />
der Partnerschaftsmodelle,<br />
• Seyffert, Stefan (TU Dresden):<br />
Forschungsvorhaben zum Einsatz der<br />
RFID-Technologie im Bauwesen.<br />
Im Anschluss erfolgte durch den Auftragnehmer<br />
Ed. Züblin AG eine Vorstellung<br />
und Besichtigung des Bauvorhabens<br />
Opernturm in Frankfurt am Main. Dieses<br />
ca. 170 m hohe Gebäude wird zusammen<br />
mit der Randbebauung nach seiner Errichtung<br />
ca. 60.000 m² Mietfläche aufweisen.<br />
Eine besondere Erfahrung <strong>für</strong> die Teilnehmer<br />
dieser Exkursion war das Erleben<br />
der Schalungs-, Bewehrungs- und Betonageprozesse<br />
dieses Hochhauses.
Abb. 2: Gruppenfoto vor der Baustelle Opernturm<br />
Abb. 3: Schalung der Kernbereiche auf der Baustelle Opernturm<br />
Der kulturelle Teil am Nachmittag beinhaltete<br />
eine Führung über die Mathildenhöhe<br />
und durch die Innenstadt Darmstadts.<br />
Abb. 4: Gruppenfoto auf der Baustelle AIRRAIL Center<br />
Den Abschluss der Veranstaltung bildete<br />
am Freitagvormittag eine zweite Baustellenexkursion:<br />
der Besuch des Bauvorhabens<br />
AIRRAIL Center – die Überbauung<br />
des Fernbahnhofs am Flughafen Frankfurt<br />
am Main. Diese Multifunktionsimmobilie<br />
(Hotels, Büroflächen, Ladengeschäfte und<br />
Gastronomie) auf dem Dach des Fernbahnhofs<br />
weist beeindruckende Kennzahlen<br />
auf: 660 m Länge, 65 m Höhe und<br />
eine Mietfläche von 139.100 m².<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 65
2.3 Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar<br />
Neben der Tätigkeit des <strong>Institut</strong>s in Lehre<br />
und Forschung wird seit 1985 durch den<br />
Förderverein des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
der TU Darmstadt e.V. das Darmstädter<br />
<strong>Baubetrieb</strong>sseminar angeboten. Diese<br />
Weiterbildungsveranstaltung behandelt<br />
Themen im Grenzbereich zwischen Baurecht<br />
und <strong>Baubetrieb</strong> und hat großen Zuspruch<br />
seitens der externen Zielgruppen<br />
der Bauunternehmungen, Auftraggeber<br />
sowie Architekten, Beratenden Ingenieure<br />
und Juristen. Es finden jährlich zwei Seminare<br />
mit einer begrenzten Zahl von 90<br />
bis 100 Teilnehmern statt. In den Jahren<br />
66<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
<strong>2007</strong> bis <strong>2009</strong> wurden folgende Veranstaltungen<br />
durchgeführt:<br />
• 02./03. Februar <strong>2007</strong><br />
„Spekulative Preise bei Vergabe und<br />
Nachtrag“,<br />
• 16./17. November <strong>2007</strong> &<br />
15./16. Februar 2008<br />
„Aktuelle Nachtragsprobleme“,<br />
• 21./22. November 2008 &<br />
13./14. Februar <strong>2009</strong><br />
„Nachtragskalkulation“,<br />
• 20./21. November <strong>2009</strong><br />
„Bauzeitnachträge und Produktivitätsverluste“.<br />
2.4 GSV-TUD-Fachtagung 2008 „Gefährdungsbeurteilung in der Praxis“<br />
Gemeinsam mit dem Güteschutzverband<br />
Betonschalungen e.V. veranstaltet das<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> seit 2006 jährlich<br />
eine Fachtagung zu aktuellen technischen<br />
Problemen der Bauausführung.<br />
Mit etwa 80 Teilnehmern aus Deutschland,<br />
Österreich, Polen und der Schweiz<br />
wurde am 28. Februar 2008 die GSV-TUD-<br />
Fachtagung „Gefährdungsbeurteilung in<br />
der Praxis“ in Darmstadt durchgeführt.<br />
Anlass zu diesem Themenkomplex war<br />
sowohl die hohe Praxisrelevanz als auch<br />
die Publikation des GSV unter dem Titel<br />
„Empfehlungen zur Anfertigung einer Gefährdungsbeurteilung<br />
bei der Anwendung<br />
von Schalungen“. Diese Publikation ist<br />
über die Homepage des GSV (www.gsvbetonschalungen.de)<br />
verfügbar. Folgende<br />
Referenten haben vorgetragen:<br />
• RA Dr. Ralf Steding<br />
(Kapellmann und Partner)<br />
Herr Dr. Steding hat in seinem Referat<br />
die rechtliche Bedeutung der Gefährdungsbeurteilung<br />
dargelegt. Der Arbeitgeber<br />
besitzt eine umfangreiche zivilrechtliche<br />
und öffentlich-rechtliche<br />
Verpflichtung zum Arbeitsschutz. Der<br />
Grundsatz heißt dabei, die Gefährdung<br />
des Arbeitnehmers zu vermeiden.<br />
Demnach ist der Arbeitgeber verpflichtet,<br />
Maßnahmen des Arbeitsschutzes<br />
zu bestimmen, welche aus einer Beur-<br />
teilung der Gefährdung von Beschäftigten<br />
im Zuge der Verrichtung von Arbeiten<br />
resultieren. Die Wirksamkeit der<br />
Arbeitsschutzmaßnahmen ist zu überprüfen.<br />
Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung<br />
und die getroffenen<br />
Schutzmaßnahmen sind zu dokumentieren.<br />
Damit bildet die Gefährdungsbeurteilung<br />
ein wichtiges Element des<br />
Risikomanagementsystems eines Unternehmens.<br />
Die rechtlichen Risiken,<br />
die mit dem Komplex der Gefährdungsbeurteilung<br />
verbunden sind, können<br />
nicht vollständig ausgeschaltet, jedoch<br />
durch strikte Befolgung der behördlichen<br />
Verordnungen, die Anwendung<br />
von branchenspezifischen Handlungshinweisen<br />
und die individuelle<br />
Anpassung an die Randbedingungen<br />
der jeweiligen Baustelle reduziert werden.<br />
• Dipl.-Ing. Thomas Vogel (BG Bau)<br />
Herr Dipl.-Ing. Vogel hat in seinen Ausführungen<br />
zunächst darauf hingewiesen,<br />
dass die Gefahren <strong>für</strong> die Gesundheit<br />
in den Arbeitsprozessen möglichst<br />
an ihrer Quelle zu bekämpfen und die<br />
Maßnahmen so zu planen sind, dass<br />
Technik, Arbeitsorganisation, weitere<br />
Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen<br />
und Umweltparameter sachgerecht<br />
verknüpft werden. Im Schwer-
punkt wurde der grundsätzliche Ablauf<br />
einer Gefährdungsbeurteilung erläutert,<br />
mit Beispielen belegt, die elektronischen<br />
Arbeitshilfen der BG Bau (Kompendium<br />
Arbeitsschutz einschließlich<br />
der Gefährdungsbeurteilung mit dem<br />
BG-BAU-Wegweiser) vorgestellt und<br />
zur Anwendung empfohlen. Es wurde<br />
darauf hingewiesen, dass bei der Aufstellung<br />
einer Gefährdungsbeurteilung<br />
die Beratung der zuständigen Berufsgenossenschaft<br />
respektive der zuständigen<br />
staatlichen Arbeitsschutzbehörde<br />
hinzugezogen werden kann.<br />
• Dipl.-Ing. Günther Schaub<br />
(HOCHTIEF Construction AG)<br />
Die Ausführungen von Herrn Dipl.-Ing.<br />
Schaub haben bestätigt, dass die Bauwirtschaft<br />
sich auf dem Weg der Im-<br />
Abb. 1: (v. r. n. l.) RA Dr. R. Steding, Dipl.-Ing. T. Vogel, Dipl.-Ing. G. Schaub<br />
Abb. 2: (v. r. n. l.) Dr.-Ing. R. Hertle, Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. R. Fuchs<br />
• Dr.-Ing. Robert Hertle<br />
(Hertle Ingenieure)<br />
Im Referat von Herrn Dr. Hertle wurde<br />
an Versagensbeispielen im Traggerüstbau<br />
die Bedeutung der Kontrolle der<br />
Herstellprozesse auf der Baustelle im<br />
Sinne der Durchgängigkeit von den<br />
Planungsprozessen bis zu den Ausführungsprozessen<br />
aufgezeigt. Kleine Ursache<br />
– große Wirkung; so können die<br />
Beispiele kommentiert werden, in de-<br />
plementierung der Anforderungen,<br />
welche aus der neuen Situation des<br />
Arbeitsschutzes resultieren, befindet,<br />
jedoch der Status nicht vollständig zufriedenstellend<br />
ist. Die HOCHTIEF AG<br />
hat die Unternehmenseinheit AGUS<br />
Center gegründet, welche sowohl unternehmensintern<br />
als auch externen<br />
Kunden Leistungspakete im Bereich<br />
des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes<br />
bietet. Anhand von plakativen<br />
Beispielen wurden verschiedene<br />
reale Baustellensituationen sowie dazugehörigeGefährdungsbeurteilungsdokumentationen<br />
erläutert. Besonders<br />
wichtig war der Hinweis zur Gefahrenerkennung<br />
im Planungsprozess.<br />
nen häufig winzige Unachtsamkeiten<br />
zum Bauteilversagen führen. Die Bedeutung<br />
der Gefährdungsbeurteilung<br />
im Zusammenwirken mit der bewährten<br />
Kontrollfunktion unabhängiger Instanzen<br />
(so der Prüfingenieure) wurde<br />
deutlich.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 67
• Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.<br />
Rainer Fuchs (Meva)<br />
Stellvertretend <strong>für</strong> die Mitglieder des<br />
Güteschutzverbandes Betonschalungen<br />
e.V. hat Herr Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-<br />
Ing. Fuchs die Entwicklung neuer Schalungsprodukte<br />
vorgestellt und den Einfluss<br />
der neuen Anforderungen des Arbeitsschutzes<br />
auf diesen Entwicklungsprozess<br />
herausgearbeitet. Es ist<br />
erkennbar, dass die neuen Produkte in<br />
bester Weise den neuen Anforderungen<br />
Rechnung tragen. Besonders herauszustellen<br />
ist die Einbindung der BG<br />
Bau in diesen Prozess. Zu bemängeln<br />
ist die Baustellenpraxis, in der die gelie-<br />
68<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
ferten Arbeitsschutzkomponenten der<br />
Schalungen aus Kostengründen nicht<br />
immer eingesetzt werden.<br />
• Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br />
Christoph Motzko<br />
(GSV/<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong>)<br />
Herr Prof. Motzko hat die Bedeutung<br />
der Gefährdungsbeurteilung aus der<br />
Sicht des GSV dargelegt und die GSV-<br />
Publikation „Empfehlungen zur Anfertigung<br />
einer Gefährdungsbeurteilung bei<br />
der Anwendung von Schalungen“ in<br />
den vorliegenden Fassungen erläutert.<br />
2.5 GSV-TUD-Fachtagung <strong>2009</strong> „Neue Normen im Bauwesen“<br />
Am 12. März <strong>2009</strong>, wurde an der Technischen<br />
Universität Darmstadt die jährliche<br />
GSV-TUD-Fachtagung mit dem Titel<br />
„Neue Normen im Bauwesen“ durchgeführt.<br />
Mit etwa 80 Teilnehmern aus<br />
Deutschland, Österreich, Schweiz und<br />
Polen wurden folgende Themen behandelt:<br />
Dipl.-Ing. Raymund Böing<br />
„Entwicklungen im Betonbereich“<br />
• Verschiebung der Marktanteile in Richtung<br />
leicht verarbeitbarer Betone im<br />
Bereich des Transportbetons.<br />
• Technologie der Mikrohohlkugeln als<br />
Ersatz <strong>für</strong> klassische Luftporenbildner<br />
in der Frischbetonproduktion.<br />
• Einführung der DAfStb-Richtlinie<br />
„Stahlfaserbeton“.<br />
• Neue Technologie der Reparatur im<br />
Straßenbau.<br />
• Ökologische Betone durch Photokatalyse.<br />
RA Dr. Ralf Steding<br />
„Aktuelle Rechtsprechung im Baubereich“<br />
• BGH, 18.12.2008 VII ZR 201/06. Nichtigkeit<br />
eines Rechtsgeschäftes bei Verstoß<br />
gegen gute Sitten.<br />
• BGH, 23.10.2008 VII ZR 64/07. Der AN<br />
trägt die Beweislast <strong>für</strong> die Mangelfreiheit<br />
seiner Leistung vor der Abnahme.<br />
Liegt eine Ersatzvornahme vor, die unzureichend<br />
vom AG dokumentiert wur-<br />
de, kann darin eine Beweisvereitelung<br />
vorliegen (der NU hatte keine Möglichkeit<br />
an der Mangelfeststellung teilzunehmen).<br />
• In der Diskussion über die Lieferung<br />
einer Schalung <strong>für</strong> Sichtbeton wird<br />
empfohlen, den Liefervorgang auf die<br />
Baustelle (Empfang der Schalung) sorgfältig<br />
zu dokumentieren.<br />
Dipl.-Ing. Manfred Rathfelder<br />
„Abgrenzung DIN 4421 – DIN 12812“<br />
• Klassifikation von Traggerüsten.<br />
• Einwirkungen – u.a. Windlasten, Berücksichtigung<br />
der Abminderungsfaktoren<br />
bei Windlasten.<br />
• Prognose über die Aufnahme der neuen<br />
Norm in die Bauregelliste.<br />
Dr.-Ing. Olaf Leitzbach<br />
„Lastaufnahmemittel“<br />
• Historie und Definition von Lastaufnahmemitteln.<br />
• Lastaufnahmemittel im Kontext der<br />
geltenden Gesetzgebung im Bereich<br />
der Arbeitssicherheit.<br />
• Kennzeichnung und Prüfung der Lastaufnahmemittel.<br />
Dipl.-Ing. Helmut Schuon<br />
„Frischbetonruck bei fließfähigen Betonen<br />
– Erfahrungsbericht“<br />
• Problematik der normativen Erfassung<br />
fließfähiger Betone, die Forschungsergebnisse<br />
und den Entwurf der novel-
lierten DIN 18218 „Frischbetondruck<br />
bei lotrechten Schalungen“.<br />
• Ergebnisse von Baustellenmessungen.<br />
• Frischbetondruck und Auftrieb bei geneigten<br />
Schalungen.<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko<br />
„Maßtoleranzen im Hochbau“<br />
• Novellierung der DIN 18202 und die<br />
damit verbundene Begrifflichkeit.<br />
Abb. 1: (v. r. n. l.) Dipl.-Ing. Raymund Böing, RA Dr. Ralf Steding, Dipl.-Ing. Manfred Rathfelder<br />
Abb. 2: (v. r. n. l.) Dipl.-Ing. Helmut Schuon, Dr.-Ing. Olaf Leitzbach, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko<br />
• Toleranzen im Hochbau – Anwendungen.<br />
• Kompatibilität der Toleranzen verschiedener<br />
Gewerke im Hochbau.<br />
Der GSV und das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
bedanken sich bei den Referenten <strong>für</strong> die<br />
hochkarätigen Beiträge.<br />
2.6 Kassel-Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar Schalungstechnik<br />
Das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> fungiert seit<br />
2001 als Mitveranstalter des Kasseler<br />
<strong>Baubetrieb</strong>sseminars Schalungstechnik.<br />
Diese Weiterbildungsveranstaltung <strong>für</strong><br />
Auftraggeber, Architekten und Fachplaner,<br />
Auftragnehmer, Bauleiter und Arbeitsvorbereiter<br />
findet in Kassel statt und vermittelt<br />
mit sehr gutem Erfolg die neuesten<br />
Entwicklungen und Tendenzen in der<br />
Schalungstechnik sowie der allgemeinen<br />
Bautechnik des deutschsprachigen<br />
Raums.<br />
Im Berichtszeitraum wurden folgende<br />
Seminare durchgeführt:<br />
• 27./28. September <strong>2007</strong><br />
Schalungstechnik, Gefährdungsbeurteilung,<br />
Sichtbeton, Betontechnologie,<br />
Bauvertragsrecht, Baulogistik,<br />
• 15./16. Februar 2008<br />
Baurecht, Bauausführung und Kraneinsatz,<br />
Transpondertechnik, Schalungstechnik<br />
und Sichtbeton, Unternehmensplanung,<br />
• 19./20. November <strong>2009</strong><br />
Baurecht, Schalungstechnik, Arbeitsvorbereitung,<br />
Wettbewerb der Massivbauweisen.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 69
2.7 Graz-Darmstädter Intensivseminar Sichtbeton<br />
Das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> und Bauwirtschaft<br />
der TU Graz und das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Baubetrieb</strong> der TU Darmstadt veranstalten<br />
seit 2008 jährlich gemeinsam ein Intensivseminar<br />
Sichtbeton als Weiterbildungsveranstaltung<br />
<strong>für</strong> Architekten und Ingenieure,<br />
Ausschreibende, Kalkulanten, Arbeitsvorbereiter<br />
und Bauleiter, die Bauaufsicht,<br />
Sachverständige und Schalungshersteller.<br />
Im Berichtszeitraum wurden zu folgenden<br />
Terminen Seminare durchgeführt:<br />
• 23.-25. Januar 2008,<br />
• 29.-30. Januar <strong>2009</strong>.<br />
2.8 Sonstige Veranstaltungen<br />
2.8.1 Land der Ideen<br />
Unter dem Titel „Land der Ideen“, einer<br />
Initiative, die durch die Bundesregierung<br />
und die Wirtschaft, vertreten durch den<br />
Bundesverband der Deutschen Industrie<br />
(BDI) und führende Unternehmen getragen<br />
wird, fand am 6. Juli <strong>2007</strong> eine Veran-<br />
70<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Themen dieser Veranstaltungen waren:<br />
• Bauvertrag und Sichtbeton,<br />
• Ausführung – Schalarbeiten, Bewehrungsarbeiten,<br />
Betonarbeiten,<br />
• Abnahme von Sichtbeton,<br />
• Wechselwirkungen zwischen Schalungshaut,<br />
Trennmittel und Beton,<br />
• Beton <strong>für</strong> Sichtbeton,<br />
• Sachverständige und Sichtbeton,<br />
• Entwicklungspotential bei Sichtbeton<br />
sowie<br />
• Forschungsergebnisse und Auswirkungen<br />
<strong>für</strong> die Praxis.<br />
staltung in Dreieich statt, bei der das <strong>Institut</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> mit einem Infostand im<br />
„Haus des Lebenslangen Lernens“ vertreten<br />
war zum Thema „Lehre und Studium<br />
an der TU Darmstadt“.<br />
2.8.2 VDI Fachtagung „Verfahrenstechnik im Ingenieurbau“<br />
Am 19. und 20. Februar 2008 veranstaltete<br />
das VDI Wissensforum unter der fachlichen<br />
Trägerschaft der VDI-Gesellschaft<br />
Bautechnik (VDI-Bau) die zweite Fachtagung<br />
„Verfahrenstechnik im Ingenieurbau“<br />
in Darmstadt. Ideelle Mitträger der<br />
Fachtagung waren das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
der TU Darmstadt, der Güteschutzverband<br />
Betonschalungen (GSV) und der<br />
Verband Beratender Ingenieure (VBI).<br />
Namhafte Referenten aus Ingenieur- und<br />
Planungsbüros, aus Bauunternehmen,<br />
Wissenschaftler von Hochschulen und<br />
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen<br />
sowie Behördenvertreter und Aufsichtspersonen<br />
informierten die Teilnehmer<br />
über den neuesten Stand der Technik und<br />
der nationalen als auch internationalen<br />
Regelsetzung auf den Gebieten der Trag-<br />
gerüste, der Schalungen sowie der Arbeits-<br />
und Schutzgerüste. Anhand zahlreicher<br />
Planungs- und Ausführungsbeispiele<br />
wurden die Produkte und die Dienstleistungen<br />
der Branche aufgezeigt. Ein besonderer<br />
Schwerpunkt lag im Bereich der<br />
Arbeitssicherheit.<br />
Folgende Referenten haben vorgetragen:<br />
• R. Hertle<br />
„Europäische Normen und technische<br />
Regeln im Arbeits- und Schutzgerüst-<br />
und im Traggerüstbau“<br />
• H. Steiger<br />
„Praxisberichte über die durchgeführte<br />
Gerüstkontrollen – von der Mängelanzeige<br />
bis zum Schadensfall“<br />
• A. Mertinaschk<br />
„Köröshegy Viadukt“
• M. Steinkühler<br />
„Obenlaufende Vorschubrüstung am<br />
Beispiel der Bauwerke 3, 4 und 5 der 2.<br />
Strelasundquerung“<br />
• M. Lethe<br />
„Arbeitssicherheit“<br />
• H. Weißengruber<br />
„Arbeitssicherheit bei Lasttürmen“<br />
• O. Polanz<br />
„Moderne Arbeitsschutzvorschriften“<br />
• H. Budorweit<br />
„Warum eine Fachregel <strong>für</strong> den Gerüstbau?“<br />
• K. Weise<br />
„Schalwagen <strong>für</strong> Verbundbrücken“<br />
• M. Jentsch, M. Broichgans, C. Sam:<br />
„Innovativer Freivorbauwagen“<br />
• T. Weise<br />
„Absenken und Verschieben von Überbauten“<br />
2.8.3 Deutscher Bautechnik-Tag <strong>2009</strong> in Dresden<br />
Das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> hat aktiv beim<br />
traditionsreichen Deutschen Bautechnik-<br />
Tag <strong>2009</strong>, organisiert vom Deutschen Beton-<br />
und Bautechnik-Verein e.V. (DBV),<br />
teilgenommen. Zunächst wurde in einem<br />
Auswahlverfahren Herr Dr.-Ing. Christoph<br />
Pflug zum Kolloquium <strong>für</strong> Jungingenieure,<br />
einer Plattform <strong>für</strong> den Dialog mit dem<br />
Ingenieurnachwuchs, qualifiziert. Dort hat<br />
er unter dem diesjährigen Motto „Mein<br />
• K. Zilch, E. Penka, M. Hennecke<br />
„Diagnostik im Bauwesen“<br />
• G. Stenzel<br />
„VDI 6200: Regelmäßige Überprüfung<br />
der Standsicherheit von Bauwerken“<br />
• P. Pacheco, A. Ad. d. Fonseca, M.<br />
Jentsch<br />
“A new concept of overhead movable<br />
scaffolding system of bridge construction”<br />
• H. Schuon, O. Leitzbach<br />
„Frischbetondruck auf vertikale Schalungen<br />
bei fließfähigen und selbstverdichtenden<br />
Betonen und dessen Auswirkung<br />
auf den Auftrieb bei geneigten<br />
Schalungen“<br />
• C. Motzko<br />
„Neue Erkenntnisse in der Sichtbetontechnologie“<br />
Beitrag zur Fortentwicklung der Bautechnik“<br />
seine Forschungsarbeit zum Themenkomplex<br />
der Bildverarbeitungssysteme<br />
als Medium zur Steuerung und Dokumentation<br />
von Produktionsprozessen im<br />
Bauwesen mit dem Schwerpunkt Indoor-<br />
Positionierung mit sehr gutem Erfolg präsentiert.<br />
Prof. Motzko wurde vom DBV als<br />
Mitglied der Jury <strong>für</strong> dieses Kolloquium<br />
bestellt.<br />
Abb. 1: Mitglieder der Jury (v. r. n. l.) Prof. Dr.-Ing. M. Curbach (Moderation), Dr.-Ing. L. Meyer, Dr.-Ing. C. Dehlinger, Dipl.-Ing. E. Bohlmann, Prof. Dr.-Ing. C.<br />
Motzko<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 71
3 Lehre<br />
3.1 Lehrveranstaltungen des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
Lehrmodule im Bachelor / Grundfach (Diplom)<br />
5. Semester<br />
<strong>Baubetrieb</strong> A1<br />
(4 SWS, 6 CP)<br />
Lehrinhalte<br />
Einführung in den <strong>Baubetrieb</strong><br />
Aufbau- und Ablauforganisation<br />
Ausschreibung, Vergabe, Bauvertrag<br />
Erdarbeiten<br />
Schalungstechnik<br />
Baustelleneinrichtung und Hebezeuge<br />
Terminplanung<br />
Kostenplanung, Kalkulation und Preisbildung<br />
Arbeitskalkulation<br />
Arbeitssicherheit<br />
Studienleistungen<br />
Testatpflichtige Hausübungen<br />
6. Semester<br />
<strong>Baubetrieb</strong> A2<br />
(2 SWS, 3 CP)<br />
Lehrinhalte<br />
<strong>Baubetrieb</strong>liche Probleme des Bauvertrages<br />
1. Grundlagen des Bauvertragsrechts<br />
2. VOB/B-Paragraphen<br />
3. Nachträge<br />
Bauverfahrenstechnik<br />
1. Baugrubenumschließungen<br />
2. Spezialtiefbau<br />
3. Brückenbau<br />
4. Schalungstechnik im Tunnelbau<br />
5. Fertigteilbau<br />
Kalkulatorischer Verfahrensvergleich<br />
Studienleistungen<br />
Testatpflichtige Hausübungen<br />
72<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
Lehrmodule im Master / Vertiefungsfach und Hauptvertiefungsfach (Diplom)<br />
1. Semester / 7. Semester<br />
<strong>Baubetrieb</strong> B1<br />
(4 SWS, 6 CP)<br />
Lehrinhalte<br />
Durchführung eines speziellen Bauprojekts<br />
1. SKR-Vergaberecht<br />
2. Bauvertrag und funktionale Leistungsbeschreibung<br />
3. Funktionale Leistungsbeschreibung aus baubetrieblicher Sicht<br />
4. Anerkannte Regeln der Technik<br />
5. Bauzeit – Terminsituation<br />
6. Arbeitssicherheit<br />
7. Abnahme / Mängel /Toleranzen<br />
8. Projektcontrolling<br />
Leistungsänderungen und Bauablaufstörungen<br />
Teil I: Sachnachträge<br />
Projektcontrolling im Anlagenbau<br />
<strong>Baubetrieb</strong>liche Aspekte beim Bau turmartiger Bauwerke<br />
Abwicklung von Bauprojekten im internationalen Rahmen<br />
Hörsaalübungen<br />
1. Bauverfahrenstechnik<br />
2. Arbeitskalkulation<br />
Studienleistungen<br />
Testatpflichtige Hausübungen<br />
2. Semester / 8. Semester<br />
<strong>Baubetrieb</strong> B2<br />
(4 SWS, 6 CP)<br />
Lehrinhalte<br />
Wissenschaftliches Arbeiten<br />
Traggerüstbau<br />
Leistungsänderungen und Bauablaufstörungen<br />
Teil II: Bauzeitnachträge<br />
Versicherungen im Bauwesen<br />
Hörsaalübungen<br />
1. Bauverfahrenstechnik<br />
2. Arbeitskalkulation<br />
Studienleistungen<br />
Testatpflichtige Hausübungen<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 73
2. Semester / 8. Semester<br />
Bauen im Bestand – Verfahrenstechnik und Ökonomie<br />
(4 SWS, 6 CP)<br />
Lehrinhalte<br />
Projekt und Objekt im Lebenszyklus von Gebäuden<br />
Grundlagen des Bauens im Bestand<br />
Bauökonomie: Kostenplanung und Nutzungskostenplanung<br />
Gebäudeinstandhaltung<br />
Lebenszyklusanalyse von Immobilien<br />
Komplexe Verträge im Kraftwerksbau<br />
Abbrucharbeiten<br />
Studienleistungen<br />
Exkursionen<br />
3. Semester / 9. Semester<br />
<strong>Baubetrieb</strong> C1<br />
(4 SWS, 6 CP)<br />
Lehrinhalte<br />
Arbeitssicherheit<br />
REFA im Bauwesen<br />
Innovative Geschäftsmodelle in der Bauindustrie<br />
Präsentationstraining<br />
Wissenschaftliches Arbeiten<br />
Seminarvorträge zu aktueller baubetrieblicher Forschung<br />
Studienleistungen<br />
Lehrgang zur Arbeitssicherheit<br />
Klausur Arbeitssicherheit<br />
Präsentationstraining<br />
Übung Innovative Geschäftsmodelle in der Bauindustrie<br />
Für die Teilnahme am Lehrgang Arbeitssicherheit und den erfolgreichen Abschluss der Klausur<br />
Arbeitssicherheit wird eine gesonderte Bescheinigung der Berufsgenossenschaft der<br />
Bauwirtschaft (BG Bau) ausgestellt.<br />
4. Semester / 10. Semester<br />
<strong>Baubetrieb</strong> C2<br />
(4 SWS, 6 CP)<br />
Lehrinhalte<br />
Normengerechtes Bauen: Sichtbar bleibende Betonflächen (Sichtbeton)<br />
<strong>Baubetrieb</strong>liche Aspekte der Fassadentechnik<br />
Mitarbeiterführung<br />
Bewerbungstraining<br />
Entscheidungs- und Problemanalyse<br />
Seminarvorträge zu aktueller baubetrieblicher Forschung<br />
Studienleistungen<br />
Bewerbungstraining<br />
Übung Mitarbeiterführung<br />
74<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
3.2 Grundlagen des Planens, Entwerfens und Konstruierens<br />
Die fachgebietsübergreifenden Projektseminare<br />
„Grundlagen des Planens, Entwerfens<br />
und Konstruierens“ (GPEK I & II)<br />
sollen den Studierenden des ersten und<br />
zweiten Fachsemesters des Diplomstudiengangs<br />
„Bauingenieurwesen“ und der<br />
Bachelorstudiengänge „Bauingenieurwesen<br />
und Geodäsie“, „Umweltingenieurwissenschaften“<br />
sowie „Wirtschaftsingenieurwesen,<br />
technische Fachrichtung<br />
Bauingenieurwesen“ einen Einblick in das<br />
Berufsfeld von Bauingenieuren und Geodäten<br />
geben. Durch das selbstständige<br />
Bearbeiten eines Projektes mit ca. zwölf<br />
Studierenden in so genannten „Projektgruppen“<br />
als Planspiel steht das Erproben<br />
Projektsteuerung<br />
Teilnehmer:<br />
Fachrollen<br />
<strong>Baubetrieb</strong><br />
Geotechnik<br />
Projektgruppe<br />
PG 5<br />
Objektplanung<br />
Tutor<br />
DIE<br />
PROJEKTGRUPPEN<br />
Tragwerksplanung<br />
Fachgruppe<br />
Objektplanung<br />
DIE<br />
FACHGRUPPEN<br />
von typischen Arbeitsprozessen der Projektarbeit<br />
mit den dazugehörigen Organisationsstrukturen<br />
im Vordergrund. Neben<br />
dieser grundlegenden Berufsqualifizierung<br />
sollen die Studierenden in die Lage versetzt<br />
werden, die Vielfalt der Arbeitsmöglichkeiten<br />
des gewählten Berufsfeldes zu<br />
begreifen und somit ihr Fachstudium gezielt<br />
und individuell zu gestalten. Ein besonderes<br />
Anliegen ist es, durch Schulung<br />
der individuellen Verbalisierungs- und Präsentationsfähigkeit<br />
sowie der Kooperations-<br />
und Kompromissbereitschaft die Persönlichkeitsentwicklung<br />
der Studierenden<br />
zu fördern.<br />
Projektgruppe<br />
PG 1<br />
PG 4<br />
PG 5<br />
PG 3 PG 6<br />
Fachgruppe<br />
<strong>Baubetrieb</strong><br />
PG 2<br />
Abb. 1: Beispielhafte Zusammensetzung der Projekt- und der Fachgruppen eines GPEK-Planspiels<br />
In Abhängigkeit des zu bearbeitenden Projektes<br />
werden verschiedene Ingenieurrollen<br />
definiert. Die Studierenden übernehmen<br />
innerhalb ihrer Projektgruppe (Abb. 1)<br />
eine solche Fachrolle. Alle Studierenden<br />
derselben Fachrolle werden in so genann-<br />
Teilnehmer:<br />
Projektgruppen<br />
PG 1 Mentor<br />
PG 7<br />
ten „Fachgruppen“ auf ihre inhaltliche<br />
Arbeit innerhalb ihrer Projektgruppe vorbereitet.<br />
Die Betreuung der Fachgruppen<br />
erfolgt durch die so genannten „Mentoren“,<br />
Professoren und/oder wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter der Fachgebiete.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 75
Im Rahmen des im Sommersemester angebotenen<br />
Projektseminars GPEK II ist<br />
das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> beteiligt. Dabei<br />
werden zur Bearbeitung eines Hoch- oder<br />
Ingenieurbauwerks die Studierenden der<br />
Fachgruppe „<strong>Baubetrieb</strong>“ durch Herrn<br />
Prof. Motzko und wissenschaftliche Mitarbeiter<br />
des <strong>Institut</strong>s betreut.<br />
Die Koordination und Organisation von<br />
GPEK erfolgt durch die wissenschaftlichen<br />
Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Planen, Entwerfen<br />
und Konstruieren (PEK). Diese sind<br />
neben ihren Aufgaben in der Lehre und<br />
Studienberatung bei der Arbeitsgruppe<br />
3.3 Bachelor of Science Bauingenieurwesen und Geodäsie<br />
Das Bachelorstudium Bauingenieurwesen<br />
und Geodäsie ist auf eine Dauer von<br />
6 Semestern mit einem Umfang von insgesamt<br />
180 Credit Points (CP) angelegt.<br />
Hiervon entfallen 108 CP auf Lehrveranstaltungen<br />
des Grundstudiums, 72 CP<br />
müssen im Fachstudium inkl. der Bache-<br />
76<br />
6. Sem.<br />
5. Sem.<br />
4. Sem.<br />
3. Sem.<br />
2. Sem.<br />
1. Sem.<br />
Fachstudium<br />
8<br />
Fachstudium<br />
3<br />
Fachstudium<br />
1<br />
Mathematik<br />
III<br />
Mathematik<br />
II<br />
Mathematik<br />
I<br />
Fachstudium<br />
9<br />
Fachstudium<br />
4<br />
Fachstudium<br />
2<br />
Technische<br />
Mechanik<br />
III<br />
Technische<br />
Mechanik<br />
II<br />
Technische<br />
Mechanik<br />
I<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Fachstudium<br />
10<br />
Fachstudium<br />
5<br />
Werkstoffe im<br />
Bauwesen<br />
Chemie<br />
GPEK<br />
II<br />
GPEK<br />
I<br />
Abb. 1: Struktur des Studiums Bachelor of Science Bauingenieurwesen und Geodäsie<br />
PEK <strong>für</strong> ihre Forschungstätigkeit verschiedenen<br />
Fachgebieten respektive <strong>Institut</strong>en<br />
zugeordnet. Herr Prof. Motzko hat die<br />
wissenschaftliche Betreuung von Herrn<br />
Dipl.-Ing. Felix Bothmann inne. Gleichzeitig<br />
ist er mit den Herren Prof. Dr.-Ing.<br />
Jörg Lange (Fachgebiet Stahlbau), Prof.<br />
Dr.-Ing. Hans-Joachim Linke (Fachgebiet<br />
Landmanagement) und Prof. Dipl.-Ing. Dr.<br />
nat. techn. Wilhelm Urban (Fachgebiet<br />
Wasserversorgung nd Grundwasserschutz)<br />
<strong>für</strong> die Arbeitsgruppe verantwortlich. <br />
lorthesis erbracht werden. Das Fachstudium<br />
eröffnet den Studierenden die<br />
Möglichkeit, 10 Module zu wählen. Dazu<br />
bietet der <strong>Baubetrieb</strong> das Modul <strong>Baubetrieb</strong><br />
A1, sowie zusammen mit der Geotechnik<br />
das Modul <strong>Baubetrieb</strong> A2/Geotechnik<br />
II an.<br />
Darstellende<br />
Geometrie<br />
Bachelor-Thesis<br />
Fachstudium<br />
6<br />
Vermessung<br />
I<br />
Fachstudium<br />
7<br />
fachübergreifend<br />
fachübergreifend<br />
Vermessung<br />
II<br />
Physik<br />
Physik<br />
Bau- und<br />
Geoinformatik<br />
I<br />
Σ 30<br />
Credits<br />
Σ 30<br />
Credits<br />
Σ 30<br />
Credits<br />
Σ 30<br />
Credits<br />
Σ 31<br />
Credits<br />
Σ 29<br />
Credits
3.4 Master of Science Bauingenieurwesen<br />
Der Masterstudiengang Bauingenieurwesen<br />
umfasst bei einer Dauer von<br />
4 Semestern 120 Credit Points (CP). Die<br />
Spezialisierung erfolgt durch die Wahl von<br />
drei respektive vier Forschungsfächer.<br />
Eines dieser Forschungsfächer ist der<br />
<strong>Baubetrieb</strong> mit den Modulen<br />
• <strong>Baubetrieb</strong> B1,<br />
• <strong>Baubetrieb</strong> B2,<br />
4. Sem.<br />
3. Sem.<br />
2. Sem.<br />
1. Sem.<br />
1 Forschungs-<br />
Vertiefungs-<br />
Fach<br />
C Master-Thesis<br />
C<br />
B<br />
B<br />
„C-<br />
Fach“<br />
W W<br />
B<br />
B<br />
„B-<br />
Fach“<br />
Abb. 1: Struktur des Studiums Master of Science Bauingenieurwesen<br />
B<br />
B<br />
„B-<br />
Fach“<br />
• <strong>Baubetrieb</strong> C1 und<br />
• <strong>Baubetrieb</strong> C2.<br />
Weiterhin ist der <strong>Baubetrieb</strong> mit dem Modul<br />
Bauen im Bestand – Verfahrenstechnik<br />
und Ökonomie substanzieller Bestandteil<br />
des Forschungsfaches Facility Management.<br />
W<br />
W<br />
W<br />
2 Forschungs-<br />
Basis-<br />
Fächer<br />
3.5 Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen,<br />
technische Fachrichtung Bauingenieurwesen<br />
Das Bachelorstudium des Wirtschaftsingenieurwesens<br />
mit technischer Fachrichtung<br />
Bauingenieurwesen ist auf eine<br />
Dauer von 6 Semestern angelegt und hat<br />
einen Umfang von insgesamt 180 Credit<br />
Points (CP). Hiervon entfallen 87 CP auf<br />
Ingenieurwissenschaftliche Fächer, 81 CP<br />
auf Fächer der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften<br />
und 12 CP auf die<br />
Bachelorthesis.<br />
Im Bereich der Ingenieurwissenschaften<br />
ist von den Studierenden einer der<br />
Schwerpunkte<br />
W<br />
W<br />
IPBI<br />
Σ 30 CP<br />
Σ 30 CP<br />
Σ 30 CP<br />
Σ 30 CP<br />
Σ 120 CP<br />
• Technische Infrastruktur- und Raumplanung<br />
sowie<br />
• Konstruktion<br />
zu wählen.<br />
Für den Schwerpunkt Konstruktion ist das<br />
Pflichtmodul <strong>Baubetrieb</strong> A1 zu belegen.<br />
Zusätzlich wird gemeinsam mit der<br />
Geotechnik das Modul <strong>Baubetrieb</strong><br />
A2/Geotechnik II zur Wahl angeboten. Die<br />
Inhalte der Veranstaltungen sind identisch<br />
mit den gleichnamigen Modulen des Bauingenieurstudiengangs.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 77
3.6 Master of Science Wirtschaftsingenieurwesen,<br />
technische Fachrichtung Bauingenieurwesen<br />
Der Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen<br />
mit technischer Fachrichtung<br />
Bauingenieurwesen ist mit einem Umfang<br />
von 120 Credit Points (CP) auf eine Dauer<br />
von 4 Semestern angelegt. Hiervon<br />
entfallen 48 CP auf ingenieurwissenschaftliche<br />
Fächer, 42 CP auf Fächer der<br />
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften<br />
und zuammen 30 CP auf eine Studienarbeit<br />
und die Masterthesis.<br />
Die Spezialisierung im Bereich der<br />
Ingenieurwissenschaften erfolgt durch die<br />
Wahl einer der Schwerpunkte<br />
3.7 Workshop zur Übungsbearbeitung im <strong>Baubetrieb</strong><br />
Ausgangssituation<br />
Die Komplexität der Hausübungen im<br />
Fach <strong>Baubetrieb</strong> stellt <strong>für</strong> die Studierenden<br />
eine große Herausforderung dar. Hier<br />
sind als Schwierigkeiten insbesondere die<br />
Vielzahl an Freiheitsgraden bei der Bearbeitung,<br />
die Notwendigkeit zum begründeten<br />
Entscheiden, die erforderliche eigenständige<br />
Informationssuche sowie das<br />
Fehlen einer eindeutigen Musterlösung zu<br />
nennen. Erschwerend kommt hinzu, dass<br />
<strong>für</strong> die Gruppenarbeit an der Hochschule,<br />
insbesondere auf dem Standort Lichtwiese,<br />
zu wenige geeignete Arbeitsplätze zur<br />
Verfügung stehen.<br />
Im Rahmen der Einführung von Studiengebühren<br />
im Wintersemester <strong>2007</strong>/2008<br />
wurde nach Möglichkeiten gesucht, die<br />
nun zur Verfügung stehenden Mittel direkt<br />
den Studierenden zu Gute kommen zu<br />
lassen. Um die Studierenden auch in den<br />
neuen Bologna-Studiengängen baubetrieblich<br />
zu fordern und gleichzeitig bei der<br />
Übungsbearbeitung zu unterstützen entstand<br />
die Idee eines neuen Betreuungskonzeptes.<br />
78<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
• Technische Infrastruktur- und Raumplanung<br />
sowie<br />
• Konstruktion.<br />
Der <strong>Baubetrieb</strong> bietet <strong>für</strong> den Schwerpunkt<br />
Konstruktion die Module<br />
• <strong>Baubetrieb</strong> B1,<br />
• <strong>Baubetrieb</strong> B2,<br />
• <strong>Baubetrieb</strong> C1,<br />
• <strong>Baubetrieb</strong> C2 und<br />
• Bauen im Bestand – Verfahrenstechnik<br />
und Ökonomie<br />
an. Die Inhalte der Veranstaltungen sind<br />
identisch mit den gleichnamigen Modulen<br />
des Bauingenieurstudiengangs.<br />
Konzept<br />
Der Workshop zur <strong>Baubetrieb</strong>sübung basiert<br />
auf dem Prinzip: Studierende helfen<br />
Studierenden.<br />
Abb.1: Studierende im Workshop<br />
Durch diese Betreuungsform ergibt sich<br />
eine Gewinnsituation <strong>für</strong> alle Beteiligten.<br />
Die Studierenden werden von Tutoren<br />
unterstützt, die auf derselben Ebene stehen<br />
und sich relativ viel Zeit nehmen können.<br />
Die Tutoren selbst erhalten zusätzliche<br />
fachlich-methodische Schulungen und<br />
lernen beim Erklären selbst dazu und den<br />
wissenschaftlichen Mitarbeitern stehen<br />
motivierte Studierende als Multiplikatoren<br />
und Ansprechpartner <strong>für</strong> direktes Feedback<br />
zur Verfügung.
Abb. 2: Studentischer Tutor beim Erklären<br />
Umsetzung<br />
Für die Gruppenarbeit steht den Studierenden<br />
der Seminarraum des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong><br />
<strong>Baubetrieb</strong> mit einem gut sortierten Literatur-<br />
und Materialschrank zur Verfügung.<br />
An drei Tagen in der Woche stehen dort<br />
jeweils zwei Tutoren bereit, um Hilfestellungen<br />
zu geben. Die derzeit acht Tutoren<br />
werden in jedem Semester an einem<br />
Tutorentag auf ihre Aufgaben vorbereitet<br />
und erhalten darüber hinaus in wöchentlichen<br />
Tutorensitzungen methodische Hilfe<br />
und fachlichen Input.<br />
Abb. 3: Tutorentag<br />
3.8 Gastvorträge im Rahmen von Lehrveranstaltungen<br />
Sommersemester <strong>2007</strong><br />
<strong>Baubetrieb</strong> A2<br />
• Heck, Detlef Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br />
„Verfahrenstechnik im Spezialtiefbau“<br />
• Hofstadler, Christian<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn.<br />
„Systematische Verfahrensauswahl –<br />
Systematische Schalungsauswahl“<br />
<strong>Baubetrieb</strong> B2<br />
• Bock, Christian Dipl.-Ing. (VHV-Gruppe)<br />
„Versicherungen im Bauwesen“<br />
• Duve, Helmuth RA Dr.-Ing.<br />
„Streitregulierung im Bauwesen“<br />
• Hofstadler, Christian<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn.<br />
„<strong>Baubetrieb</strong>liche Grobplanung von Bauprojekten<br />
– Beispiel Stahlbetonarbeiten“<br />
Sommersemester 2008<br />
<strong>Baubetrieb</strong> A2<br />
• Heck, Detlef Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br />
„Verfahrenstechnik im Spezialtiefbau“<br />
• Hofstadler, Christian<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn.<br />
„Behandlung von Bauablaufstörungen<br />
mit Interaktionsdiagrammen“<br />
<strong>Baubetrieb</strong> C2<br />
• Heim, Marc Dr.-Ing.<br />
„Entscheidungs- und Ursachenanalyse“<br />
• Matthes, Reiner Dipl.-Ing.<br />
„Schadensfälle an Fassaden“<br />
• Strehlow, Peter Dipl.-Ing.<br />
„Fassadentechnik“<br />
Bauen im Bestand – Verfahrenstechnik<br />
und Ökonomie<br />
• Schmitz, Annette Dipl.-Ing.<br />
„Kerntechnische Anlagen / Zerlegetechniken“<br />
<strong>Baubetrieb</strong> B2<br />
• Buttkewitz, Olaf Dipl.-Ing.<br />
(VHV-Gruppe)<br />
„Versicherungen im Bauwesen“<br />
• Hofstadler, Christian<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn.<br />
„Systematische Bauverfahrenswahl –<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 79
Ablaufschema, Kriterien und Entscheidungsmatrix“<br />
• Schötz, Rainer Dipl.-Ing. (Hünnebeck)<br />
„Traggerüstbau“<br />
<strong>Baubetrieb</strong> C2<br />
• Heim, Marc Dr.-Ing.<br />
„Entscheidungs- und Ursachenanalyse“<br />
Wintersemester 2008/<strong>2009</strong><br />
<strong>Baubetrieb</strong> B1<br />
• Heim, Marc Dr.-Ing.<br />
„Projektcontrolling im Anlagenbau“<br />
Sommersemester <strong>2009</strong><br />
<strong>Baubetrieb</strong> A2<br />
• Heck, Detlef Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br />
„Verfahrenstechnik im Spezialtiefbau“<br />
• Hofstadler, Christian<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn<br />
„Stahlbetonarbeiten – Systematische<br />
Ermittlung von Aufwandswerten <strong>für</strong> die<br />
Kalkulation und Arbeitsvorbereitung“<br />
<strong>Baubetrieb</strong> B2<br />
• Buttkewitz, Olaf Dipl.-Ing.<br />
(VHV-Gruppe)<br />
„Versicherungen im Bauwesen“<br />
• Hofstadler, Christian<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn.<br />
„Systematische Bauverfahrenswahl –<br />
Ablaufschema, Kriterien und Entscheidungsmatrix“<br />
3.9 Sonstige Veranstaltungen<br />
3.9.1 Lehrgänge zur Arbeitssicherheit<br />
Zum Abschluss der Vorlesungsreihe Arbeitssicherheit<br />
des Moduls <strong>Baubetrieb</strong> C1<br />
bietet das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> in Zusammenarbeit<br />
mit der Berufsgenossenschaft<br />
der Bauwirtschaft (BG Bau) im<br />
Rahmen einer Exkursion einen Lehrgang<br />
zur Arbeitssicherheit in den Schulungszentren<br />
der Berufsgenossenschaften in Oberaichen<br />
respektive Eppstein an. Im Be-<br />
80<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
• Hofstadler, Christian<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn.<br />
„<strong>Baubetrieb</strong>liche Grobplanung – Beispiel<br />
Stahlbetonarbeiten“<br />
• Matthes, Reiner Dipl.-Ing.<br />
„Schadensfälle an Fassaden“<br />
• Strehlow, Peter Dipl.-Ing.<br />
„Fassadentechnik“<br />
• Schötz, Rainer Dipl.-Ing. (Hünnebeck)<br />
„Traggerüstbau“<br />
<strong>Baubetrieb</strong> C2<br />
• Heim, Marc Dr.-Ing.<br />
„Entscheidungs- und Ursachenanalyse“<br />
• Hofstadler, Christian<br />
Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn.<br />
„Bauablaufplanung und Logistik – Ressourcenermittlung<br />
und -verteilung“<br />
• Matthes, Reiner Dipl.-Ing.<br />
„Schadensfälle an Fassaden“<br />
• Strehlow, Peter Dipl.-Ing.<br />
„Fassadentechnik“<br />
Bauen im Bestand<br />
• Schmitz, Annette Dipl.-Ing.<br />
„Kerntechnische Anlagen / Rückbauprojekt<br />
am Beispiel“<br />
richtszeitraum wurden zu folgenden Terminen<br />
Lehrgänge angeboten:<br />
• 24.-26.01.<strong>2007</strong> in Oberaichen,<br />
• 02.-04.05.<strong>2007</strong> in Oberaichen,<br />
• 28.-30.02.2008 in Oberaichen,<br />
• 02.-04.02.<strong>2009</strong> in Eppstein.
3.9.2 Goldbeck Fallstudien<br />
Am 18. Juni <strong>2007</strong> und am 19. November<br />
2008 konnte das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
seinen Studierenden die Teilnahme an der<br />
Fallstudie „Vorsprung durch Innovation“<br />
der Goldbeck GmbH anbieten. Ungefähr<br />
ein Dutzend Studierende nahmen an den<br />
Veranstaltungen im GOBA-Zentrum in<br />
Hirschberg teil.<br />
Im Rahmen der Fallstudien hatten die<br />
Studierenden die Möglichkeit, in Teams<br />
nach Lösungen <strong>für</strong> reale Problemstellungen<br />
zu suchen und stellten sich unterschiedlichen<br />
durchaus herausfordernden<br />
Situationen. Im Anschluss an die Lösungssuche<br />
in drei studentischen Projektteams<br />
waren dann auch die Präsentationskünste<br />
gefordert.<br />
Dabei wurden die Studierenden von Herrn<br />
Maass (Geschäftsführer), Herrn Huber<br />
(Planungsabteilung) sowie Frau Nathaus-<br />
Hünnemann (Personalentwicklung) begleitet,<br />
so dass sie von Entscheidern aus der<br />
Praxis ein sehr detailliertes Feedback zu<br />
ihrer Arbeitsweise erhielten.<br />
3.9.3 Exkursionen zum Kraftwerk Biblis<br />
Im Rahmen des Moduls Bauen im Bestand<br />
– Verfahrenstechnik und Ökonomie<br />
besuchte eine Gruppe von Studenten am<br />
18. Juli <strong>2007</strong>, am 11. Juni 2008 und am<br />
15. Juli <strong>2009</strong> das RWE Kernkraftwerk in<br />
Biblis. Die Exkursion war jeweils der Ab-<br />
Neben der Gelegenheit <strong>für</strong> die Studierenden<br />
ihre strategischen, situativen und visionären<br />
Fähigkeiten einzusetzen, konnten<br />
sie auch das Unternehmen Goldbeck und<br />
dessen Produkte kennen lernen. Herr<br />
Maass präsentierte anschaulich die Struktur<br />
des Unternehmens und dessen Tätigkeitsbereich<br />
sowie den stringenten Systemansatz,<br />
der sich durch alle Produkte<br />
zieht.<br />
Später konnte die Umsetzung des Systemgedankens<br />
bei einer Führung durch<br />
die ausgestellten Exponate begutachtet<br />
werden. Fachkundige Mitarbeiter erläuterten<br />
die Umsetzung von der Planung über<br />
die Herstellung bis hin zur Montage auf<br />
der Baustelle und beantworteten detailliert<br />
die aufkommenden Fragen.<br />
Zum Ausklang der sehr ereignisreichen<br />
Tage gab es bei einem gemeinsamen<br />
Abendessen die Gelegenheit <strong>für</strong> die Studierenden,<br />
mit Goldbeck-Mitarbeitern persönlich<br />
ins Gespräch zu kommen und Kontakte<br />
<strong>für</strong> ein Praktikum bzw. eine<br />
Vertieferarbeit, Masterthesis oder ähnliches<br />
zu knüpfen.<br />
schluss einer Vorlesungsreihe zu den<br />
Themenkomplexen der komplexen Verträge<br />
im Kraftwerksbau, der Abbrucharbeiten<br />
und insbesondere die Erbringung von Abbruchleistungen<br />
in kerntechnischen Bereichen.<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 81
3.9.4 Workshop mit Bilfinger Berger Hochbau in Frankfurt<br />
Am 21. November <strong>2007</strong> und am 28. April<br />
<strong>2009</strong> fanden Workshops <strong>für</strong> Studierende<br />
des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> mit Bilfinger<br />
Berger Hochbau statt. Die jeweils ca. zehn<br />
teilnehmenden Studierenden konnten das<br />
Unternehmen Bilfinger Berger kennen<br />
lernen und bearbeiteten bzw. erörterten<br />
während des Workshops folgende Fragestellungen<br />
in Kleingruppen:<br />
• Untersuchungen herkömmlicher und<br />
alternativer Vergabeverfahren bzgl.<br />
Nachunternehmerleistungen vor dem<br />
Hintergrund der aktuellen Marktsituation.<br />
3.9.5 Werksbesichtigungen von Peri in Weißenhorn<br />
Am 01. Februar 2008 und am 04. Februar<br />
<strong>2009</strong> organisierte das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
<strong>für</strong> die Studierenden eine Exkursion<br />
nach Weißenhorn zu einer Werksbesichtigung<br />
des Schalungs- und Gerüstherstel-<br />
82<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
• Die Erfolgsfaktoren des Nachtragsmanagements.<br />
• Planungskoordination der Gewerke.<br />
Eine Aufgabe, welche nebenbei erledigt<br />
werden kann?<br />
Im Rahmen der Kleingruppenarbeit konnten<br />
die Studierenden neben ihrer fachlichen<br />
Qualifikation ihre Kommunikationsund<br />
Präsentationsfähigkeiten unter Beweis<br />
stellen.<br />
Zum Ausklang gab es bei gemeinsamen<br />
Abendessen die Möglichkeit zu persönlichen<br />
Gesprächen mit Bilfinger Berger-<br />
Mitarbeitern.<br />
lers Peri. Die Teilnehmer konnten neben<br />
einer Besichtigung der Produktionsanlagen<br />
aktuelle Systemschalungen vor Ort<br />
kennen lernen.<br />
3.9.6 Exkursionen zum Justiz- und Verwaltungszentrum in Wiesbaden<br />
Am 14. Mai 2008 besuchten die Studierenden<br />
des Moduls <strong>Baubetrieb</strong> A2 und am<br />
17. Juni <strong>2009</strong> die Studierenden des Moduls<br />
Bauen im Bestand – Verfahrenstechnik<br />
und Ökonomie die Baustelle des Justiz-<br />
und Verwaltungszentrums in Wiesbaden.<br />
Dieses von der Bilfinger Berger<br />
Hochbau GmbH realisierte Bauvorhaben<br />
3.9.7 Exkursion zum Mercedes Benz Museum Stuttgart<br />
Die Studierenden des Moduls <strong>Baubetrieb</strong><br />
C2 besuchten am 17. Juni 2008 das Mercedes<br />
Benz Museum in Stuttgart. Diese<br />
Exkursion war eine gute Ergänzung zur<br />
Vorlesungsreihe Sichtbeton. Im Muse-<br />
ist eines der großen PPP-Projekte in<br />
Deutschland. In zwei Gebäuden mit bis zu<br />
sechs Geschossen, Tiefgaragen mit 150<br />
und einem Parkhaus mit ca. 500 Stellplätzen<br />
werden zukünftig die Arbeitsplätze<br />
von Justiz und Verwaltung in Wiesbaden<br />
effizient an einem Ort gebündelt.<br />
umsgebäude konnte das Ergebnis von<br />
Stahlbetonarbeiten mit sichtbar bleibenden<br />
Betonflächen am realen Beispiel erlebt<br />
und begutachtet werden.
3.9.8 Exkursion zum Lufthansa Training & Conference Center in Seeheim<br />
Am 18. Juni 2008 fand <strong>für</strong> die Teilnehmer<br />
des Moduls Bauen im Bestand – Verfahrenstechnik<br />
und Ökonomie eine Exkursion<br />
zur Baustelle Lufthansa Training & Confe-<br />
rence Center in Seeheim statt. Dort entstand<br />
durch den Auftragnehmer Bilfinger<br />
Berger eines der modernsten und größten<br />
Tagungszentren Deutschlands.<br />
3.9.9 Fachtagung Sichtbeton: Planung, Gestaltung, Ausführung<br />
Am 19. Mai <strong>2009</strong> besuchte das <strong>Institut</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>Baubetrieb</strong> im Rahmen des Moduls <strong>Baubetrieb</strong><br />
C2 die Fachtagung „Sichtbeton –<br />
Planung, Gestaltung, Ausführung“, veranstaltet<br />
durch die Serviceeinrichtung der<br />
westdeutschen Zementhersteller <strong>für</strong> Bauberatung<br />
und Marktförderung „BetonMarketing<br />
West GmbH“. Die Veranstaltung<br />
fand auf der Raketenstation Hombroich<br />
statt, die bekannt <strong>für</strong> ihre berühmten<br />
Sichtbetonbauwerke wie beispielsweise<br />
der Langen Foundation, ein Entwurf des<br />
Architekten Tadao Ando, ist. Die Fachtagung<br />
wurde von Architekten, Bauingenieuren,<br />
Rechtswissenschaftlern und Studenten<br />
besucht.<br />
Abb. 1: Langen Foundation<br />
Prof. Oliver Kruse, Bildhauer und Vorstand<br />
der Stiftung Insel Hombroich, eröffnete<br />
die Vortragsreihe mit der Darstellung der<br />
bereits realisierten Bauwerke auf der Raketenstation<br />
Hombroich sowie einem Bericht<br />
über den aktuellen Planungsstand<br />
des Raumortlabors Hombroich. Im Anschluss<br />
berichtete Herr Dipl.-Ing. Rolf<br />
Kampen, Bautechnik BetonMarketing<br />
West GmbH, über die Planung und Aus-<br />
führung von Detaillösungen wie z.B. das<br />
Schließen von Ankerlöchern mit Faserzementstopfen<br />
im Kontext der Sichtbetontechnologie.<br />
Herr RA Dr. jur. Felix Nieberding ergänzte<br />
die technischen Fachvorträge um<br />
rechtswissenschaftliche Inhalte wie der<br />
Durchführung von Vergabeverfahren und<br />
der Vertragsgestaltung im Werkvertragsrecht.<br />
Anhand eines Beschlusses der Vergabekammer<br />
Bremen erläuterte er die<br />
Komplexität des öffentlichen Vergabeverfahrens<br />
in Bezug auf den Ausschluss des<br />
Angebotes eines Bieters. In seinem Vortrag<br />
über eingefärbte Sichtbetonflächen<br />
stellte Herr Stefan Heeß von der Unternehmung<br />
Dyckerhoff AG aus Wiesbaden<br />
den Variantenreichtum der Gestaltungsmöglichkeiten<br />
mit dem Werkstoff Beton<br />
vor. Aufgrund der Zugabe von kostenintensiven<br />
Farbpigmenten sei, so der Referent,<br />
die Entstehung eines Preises von bis<br />
zu 1.000,- €/m³ <strong>für</strong> einen eingefärbten Beton<br />
möglich.<br />
Abb. 2: Teilnehmer des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 83
Prof. Motzko beendete mit seinem Vortrag<br />
über Schalungssysteme <strong>für</strong> Sichtbeton die<br />
Fachtagung und gab einen Einblick aus der<br />
Perspektive der <strong>Baubetrieb</strong>swissenschaft<br />
in den Themenkomplex Sichtbeton. In<br />
seinem Vortrag präsentierte er die Inhalte<br />
und den aktuellen Stand der Forschungsarbeit<br />
am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> wie z.B.<br />
dem Zusammenhang zwischen Trennmitteleigenschaften<br />
und Entlüftungsverhalten<br />
des Frischbetons an der Betonoberfläche.<br />
Abschließend fand eine konstruktive Dis-<br />
3.9.10 Workshop mit Peri in Darmstadt<br />
Im Rahmen des Moduls <strong>Baubetrieb</strong> C2<br />
wurde <strong>für</strong> die Studierenden am 02. Juni<br />
<strong>2009</strong> durch den Schalungs- und Gerüsthersteller<br />
Peri ein Workshop angeboten.<br />
Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten<br />
die Teilnehmer das Unternehmen und<br />
potentielle Arbeitsfelder näher kennen<br />
3.10 Preise und Auszeichnungen<br />
<strong>2007</strong> erreichte eine Gruppe von vier Studierenden<br />
des <strong>Institut</strong>s den 7. Platz bei<br />
der 6. Peri <strong>Baubetrieb</strong>sübung und erhielt<br />
<strong>für</strong> diese hervorragende Leistung einen<br />
Geldpreis.<br />
2008 wurde die Studentin Christina Bartelmeß<br />
<strong>für</strong> ihre im Herbst <strong>2007</strong> einge-<br />
84<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
kussionsrunde zwischen Vortragenden<br />
und Auditorium über grundsätzliche Fragestellungen<br />
sowie Detailprobleme in der<br />
Sichtbetontechnologie statt.<br />
Die Vortragsreihe wurde am Nachmittag<br />
mit der Besichtigung der Raketenstation<br />
Hombroich ergänzt. Neben der Besichtigung<br />
der eingangs erwähnten Langen<br />
Foundation verlebendigten sich auch am<br />
fertig gestellten Rohbau „Haus der Musiker“<br />
die Möglichkeiten und Grenzen in der<br />
Ausführung von Sichtbetonbauteilen.<br />
lernen. Daneben wurde ihnen eine kleine<br />
Projektaufgabe gestellt, die als Gruppe zu<br />
bearbeiten war. Anschließend erhielten<br />
sie in individuellen Vieraugengesprächen<br />
Feedback zu ihrem gruppendynamischen<br />
Verhalten.<br />
reichte Studienarbeit mit dem Titel „Das<br />
finanzielle Rechnungswesen und die Kostenleistungsrechnung<br />
der Kommune unter<br />
besonderer Berücksichtigung des Immobilienmanagements<br />
der öffentlichen Hand“<br />
mit dem Bilfinger Berger Preis ausgezeichnet.
4 Publikationen<br />
4.1 Dissertationen am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
Jahr Doktorand<br />
<strong>2009</strong> Hinrichs,<br />
Nils<br />
<strong>2009</strong> Maffini,<br />
Carola<br />
<strong>2009</strong> Demmler,<br />
Markus<br />
2008 Pflug,<br />
Christoph<br />
2008 Elsebach,<br />
Jens<br />
<strong>2007</strong> Huppenbauer,<br />
Falk<br />
<strong>2007</strong> Elahwiesy,<br />
Ali Akbar<br />
<strong>2007</strong> Fetzner,<br />
Torsten<br />
<strong>2007</strong> Cichos,<br />
Christopher<br />
<strong>2007</strong> Klingenberger,<br />
Jörg<br />
Referent<br />
Korreferent<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. H. J. Linke<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. D. Heck<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. habil.<br />
H. Schlemmer<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. D. Heck<br />
Titel der Dissertation<br />
Strategien der öffentlichen Hand –<br />
Ein kompetenzorientierter Ansatz<br />
aus Sicht des Immobiliencontrollings<br />
Konfliktbehandlung in Bauprojektorganisationen<br />
Risikomanagement im internationalen<br />
Tunnelbau unter Anwendung<br />
der Vertragsform FIDIC Red<br />
Book<br />
Ein Bildinformationssystem zur<br />
Unterstützung der Bauprozesssteuerung<br />
Bauwerksinformationsmodelle mit<br />
vollsphärischen Fotografien – Ein<br />
Konzept zur visuellen Langzeitarchivierung<br />
von Bauwerksinformationen<br />
Nachunternehmermanagement:<br />
Die Entwicklung eines prozessorientierten<br />
Entscheidungsmodells<br />
<strong>für</strong> die Beschaffung und das Controlling<br />
Multiprojektmanagement <strong>für</strong> Infrastruktur-Bauprojekte<br />
Ein Verfahren zur Erfassung von<br />
Minderleistungen aufgrund witterungsbedingterBauablaufstörungen<br />
Untersuchungen zum zeitlichen<br />
Aufwand der Baustellenleitung<br />
Ein Beitrag zur systematischen<br />
Instandhaltung von Gebäuden<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 85
Jahr Doktorand<br />
2006 Duve,<br />
Helmuth<br />
2006 Schultheis,<br />
Julia<br />
2006 Stürmer,<br />
Markus<br />
2005 Goldenberg,<br />
Ingo<br />
2005 Huth,<br />
Jörg<br />
2005 Ruß,<br />
Joachim<br />
2004 Haghsheno,<br />
Shervin<br />
2004 Heck,<br />
Detlef<br />
2004 Toppel,<br />
Carsten<br />
2004 Bangert,<br />
Karl<br />
2002 Ebner,<br />
Torsten<br />
86<br />
Referent<br />
Korreferent<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
C.-A. Graubner<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Titel der Dissertation<br />
Entscheidungshilfe zur Auswahl<br />
eines geeigneten Streitregulierungsverfahrens<br />
<strong>für</strong> das Bauwesen<br />
unter besonderer Berücksichtigung<br />
baubetrieblicher Aspekte<br />
Public Private Partnership bei<br />
Stadthallen – Rahmenbedingungen<br />
und Gestaltungsmöglichkeiten<br />
in Deutschland<br />
Beitrag zum Qualitätsmanagement<br />
im vorbeugenden baulichen<br />
Brandschutz – Untersuchung von<br />
ausgewählten Brandschutzmängeln<br />
der Ausführungsphase<br />
Optimierung von Supply Chain<br />
Prozessen in der Bauwirtschaft<br />
durch mobile Technologien und<br />
Applikationen<br />
<strong>Baubetrieb</strong>liche Analyse von<br />
selbstverdichtendem Beton<br />
Ausführungsdauern und Kapazitätsplanung<br />
von Bauleistungen im<br />
Organisierten Selbstbau<br />
Analyse der Chancen und Risiken<br />
des GMP-Vertrags bei der Abwicklung<br />
von Bauprojekten<br />
Entscheidungshilfe zur Anwendung<br />
von Managementsystemen<br />
in Bauunternehmen<br />
Technische und ökonomische<br />
Bewertungen verschiedener Abbruchverfahren<br />
im Industriebau<br />
Untersuchungen zum Einsatz von<br />
mit Seilen geführten Lastballon-<br />
Kransystemen (LTA Kran-<br />
Systeme) im Bauwesen<br />
Bauen im Bestand bei Bürogebäuden
Jahr Doktorand<br />
2002 Büttner,<br />
Patrick<br />
2002 Heim,<br />
Marc<br />
2002 Glock,<br />
Alexander<br />
2001 Bubenik,<br />
Alexander<br />
2001 Pokker,<br />
Theresa<br />
2001 Müller,<br />
Frank<br />
2001 Werner,<br />
Markus<br />
2000 Griebel,<br />
Bernhard<br />
2000 Mayer,<br />
Dirk<br />
1999 Loschert,<br />
Patrik<br />
1999 Silbe,<br />
Katja<br />
1999 Wengerter,<br />
Heinrich<br />
Referent<br />
Korreferent<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
G. Girmscheid<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Titel der Dissertation<br />
Abbruch von Stahlbeton und<br />
Mauerwerksbauten – Entwicklung<br />
einer Entscheidungshilfe zur<br />
Auswahl von Hydraulikbaggern<br />
Die zeitnahe Leistungsfeststellung<br />
von Baustellen unter besonderer<br />
Berücksichtigung von Bildinformationssystemen<br />
Technisch-wirtschaftliche Untersuchung<br />
luftschiffbasierter<br />
Schwerlastlogistik im Bauwesen<br />
Die Fassade und ihr Einfluss auf<br />
die schlüsselfertige Bauausführung<br />
Kalkulation von Erdarbeiten in kontaminierten<br />
Bereichen<br />
Marktstrategische Fremdvergabe<br />
unter Berücksichtigung entscheidungsrelevanter<br />
Einflusskriterien<br />
Einsatzdisposition von Baustellenführungskräften<br />
in Bauunternehmen<br />
Der zeitnahe Soll-Ist-Vergleich aus<br />
Sicht der Baustelle<br />
Entscheidungshilfe <strong>für</strong> die Beurteilung<br />
von Fußbodensystemen im<br />
Hochbau<br />
Terminmanagement im<br />
schlüsselfertigen Hochbau<br />
Wirtschaftlichkeit kontrollierter<br />
Rückbauarbeiten<br />
Rationalisierungsmöglichkeiten im<br />
Mauerwerksbau durch eine robotergestützteWandvorfertigungsanlage<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 87
Jahr Doktorand<br />
1997 Hitzel,<br />
Achim<br />
1997 Racky,<br />
Peter<br />
1996 Dorn,<br />
Carsten<br />
1995 Keßler,<br />
Egbert<br />
1995 Kraft,<br />
Hermann<br />
1995 Mosler,<br />
Friedo<br />
1994 Plaum,<br />
Stefan<br />
1994 Zhao,<br />
Boming<br />
1993 Kamm,<br />
Hellwig<br />
1991 Hager,<br />
Henning<br />
88<br />
Referent<br />
Korreferent<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr. jur. K. Vygen<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. T. Bock<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. G. König<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. G. König<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. H.-P. Lühr<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. V. Kuhne<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. R. Seeling<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
C. Diederichs<br />
Titel der Dissertation<br />
Ein Entscheidungsunterstützungssystem<br />
<strong>für</strong> das Instandhaltungsmanagement<br />
der Bundesfernstraßenbrücken<br />
Entwicklung einer Entscheidungshilfe<br />
zur Festlegung der Vergabeform<br />
Systematisierte Aufbereitung von<br />
Dokumentationstechniken zur<br />
Steuerung von Bauabläufen und<br />
zum Nachweis von Bauablaufstörungen<br />
Rationalisierung im Schalungsbau<br />
durch Einsatz von Robotern<br />
Steuerung und Entwicklung von<br />
Brückenerhaltungsmaßnahmen<br />
Wirtschaftliche Instandhaltung<br />
von Betonaußenbauteilen<br />
Umweltrelevante organisatorische<br />
Anforderungen an Betriebe der<br />
Bauwirtschaft –<br />
Lösungsmöglichkeiten, aufgezeigt<br />
am Beispiel der Baurestmassenbehandlung<br />
Ein Verfahren zur Entwicklung<br />
eines wissensbasierten Planungssystems<br />
<strong>für</strong> die Terminplanung<br />
von Rohbauprojekten im<br />
Hochbau<br />
Materialwirtschaftliche Steuerung<br />
im <strong>Baubetrieb</strong>, Analyse und Verbesserung<br />
baubetrieblicher Beschaffungsvorgänge<br />
Untersuchung von Einflussgrößen<br />
und Kostenänderungen bei Beschleunigungsmaßnahmen<br />
von<br />
Bauvorhaben
Jahr Doktorand<br />
1991 Hölzgen,<br />
Michael<br />
1990 Reister,<br />
Dirk<br />
1989 Bergweiler,<br />
Gerd<br />
1989 Forkert,<br />
Lothar<br />
1989 Motzko,<br />
Christoph<br />
1989 Ruf,<br />
Lothar<br />
1988 Rose,<br />
Karl<br />
1987 Lang,<br />
Andreas<br />
1986 Krampert,<br />
Lothar<br />
1985 Keßler,<br />
Hermann<br />
Referent<br />
Korreferent<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. G. König<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.rer.pol. K. Robl<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
E. Petzschmann<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. G. König<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. K. Simons<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dipl.-Ing. H. Führer<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. G. König<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
H.-G. Olshausen<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. G. König<br />
Prof. Dr.-Ing. E. Schubert<br />
Prof. Dr.-Ing. W. Keil<br />
Titel der Dissertation<br />
Erhaltungskosten von Brücken<br />
Entwicklung eines Verfahrens zur<br />
projekt-übergreifenden Personaleinsatzoptimierung<br />
Strukturmodell zur Darstellung<br />
und Regeneration von Kalkulationsdaten<br />
Verfahren zur Prognose von Schadensentwicklungen<br />
bei einer kostenoptimiertenBrückeninstandhaltung<br />
Ein Verfahren zur ganzheitlichen<br />
Erfassung und rechnergestützten<br />
Einsatzplanung moderner Schalungssysteme<br />
Integrierte Kostenplanung von<br />
Hochbauten<br />
Kosten der Erhaltung von Brückenbauwerken<br />
Ein Verfahren zur Bewertung von<br />
Bauablaufstörungen und Projektsteuerung<br />
Der Einfluss von Arbeitseinsatz<br />
und Arbeitstakt auf die Kosten von<br />
Hochbauten in Ortbeton<br />
Der Plan Soll-Ist-Vergleich mit einem<br />
Nachweis zeitvariabler Kostenänderung<br />
bei einer Bauzeitverschiebung<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 89
4.2 Bücher, Buchbeiträge, Artikel, publizierte Vorträge 2004-<strong>2009</strong><br />
4.2.1 Bücher und Buchbeiträge<br />
Motzko C (2004) Ein Beitrag zum Sachmangelbegriff und der Sachmangelfolge aus baubetrieblicher<br />
Sicht. In: <strong>Baubetrieb</strong> und Bauwirtschaft – Festschrift Prof. Gert Stadler,<br />
TU Graz, Verlag der TU Graz<br />
Motzko C (2006) <strong>Baubetrieb</strong>liche Aspekte beim Bau turmartiger Bauwerke. In: Betonkalender<br />
2006, Band 1, Ernst & Sohn Verlag <strong>für</strong> Architektur und technische Wissenschaften,<br />
Berlin<br />
Motzko C, Brunner M, Huth J, Leitzbach O (2006) <strong>Baubetrieb</strong>liche Randbedingungen <strong>für</strong> das<br />
Schalen und das Betonieren. In: Sachstandsbericht „Frischbetondruck fließfähiger<br />
Betone“ Deutscher Ausschuss <strong>für</strong> Stahlbeton, Heft 567 Beuth Verlag, Berlin<br />
Hertle R, Motzko C (<strong>2007</strong>) Gerüstbau. In: Betonkalender <strong>2007</strong>, Band 1, Ernst & Sohn Verlag<br />
<strong>für</strong> Architektur und technische Wissenschaften, Berlin<br />
Girmscheid G, Motzko C (<strong>2007</strong>) Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen. In: Springer-Verlag,<br />
Berlin Heidelberg New York<br />
Motzko C (2008) IT-Simulation und Realität – eine baubetriebliche Betrachtung. In: IT verändert<br />
das Bauen, Stiftung Bauwesen, Stuttgart<br />
4.2.2 Schriftenreihe des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
Schubert E, Motzko C (Hrsg) (2004) Nachtragsforderungen – durchsetzen oder vermeiden?<br />
Heft 17 Eigenverlag<br />
Schubert E, Motzko C (Hrsg) (2005) Nachweisführung bei Bauzeitnachträgen. Heft 18 Eigenverlag<br />
Schubert E, Motzko C (Hrsg) (2006) Public Private Partnership – Geschäftsfeld <strong>für</strong> Ingenieure.<br />
Heft 19 Eigenverlag<br />
Schubert E, Motzko C (Hrsg) (2006) Spekulative Preise bei Vergabe und Nachtrag. Heft 20<br />
Eigenverlag<br />
Schubert E, Motzko C (Hrsg) (<strong>2007</strong>) Aktuelle Nachtragsprobleme. Heft 21 Eigenverlag<br />
Schubert E, Motzko C (Hrsg) (2008) Nachtragskalkulation. Heft 22 Eigenverlag<br />
Schubert E, Motzko C (Hrsg) (<strong>2009</strong>) Bauzeitnachträge und Produktivitätsverluste. Heft 23<br />
Eigenverlag<br />
90<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
4.2.3 Fachartikel, publizierte Vorträge<br />
Motzko C, Klingenberger J (2004) Kalkulation kontrollierter Abbrucharbeiten – ausgewählte<br />
Schwachstellen und Empfehlungen aus baubetrieblicher Sicht. In: Tiefbau, Heft<br />
1/2004, Erich Schmidt Verlag, München<br />
Motzko C, Huth, J (2004) Baupraktische Aspekte der Wechselwirkungen zwischen Schalungshaut,<br />
Trennmittel und Frischbeton bei der Herstellung von Sichtbeton. In: DBV-<br />
Heft Nr. 8 „Bauausführung“, Hrsg.: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.,<br />
Berlin<br />
Motzko C (2004) Standardy wykonywania prac szalunkowych. Standards <strong>für</strong> die Ausführung<br />
von Schalarbeiten. Seminarium „Technologie monolityczne“ (Technologien in Ortbetonbauweise),<br />
Warsaw University of Technology, Warschau<br />
Motzko C, Stürmer M (2004) Ausgewählte Mängel beim baulichen Brandschutz im Trockenbau:<br />
Untersuchung zu typischen Ausführungsmängeln. In: Tagungsband Trockenbau-<br />
und Leichtbautag, Darmstadt<br />
Motzko C, Haghsheno S (2004) Risikoidentifikation und Anwendung von Frühaufklärungssytemen<br />
als elementare Teilprozesse des operativen Risikomanagements bei der<br />
Realisierung von Bauvorhaben. In: Tagungsband Risikomanagement in der Bauwirtschaft.<br />
Hrsg.: <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> und Bauwirtschaft der TU Graz. Eigenverlag,<br />
Graz<br />
Motzko C, Stürmer M, Pallmer L (2004) Brandschutzmängel im Trockenbau aus baubetrieblicher<br />
Sicht – ausgewählte Mängel an Montagewänden und abgehängten Unterdecken<br />
mit Brandschutzklassifikation. In: vfdb-Zeitschrift: Forschung, Technik und Management<br />
im Brandschutz, Heft 2/2004, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart<br />
Motzko C, Klingenberger J (2004) Kalkulation kontrollierter Abbrucharbeiten. In: VDBUM-<br />
Information, Heft 3/2004, Verlag Jens Engel, Weyhe<br />
Motzko C, Hitzel A, Heck D (2004) Systemowe zarządzanie utrzymaniem mostów. Veröffentlichung<br />
zur 50. Internationalen Wissenschaftskonferenz, Krynica (Polen), Band 1<br />
Motzko C (2004) EU-Osterweiterung: Sicht der in Polen tätigen deutschen Bauunternehmen<br />
und Bauzulieferer. In: Tagungsunterlagen 14. Kasseler <strong>Baubetrieb</strong>sseminar Schalungstechnik,<br />
Kassel<br />
Motzko C (2004) Neue Regelungen im Bereich der sichtbar bleibenden Betonflächen (Sichtbeton)<br />
– baubetriebliche Wertung im Kontext des Mängelbegriffs. In. Tagungsunterlagen<br />
7. Darmstadt-Berliner Baurechts-Kolloquium. Hrsg.: <strong>Institut</strong> und Versuchsanstalt<br />
<strong>für</strong> Geotechnik der TU Darmstadt. Eigenverlag, Darmstadt<br />
Motzko C, Maffini S, Hübner J (2004) Aufbau eines Informationssystems zur Leistungsfeststellung<br />
im Brückenbau – „Neue Svinesundbrücke“ in Schweden. In: Tiefbau, Heft<br />
11/2004, Erich Schmidt Verlag, München<br />
Motzko C, Schömbs J (2004) Sichtbeton als schalungstechnische Aufgabe. In: Tagungsunterlagen<br />
19. Seminar Schalung + Rüstung. Hrsg.: Bauakademie Biberach, Eigenverlag,<br />
Biberach<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 91
Motzko C (2005) Aktuelle Schalungstechnik <strong>für</strong> Wand und Decke. In: Baugewerbe, Heft<br />
8/2005, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln<br />
Klingenberger J, Motzko C (2005) Abbruch und Bestandsänderung von Gebäuden am Beispiel<br />
der industriell gefertigten Wohnbauten in den ostdeutschen Bundesländern. In:<br />
Die Zukunft des Wohnungsbaus in Polen, Przyszlosc mieszkalnictwa w Polsce,<br />
Nowiny PTM, Heft 4, Wydawnictwo DOM, Warschau<br />
Motzko C (2005) Sichtbar bleibenden Betonflächen (Sichtbeton) – Grundlagen zur Schalungstechnik.<br />
Bayerische BauAkademie, Feuchtwangen<br />
Motzko C, Hinrichs N, Maffini S (2005) Znaczenie bieżącej ewidencji robót w działalności<br />
przedsiębiorstw budowlanych (Die Bedeutung der Leistungskontrolle im<br />
Bauunternehmen); Księga Konferencyjna, Rok Jubileuszowy Wydziału Inżynierii<br />
Lądowej Politechniki Warszawskiej, Jubiläumsband 90 Jahre des Polytechnikums<br />
Warschau, Warszawa<br />
Motzko C, Gentinetta J (2005) Die Rolle der Ingenieurberatung bei der Realisierung von Public<br />
Private Partnership-Projekten. Deutsches Ingenieurblatt – Hessen, Dezember<br />
Motzko C (2005) Konfliktthema Sichtbeton. Der Bausachverständige, Heft 6/2005, Bundesanzeiger,<br />
Verlag / Fraunhofer IRB Verlag, Köln / Stuttgart<br />
Motzko C (2005) Neue Regelungen zum Schalungseinsatz im Kontext des Sichtbetons. In:<br />
Tagungsunterlagen 20. Seminar Schalung + Rüstung. Hrsg.: Bauakademie Biberach,<br />
Eigenverlag, Biberach<br />
Motzko C, Hoscheid R, Schömbs J, Heister H (2005) Neue Erkenntnisse bezüglich Wechselwirkungen<br />
Schalung – Beton. In: Tagungsunterlagen 15. Kasseler <strong>Baubetrieb</strong>sseminar<br />
Schalungstechnik, Kassel<br />
Motzko C (2006) Mietschalung. Bayerische BauAkademie, Feuchtwangen<br />
Motzko C, Bergheimer H K, Hinrichs N (2006) <strong>Baubetrieb</strong>liche Bedeutung neuer Rechnungslegungsvorschriften.<br />
In: Tiefbau, Heft 1/2006, Erich Schmidt Verlag, München<br />
Motzko C, Schaub K, Stürmer M, Fuchs A (2006) Ergonomiestudie bei Arbeiten zur Erstellung<br />
von Abschottungssystemen. In: Tiefbau, Heft 1/2006, Erich Schmidt Verlag,<br />
München<br />
Motzko C, Gentinetta J, Hinrichs N (2006) Chancen von PPP-Modellen beim Stadthallenbau<br />
und -betrieb Public Private Partnership „light“. Hessentag, Hessisch Lichtenau<br />
Motzko C, Elsebach J, Maffini S (2006) Fernüberwachung und Leistungsermittlung von Baustellen<br />
– Projekt Peri Polska, Forschungsbericht, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der TU Darmstadt,<br />
Eigenverlag<br />
Motzko C (2006) Untersuchung von Einflussgrößen und Kostenänderungen bei Beschleunigungsmaßnahmen<br />
von Bauvorhaben. In: Schnelles Bauen im Hoch- und Industriebau,<br />
Bau und Wissen (Hrsg), Wildegg (Schweiz)<br />
92<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
Motzko C (2006) Wybrane aspekty w zakresie projektowania i wykonawstwa betonu<br />
architektonicznego w Niemczech (Ausgewählte Aspekte der Planung und Ausführung<br />
des Sichtbetons in Deutschland). 20. Internationale Konferenz <strong>für</strong> Wissenschaft und<br />
Technik „Beton i prefabrykacja“ („Beton und Fertigteile“), Jadwisin-Warszawa (Polen)<br />
Motzko C, Gentinetta J, Hinrichs N (2006) Schnittstellen zwischen <strong>Baubetrieb</strong> und Facility<br />
Management. Immobilien Facility Management, FM Forum, Frankfurt<br />
Motzko C, Elsebach J, Maffini S (2006) Digital media based documentation, visualisation and<br />
supervision of construction process. In: International Conference on Adaptability in<br />
Design and Construction, Eindhoven<br />
Motzko C, Hoscheid R (2006) Ermittlung von Wechselwirkungen zwischen Schalungshaut,<br />
Trennmittel und Frischbeton bei der Herstellung von Sichtbeton. In: Tagungsunterlagen<br />
16. Kasseler <strong>Baubetrieb</strong>sseminar Schalungstechnik, Kassel<br />
Klingenberger J, Selz A, Motzko C (2006) Arbeitsgruppe Planen, Entwerfen und Konstruieren:<br />
Interdisziplinäres Lernen, Projektstudium und Studienberatung am Fachbereich<br />
13. In: Festschrift Prof. Böhm, Interdisziplinarität in der Umwelt- und Raumplanung –<br />
Theorie und Praxis. Hrsg.: Verein zur Förderung des <strong>Institut</strong>s WAR der TU Darmstadt,<br />
Eigenverlag, Darmstadt<br />
Motzko C (2006) Beton architektoniczny w Niemczech – najnowsza technologia i<br />
zastosowanie na przykładach (Sichtbeton in Deutschland – neueste Entwicklungen<br />
und Anwendungen an Beispielen). Symposium „Beton architektoniczny –<br />
zastosowanie, technologie, materiały“ (Sichtbeton – Anwendung, Technologie,<br />
Werkstoffe) Bund Polnischer Architekten – Verband Polnischer Bauingenieure und<br />
Bautechniker, Warschau<br />
Motzko C (2006) Schalungstechnische Empfehlungen beim Einsatz von F5- und F6-Betonen<br />
sowie SVB. In: Tagungsunterlagen 21. Seminar Schalung + Rüstung. Hrsg.: Bauakademie<br />
Biberach, Eigenverlag, Biberach<br />
Motzko C, Hoscheid R, Schömbs J, Heister H (2006) „Ermittlung der Wechselwirkungen<br />
zwischen Schalungshaut, Trennmittel und Betonfläche bei der Herstellung von Sichtbeton“<br />
Forschungsbericht: Ergebnisse des AiF Forschungsvorhabens 14018 N (DBV-<br />
Nr. 254)<br />
Klingenberger J (<strong>2007</strong>) Entscheidungshilfe zur Bestimmung von Strategien der Instandhaltung<br />
<strong>für</strong> Gebäude. In: Tagungsband 18. Treffen der Assistenten <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft<br />
und Bauverfahrenstechnik. Hrsg.: <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> und Bauwirtschaft<br />
der TU Graz. Eigenverlag, Graz<br />
Motzko C, Bergheimer H-K, Hinrichs N (<strong>2007</strong>) Die Bedeutung des Fertigstellungsgrades <strong>für</strong><br />
die Baubilanz. In: Bauingenieur, Heft 4/<strong>2007</strong>, Springer VDI Verlag, Düsseldorf<br />
Motzko C (<strong>2007</strong>) Postęp w technologii betonu architektonicznego (Der Fortschritt in der<br />
Sichtbetontechnologie). In: Festschrift Prof. Marian Abramowicz – 75 Jahre,<br />
Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology), Warschau<br />
Motzko C, Hinrichs N, Mehr O, Maffini S (<strong>2007</strong>) Dokumentation und Simulation von Bauprozessen<br />
mithilfe von Bildverarbeitungssystemen In: Simulation in der Bauwirtschaft,<br />
Schriftenreihe Bauwirtschaft, IBW, Universität Kassel<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 93
Elsebach J, Motzko C (<strong>2007</strong>) Zeitnahe Dokumentation und Leistungserfassung von Baumaßnahmen<br />
mit vollsphärischen Fotografien. In: Tiefbau, Heft 9/<strong>2007</strong>, Erich Schmidt<br />
Verlag, München<br />
Motzko C, Ogniwek D (<strong>2007</strong>) Mängel an Sichtbetonflächen und Wertung aus Sicht des Gutachters.<br />
In: Tagungsunterlagen 17. Kasseler <strong>Baubetrieb</strong>sseminar Schalungstechnik,<br />
Kassel<br />
Motzko C (<strong>2007</strong>) Empfehlungen <strong>für</strong> die Anfertigung einer Gefährdungsbeurteilung bei der<br />
Anwendung von Schalungen. In: Tagungsunterlagen 22. Seminar Schalung + Rüstung.<br />
Hrsg.: Bauakademie Biberach, Eigenverlag, Biberach<br />
Bürklin B, Motzko C, Pflug C (<strong>2007</strong>) Neue Entwicklungen im Bereich der Bildinformationssysteme.<br />
In: Festschrift anlässlich der Vollendung des 65. Lebensjahres von Prof. Dr.-<br />
Ing. habil. Harald Schlemmer. Schriftenreihe Fachrichtung Geodäsie, TU Darmstadt<br />
Klingenberger J (2008) Strategische Instandhaltung von Gebäuden. In: Tiefbau, Heft 1/2008,<br />
Erich Schmidt Verlag, München<br />
Motzko C (2008) Neue Erkenntnisse in der Sichtbetontechnologie. In: VDI Berichte 2025<br />
„Verfahrenstechnik im Ingenieurbau“, VDI Verlag, Düsseldorf<br />
Klingenberger J (2008) Modell zur Bildung von Strategien der Instandhaltung <strong>für</strong> Gebäude.<br />
In: Bauingenieur, Heft 3/2008, Springer VDI Verlag, Düsseldorf<br />
Motzko C (2008) Entwicklung eines modularen Fassadenbekleidungssystems <strong>für</strong> Wohnsiedlungsbauten<br />
aus der Nachkriegszeit. Forschungsbericht: TU Darmstadt, Fachgebiet<br />
Entwerfen und Gebäudelehre, Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie, <strong>Institut</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong>, Eigenverlag, Darmstadt<br />
Klingenberger J (2008) Projektstudium und interdisziplinäres Lehren und Lernen am Fachbereich<br />
Bauingenieurwesen und Geodäsie der TU Darmstadt. Vorstellung der Arbeitsgruppe<br />
Planen, Entwerfen und Konstruieren. In: Tagungsband des 19. Assistententreffens<br />
der Bereiche Bauwirtschaft, <strong>Baubetrieb</strong> und Bauverfahrenstechnik. Hrsg.:<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der TU Darmstadt. Eigenverlag, Darmstadt<br />
Ogniwek D, Brockmann T, Hardt R, Fiala H, Kreiner A, Lohaus L, Motzko C, Strauss J (2008)<br />
Gleitbauverfahren Merkblatt. In: Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein e.V., Berlin<br />
Motzko C (2008) Die Komplexität des Sichtbetons. In: Ideas & Profiles, Ratingen<br />
Brockmann T, Kreiner A, Lohaus L, Motzko C (2008) Weiterentwicklung des Gleitbauverfahrens.<br />
In: Beton- und Stahlbetonbau, Heft 7/2008, Ernst & Sohn, Berlin<br />
Motzko C (2008) Arbeitssicherheit im Bauwesen in der Bundesrepublik Deutschland Summer<br />
School 2008, Tongji University Shanghai, VR China, Eigenverlag<br />
Motzko C, Boska, E (2008) Toleranzen im Hochbau aus baubetrieblicher Sicht. In: Verformungsverhalten<br />
von Tragwerken – Toleranzen im Hochbau, TU Darmstadt/TU Kaiserslautern<br />
94<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
Motzko C, Boska, E (2008) Schalungsbelastung durch Hochleistungsbetone mit fließfähiger<br />
Konsistenz – <strong>Baubetrieb</strong>liche Fragestellungen Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben:<br />
Schalungsbelastung durch Hochleistungsbetone mit fließfähiger Konsistenz<br />
(Bundesministerium <strong>für</strong> Verkehr, Bau und Stadtentwicklung BMVBS/Bundesamt <strong>für</strong><br />
Bauwesen und Raumordnung BBR)<br />
Motzko C, Proske T, Boska E (2008) Neue Erkenntnisse zum Frischbetondruck von Hochleistungsbetonen<br />
mit fließfähiger Konsistenz. In: Tagungsunterlagen 18. Kassel-<br />
Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar Schalungstechnik, Kassel<br />
Motzko C, Klingenberger J, Pflug C. (2008) 4D-Modellierung <strong>für</strong> die Prozesssteuerung im<br />
<strong>Baubetrieb</strong>. In: Tagungsunterlagen 23. Seminar Schalung + Rüstung. Hrsg.: Bauakademie<br />
Biberach, Eigenverlag, Biberach<br />
Klingenberger J (2008) Strategische Instandhaltung von Gebäuden. In: Facility Management,<br />
Heft 6/2008, Bauverlag, Gütersloh<br />
Motzko C (2008) Gefährdungsbeurteilung im Baugewerbe. In: VDBUM-Information, Heft<br />
6/2008, Verlag Jens Engel, Weyhe<br />
Klingenberger J, (<strong>2009</strong>) Systematische Instandhaltung – Basis zur nachhaltigen und lebenszyklusorientierten<br />
Erhaltung von Gebäuden. In: Tagungsunterlagen Instandhaltungsmanagement<br />
– langfristige Strategien und bauliche Optimierungen. Hrsg.: Akademie<br />
der Immobilienwirtschaft, Eigenverlag, Berlin<br />
Graubner C A, Motzko C, Proske T (<strong>2009</strong>) Anforderungen an Schalungssysteme bei Verwendung<br />
fließfähiger Hochleistungsbetone. In: Betonwerk + Fertigteil-Technik, 02/<strong>2009</strong>,<br />
Sonderausgabe 53. BetonTage Ulm, <strong>2009</strong><br />
Motzko C, Boska E (<strong>2009</strong>) Gefährdungsbeurteilung im Bereich von Betonierarbeiten. In:<br />
Tiefbau, Heft 3/<strong>2009</strong>, Erich Schmidt Verlag, München<br />
Graubner C A, Motzko C, Proske T, Boska E (<strong>2009</strong>) Schalungsbelastung durch Hochleistungsbetone<br />
mit fließfähiger Konsistenz – Berechnungsmodell und baupraktische<br />
Umsetzung. In: Bauingenieur, Heft 4/<strong>2009</strong>, Springer VDI Verlag, Düsseldorf<br />
Klingenberger J (<strong>2009</strong>) Empfehlungen <strong>für</strong> die systematische Gebäudeinstandhaltung. In:<br />
BauPortal, Heft 5/<strong>2009</strong>, Erich Schmidt Verlag, München<br />
Motzko C (<strong>2009</strong>) Schalung <strong>für</strong> Sichtbeton – Auswahl, Eigenschaften, Wechselwirkungen. In:<br />
Sichtbeton – Planung, Gestaltung, Ausführung. Architekten und Ingenieurforum<br />
West, Stiftung Insel Hombroich<br />
Motzko C, Wakula J, Boska E, Pflug C (<strong>2009</strong>) Analyse von Zeit- und Arbeitsabläufen bei der<br />
Montage von Porenbetonplatten. Forschungsbericht XELLA, TU Darmstadt, Eigenverlag<br />
Motzko C, Kometova S (<strong>2009</strong>) Struktur-, Kosten- und Erlösanalyse der Bürgerhäuser der<br />
Stadt Seligenstadt 2006-<strong>2007</strong>. Forschungsbericht, <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der Darmstadt,<br />
Eigenverlag<br />
Motzko C, Kometova S (<strong>2009</strong>) Public Real Estate Management in the Context of the<br />
Lifecycle Approach. In: Building the 3rd Millennium, Stuttgart<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 95
Motzko C (<strong>2009</strong>) System kształcenia zawodowego kadr technicznych i robotniczych<br />
budownictwa w Niemczech (Das Ausbildungssystem der Bauberufe in Deutschland).<br />
In: Ksi ga Konferencyjna, 55. Konferencja Naukowa Komitetu In ynierii L dowej i<br />
Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB <strong>2009</strong> (In: Konferenzbuch, 55. Wissenschaftskonferenz<br />
der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN), Bereich Bauwesen<br />
sowie des Wissenschaftsrates des Verbandes Polnischer Bauingenieure und Bautechniker<br />
<strong>2009</strong>) Kielce-Krynica<br />
Klingenberger J, Selz A (<strong>2009</strong>) Weiterentwicklung der Lehrveranstaltungen der Arbeitsgruppe<br />
Planen, Entwerfen und Konstruieren im Zuge des Bologna-Prozesses. In: Arbeitsgruppe<br />
PEK – Interdisziplinäre Projektarbeit 1974-<strong>2009</strong>. Hrsg.: Arbeitsgruppe Planen,<br />
Entwerfen und Konstruieren der TU Darmstadt, Eigenverlag, Darmstadt<br />
Motzko C, Pflug C (<strong>2009</strong>) Informationsgewinnung aus Bildern im <strong>Baubetrieb</strong>. In: Festschrift<br />
40 Jahre <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> und Bauwirtschaft. Hrsg.: <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> und<br />
Bauwirtschaft der TU Graz. Eigenverlag, Graz<br />
Motzko C (<strong>2009</strong>) Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen – Normennovellierung. In: Tagungsunterlagen<br />
24. Seminar Schalung + Rüstung. Hrsg.: Bauakademie Biberach, Eigenverlag,<br />
Biberach<br />
Motzko C (<strong>2009</strong>) Aktuelle Aufgaben der Schalungstechnik. In: Tagungsunterlagen 19. Kassel-<br />
Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar Schalungstechnik, Kassel<br />
96<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
4.2.4 Schriftenreihe GSV-TUD-Fachtagungen<br />
Tagungsband 1<br />
Motzko, C (Hrsg)<br />
Sichtbeton – Praxisberichte<br />
Darmstadt, Eigenverlag, 2006<br />
Tagungsband 2<br />
Motzko, C (Hrsg)<br />
Gefährdungsbeurteilung in der Praxis<br />
Darmstadt, Eigenverlag, 2008<br />
Tagungsband 3<br />
Motzko, C (Hrsg)<br />
Neue Normen im Bauwesen (Schalungstechnik)<br />
Darmstadt, Eigenverlag, <strong>2009</strong><br />
4.2.5 Schriftenreihe des Güteschutzverbandes Betonschalungen e.V.<br />
Publikationen unter der Schriftenführung von Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
GSV-Merkblatt Mietschalung<br />
Ratingen/Darmstadt, 1999<br />
Anwendungsbeispiele zum GSV-Merkblatt Mietschalung<br />
Ratingen/Darmstadt, 1999<br />
GSV-Richtlinie Qualitätskriterien von Mietschalungen<br />
Ratingen/Darmstadt, 2000, aktualisiert 2003<br />
GSV-Richtlinie Handhabungs- und Pflegehinweise <strong>für</strong> Schalungssysteme<br />
Ratingen/Darmstadt 2003<br />
GSV-Publikation: Empfehlungen zur Planung, Ausschreibung und zum Einsatz von Schalungssystemen<br />
bei der Ausführung von „Betonflächen mit Anforderungen an das Aussehen“<br />
Ratingen/Darmstadt 2005<br />
GSV-Publikation: Empfehlungen zur Anfertigung einer Gefährdungsbeurteilung bei der Anwendung<br />
von Schalungen<br />
Ratingen/Darmstadt <strong>2007</strong><br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 97
4.3 Referate von Prof. Motzko<br />
4.3.1 Dissertationen<br />
Erstreferate<br />
Siehe Punkt 1.1 Abgeschlossene Promotionen<br />
und Punkt 4.1 Dissertationen am<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
Korreferate<br />
Siehe Punkt 1.1 Abgeschlossene Promotionen<br />
und Punkt 4.1 Dissertationen am<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
sowie<br />
Schade, Bernd<br />
Kostenplanung zur Analyse der Wirtschaftlichkeit<br />
von biologischen Restabfallbehandlungsanlagen<br />
TU Darmstadt, 1998<br />
Referent: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. J. Jager<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Hoffmann, Friedrich<br />
Ungenutzte Potentiale in der Ablauf- und<br />
Fertigungsplanung im Betonbau<br />
Univ.-Gh Kassel, 2000<br />
Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. V. Franz<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Stahl, Volker<br />
Qualitätsmanagement bei Ingenieurprojekten<br />
im Ingenieursektor<br />
TU Darmstadt, 2003<br />
Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.<br />
H. Schlemmer<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Riegel, Gert<br />
Ein softwaregestütztes Berechnungsverfahren<br />
zur Prognose und Beurteilung der<br />
Nutzungskosten von Bürogebäuden<br />
TU Darmstadt, 2004<br />
Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br />
C.-A. Graubner<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
98<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Pfau, Jochen<br />
Untersuchungen der Befestigungstechnik<br />
mit ballistischen Verbindungsmitteln zur<br />
rationellen Erstellung tragender Tafelelemente<br />
in Stahlprofil-Leichtbauweise<br />
TU Darmstadt, <strong>2007</strong><br />
Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. J. Lange<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Brockmann, Christian<br />
Erfolgsfaktoren von Internationalen<br />
Construction Joint Ventures in Südostasien<br />
ETH Zürich, <strong>2007</strong><br />
Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br />
G. Girmscheid<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Dreyer, Jennifer<br />
Prozessmodell zur Gestaltung einer Public<br />
Private Partnership <strong>für</strong> den kommunalen<br />
Straßenunterhalt in der Schweiz<br />
ETH Zürich, 2008<br />
Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br />
G. Girmscheid<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
Norrdine, Abdelmoumen<br />
Untersuchung und Entwicklung neuartiger<br />
Technologien <strong>für</strong> die präzise Positionierung<br />
und Orientierung innerhalb von Gebäuden<br />
TU Darmstadt, 2008<br />
Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.<br />
H. Schlemmer<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko
Kelleter, Michael<br />
Steigerung der Verlegequalität von Kunststoffrohren<br />
in offener Bauweise durch<br />
Reduzierung einbaubedingter Rohrverformungen<br />
RWTH Aachen, <strong>2009</strong><br />
Referent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. R. Osebold<br />
Korreferent: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
4.3.2 Habilitationsschriften<br />
Hofstadler, Christian<br />
Bauablaufplanung und Logistik im <strong>Baubetrieb</strong><br />
TU Graz, 2005<br />
Gutachter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. C. Motzko<br />
4.4 Gutachten<br />
Gutachten zu den Themenkomplexen<br />
• <strong>Baubetrieb</strong>liche Bewertung von gestörten<br />
Bauabläufen<br />
• Monitoring von Bauwerken in Bau- und<br />
Betriebsphasen<br />
• Immobilien-Portfolio-Optimierung bei<br />
Spezialimmobilien<br />
• Sichtbeton: Defekte an sichtbar bleibenden<br />
Betonflächen: Wechselwirkungen<br />
von Schalungshaut, Trennmittel<br />
und Frischbeton<br />
• Toleranzen im Hochbau<br />
• Probleme bei der Abnahme von Bauleistungen<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 99
5 Absolventen<br />
5.1 Absolventen mit Abschlussarbeiten im Fach <strong>Baubetrieb</strong> sowie Absolventen<br />
des Hauptvertiefungsfachs <strong>Baubetrieb</strong><br />
<strong>2007</strong><br />
• Boska, Erik (Dipl. BI)<br />
• Davoudi, Mohammad (M.Sc. BI)<br />
• Ergin, Uluc (M.Sc. BI)<br />
• Greis, Oliver (Dipl. WIBI)<br />
• Haj Stifi, Ahmed (M.Sc. BI)<br />
• Kometova, Svetlana (M.Sc. BI)<br />
• Krause, Thomas (Dipl. WIBI)<br />
• Maar, Andreas (Dipl. WIBI)<br />
• Mohr, Benjamin (M.Sc. BI)<br />
2008<br />
• Bartelmeß, Christina (Dipl. WIBI)<br />
• Becker, Matthias (M.Sc. BI)<br />
• Dyballa, Sebastian (M.Sc. BI)<br />
• Karagüzel, Özgür (M. Sc.)<br />
• Kilic, Ercan (M.Sc. BI)<br />
• Klaric, Pero (Dipl. BI)<br />
• Krieger, Anar (M.Sc. BI)<br />
• Lafferre, Philippe (Doppeldipl. BI)<br />
• Lecomte, Arnaud (Doppeldipl. BI)<br />
<strong>2009</strong><br />
• Binder, Florian (Dipl. BI & Dipl. WIBI)<br />
• Duprospert, Nathalie (Doppeldipl. BI)<br />
• Ehrhardt, Anna (M.Sc. BI)<br />
• Er, Bayram (M.Sc. BI)<br />
• Hecklau, Oliver (Dipl. WIBI)<br />
• Kaiser, Stefan (Dipl. BI)<br />
• Kempel, Julia (Dipl. WIBI)<br />
• Lange, Robert (Dipl. BI)<br />
• Lippert, Peter (Dipl. BI)<br />
• Maus, Verena (M.Sc. BI)<br />
100 <strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
• Mutlu, Bünyamin (M.Sc. BI)<br />
• Osmanagaoglu, Enver (M.Sc. BI)<br />
• Petit, François (Doppeldipl. BI)<br />
• Reichmann, Christoph (Dipl. BI)<br />
• Rosenberger, Daniel (Dipl. WIBI)<br />
• Ruhl, Fabian (Dipl. BI)<br />
• Uning, Gunawan (M.Sc. BI)<br />
• Wegner, Gabriele (M.Sc. BI)<br />
• Winter, Benjamin (Dipl. BI)<br />
• Nenov, Yordan (B.Sc. CE)<br />
• Nikolov, Alexander (B.Sc. CE)<br />
• Nooryar, Fahim (M.Sc. BI)<br />
• Schlabach, Carina (Dipl. WIBI)<br />
• Schroer, Sarah (Dipl. BI)<br />
• Siegel, Christian (Dipl. WIBI)<br />
• Sokolowski, Andrzej (Dipl. BI)<br />
• Szczepankiewicz,<br />
Magdalena (M.Sc. BI)<br />
• Nienstädt, Hanjo (Dipl. WIBI)<br />
• Placke, Björn (Dipl. WIBI)<br />
• Roedig, Sebastian (Dipl. WIBI)<br />
• Schäfer, Christian (B.Sc. BI & Geod)<br />
• Scholz, Benjamin (Dipl. BI)<br />
• Schütz, Klaus-Peter (Dipl. WIBI)<br />
• Setiawan, Agus (M.Sc. BI)<br />
• Widera, Raphael (Dipl. BI)<br />
• Zielonka, Marcin (Dipl. BI)
5.2 Studien- und Vertieferarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
<strong>2007</strong><br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Bartelmeß, Christina Das finanzielle Rechnungswesen und die KLR<br />
der Kommune unter bes. Berücksichtigung des<br />
Immobilienmanagements der öffentl. Hand<br />
Boxler, Christoph Optimierungspotential bei Bau und Betrieb von<br />
Feuerwachen und Feuerwehrhäusern<br />
Hinrichs, Nils<br />
Hinrichs, Nils<br />
Klaric, Pero Positionsbestimmung in Gebäuden (ILPS) Pflug, Christoph<br />
Lafferre, Philippe Das Immobilienmanagement der öffentlichen<br />
Hand in Frankreich<br />
Lammersdorf,<br />
Theresa<br />
Kommunales Immobilien-Portfoliomanagement –<br />
Untersuchungen zur Einführung eines zentralen<br />
Gebäudemanagements<br />
Petit, François Untersuchung von mobilen Datenerfassungssystemen<br />
zur Verknüpfung mit Bauwerksinformationssystemen<br />
Przemeck, Daniel Lebenszykluskosten von Fassaden im Wohnungsbau<br />
Schlabach, Carina Befragung von Sichtbetonfachleuten zu häufig<br />
auftretenden Beanstandungen an Sichtbetonflächen<br />
Schmitt, Sandra Kommunales Schulbaumanagement und die<br />
Bedeutung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung<br />
bei PPP-Schulprojekten<br />
Schroer, Sarah Einsatzszenarien von 3-D-Laserscannern im<br />
Baustellenumfeld<br />
2008<br />
Hinrichs, Nils<br />
Hinrichs, Nils<br />
Elsebach, Jens<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Schömbs, Julia<br />
Hinrichs, Nils<br />
Maffini, Sebastian<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Duprospert, Nathalie Nachhaltiges Bauen – Internationale Zertifizierungsmodelle,<br />
aktuelle Entwicklung in Deutschland<br />
Feldmann, Stefanie Untersuchung der in Deutschland üblichen Genehmigungsverfahren<br />
<strong>für</strong> Eisenbahninfrastrukturanlagen<br />
mit Hilfe einer Expertenbefragung<br />
Greis, Oliver Optimierung von Planungsabläufen im Ingenieurbüro<br />
durch Planverwaltungsanwendungen<br />
und Planräume – Betrachtung der Anwendung<br />
von Planverwaltungsanwendungen<br />
Hettergott, Thomas Die Präqualifikation als Instrument zur Auswahl<br />
von Projektpartnern in der Bauwirtschaft<br />
Giesa, Ingo<br />
Schäfer, Markus<br />
Giesa, Ingo<br />
Huppenbauer, Falk<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 101
Verfasser Titel Betreuer<br />
König, Sabine Foreign construction companies developing<br />
supplier relations – A survey of supply chain<br />
communication in Germany and Sweden<br />
102 <strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Motzko, Christoph<br />
Lecomte, Arnaud Baumärkte zur Dämmung von Wohngebäuden Bergmann,<br />
Matthias<br />
Metz, Eva Claim-Management bei Bauprojekten unter Einbeziehung<br />
der FIDIC-Vertragswerke<br />
Roedig, Sebastian Ausarbeitung eines Anforderungsprofils zur Bewertung<br />
von Immobilien mittels mobiler Datenerfassung<br />
und digitaler Bauwerksinformationssysteme<br />
Safi, Nasim Aufbau- und Ablauforganisation in der Fassadenmodernisierung<br />
Sokolowski, Andrzej Leitfaden als Entscheidungshilfe <strong>für</strong> den Einsatz<br />
von Photovoltaik-Technik bei Neubau-Gebäuden<br />
und Bauen im Bestand<br />
Warkus, Tobias Studie zur Entwicklung der europäischen Bauindustrie<br />
Heck, Detlef<br />
Elsebach, Jens<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Motzko, Christoph<br />
Giesa, Ingo<br />
Weiland, Sonja Automatisierte Bauteilerkennung Elsebach, Jens<br />
Widera, Raphael Dokumentation von Ausbauarbeiten mit vollsphärischen<br />
Fotografien<br />
<strong>2009</strong><br />
Elsebach, Jens<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Binder, Florian Entwicklung eines webbasierten Bautagebuchs Pflug, Christoph<br />
Blechinger, Britta Eine Analyse der brandschutztechnischen Mängel<br />
eines Bürogebäudes im Bestand als Grundlage<br />
zur Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
Erdogan, Ibrahim Nachhaltiges Bauen – Internationale Zertifizierungsmodelle<br />
– aktuelle Entwicklung in Deutschland<br />
Friederich, Jonas Kundenanforderungen im Lebenszyklus von Büroimmobilien<br />
in Deutschland<br />
Jäger, Marco Bewertung von Fassadensystemen – Ein Vergleich<br />
marktgängiger und konzeptioneller Systeme<br />
zur Modernisierung von Außenwänden<br />
Jost, Myriam Accomplishment of cost control processes on<br />
Canadian construction sites<br />
Kaiser, Stefan Arbeitsanweisung zur Herstellung von Sichtbetonoberflächen<br />
Bothmann, Felix<br />
Giesa, Ingo<br />
Giesa, Ingo<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Motzko, Christoph<br />
Boska, Erik
Verfasser Titel Betreuer<br />
Kempel, Julia Nachhaltigkeitsbewertung in der Baubranche –<br />
Betrachtung der Einführung des DGNB Labels<br />
auf dem deutschen Baumarkt<br />
Klingenberger,<br />
Jörg<br />
Lange, Robert Passungsproblematik beim Bauen im Bestand Bergmann,<br />
Matthias<br />
Lehr, Wolfram Konzeption eines Controllingsystems <strong>für</strong> die<br />
öffentliche Hand im Rahmen eines Public Private<br />
Partnership-Projektes<br />
Lippert, Peter Aufbau eines regelbasierten Expertensystems<br />
zur Analyse von geometrischen Gebäudemodellen<br />
Maar, Andreas Leistungscontrolling mit Raumbuchkalkulationen<br />
und vollsphärischen Fotografien<br />
Munck, Thomas Integrating activity based costing and simulated<br />
agent system for the cost estimation of construction<br />
projects<br />
Nienstädt, Hanjo Der deutsche Immobilienmarkt im Wandel-<br />
Kundenanforderungen und Nebenkosten bei<br />
gewerblichen Immobilien<br />
Pellar, Heiko Analyse des deutschen Büroimmobilienmarktes<br />
seit 2005 – Entwicklungslinien und aktuelle<br />
Markttrends<br />
Scholz, Benjamin Streitregulierungsverfahren im Vergleich<br />
Deutschland – Österreich<br />
Schreiber, Charlotte Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Nachhaltiges Bauen –<br />
Entstehung und aktuelle Entwicklungen<br />
Siegel, Christian Abwicklung von PPP-Projekten im öffentlichen<br />
Hochbau aus der Perspektive des Baupartners<br />
Thiel, Julian Fragebogenkonzeption zur Untersuchung des<br />
Status quo des Controllings der Öffentlichen<br />
Hand während der Nutzungsphase von Public<br />
Private Partnership-Projekten<br />
Vialis, Marjorie Eine Analyse brandschutztechnischer Mängel<br />
eines Bürogebäudes im Bestand als Grundlage<br />
zur Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
Yücel, Murat Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren<br />
Energien aus der Sicht der Bauunternehmung<br />
Zielonka, Marcin Bauverfahrenstechnische Analyse des Einsatzes<br />
von Stahlfaserbeton<br />
Kometova,<br />
Svetlana<br />
Mehr, Oliver<br />
Elsebach, Jens<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Giesa, Ingo<br />
Giesa, Ingo<br />
Klingenberger,<br />
Jörg<br />
Giesa, Ingo<br />
Klingenberger,<br />
Jörg<br />
Kometova,<br />
Svetlana<br />
Bothmann, Felix<br />
Hinrichs, Nils<br />
Jakob, Mathias<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 103
5.3 Diplomarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
<strong>2007</strong><br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Krause, Thomas Entwicklung eines Anforderungsprofils <strong>für</strong><br />
Bauwerksinformationsmodelle im Facility Management<br />
Petit, François Visualisierung als Mittel des Wissensmanagements<br />
im Bauwesen<br />
Reichmann,<br />
Christoph<br />
104 <strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Kalkulatorischer Verfahrensvergleich bei Sichtbeton<br />
unter Berücksichtigung der Sichtbetonklassen<br />
am Beispiel des Bauvorhabens "Hessische<br />
Zentrale <strong>für</strong> Datenverarbeitung HZD"<br />
Rosenberger, Daniel Entwicklung eines Systems zur digitalen Dokumentation<br />
von Baumaßnahmen – Digitales<br />
Berichtswesen<br />
Ruhl, Fabian Immobilienwertermittlung der öffentlichen<br />
Hand<br />
Winter, Benjamin Vergleichende Analyse verschiedener berührungsloser<br />
Messsysteme auf Baustellen<br />
2008<br />
Elsebach, Jens<br />
Elsebach, Jens<br />
Schömbs, Julia<br />
Elsebach, Jens<br />
Hinrichs, Nils<br />
Maffini, Sebastian<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Bartelmeß, Christina Analyse gegenwärtiger Verfahren der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung<br />
im Rahmen von<br />
PPP-Vorhaben unter bes. Berücksichtigung der<br />
monetären und nicht-monetären Faktoren der<br />
konventionellen Beschaffungsvariante am Beispiel<br />
eines Schulprojektes<br />
Klaric, Pero Die Ultra-Breitband-Technologie <strong>für</strong> das Bauwesen<br />
Lafferre, Philippe Untersuchung der 4D-Modellierung <strong>für</strong> die<br />
Zwecke der Bauausführung<br />
Lecomte, Arnaud Wirtschaftlichkeit von Fassadenmodernisierungen<br />
Schlabach, Carina Project Alliancing – Funktionsweise des australischen<br />
Konzepts und Anwendungsmöglichkeiten<br />
in Deutschland<br />
Schroer, Sarah Analyse des Dokumentenmanagements und<br />
der in Schriftverkehr abgebildeten Prozesse im<br />
Bauwesen<br />
Kometova,<br />
Svetlana<br />
Pflug, Christoph<br />
Pflug, Christoph<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Maffini, Carola<br />
Mehr, Oliver
Verfasser Titel Betreuer<br />
Sokolowski, Andrzej Untersuchung der Adaption von im Ausland<br />
entwickelten Lean Construction-Werkzeugen an<br />
die besonderen Bedingungen in der Deutschen<br />
Bauwirtschaft<br />
<strong>2009</strong><br />
Giesa, Ingo<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Binder, Florian Controllingsysteme im Bereich Facility Management<br />
bei der Öffentlichen Hand und privatrechtlichen<br />
Unternehmen (Dipl. WIBI)<br />
Binder, Florian Entwicklung eines webbasierten Informationssystems<br />
<strong>für</strong> die Zwecke der Bauprozesssteuerung<br />
(Dipl. BI)<br />
Duprospert, Nathalie Modellierung der Lebenszykluskosten <strong>für</strong> Büroimmobilien<br />
in Deutschland<br />
Kaiser, Stefan Einflüsse der Ergonomie auf Vorgabezeiten im<br />
<strong>Baubetrieb</strong><br />
Kempel, Julia Einführung in die Baukalkulation und die einschlägigen<br />
Normen und Verfahren in Russland<br />
Lange, Robert Bauen im Bestand: Schwerpunkt Brandschutz –<br />
Eine Analyse der brandschutztechnischen Mängel<br />
eines Bürogebäudes im Bestand als Grundlage<br />
zur Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
Lippert, Peter Expertensystemgerechte dreidimensionale Gebäudemodellierung<br />
Placke, Björn Barrierefreies Bauen bei Bestandsimmobilien -<br />
Untersuchung der Kostenauswirkungen auf den<br />
Lebenszyklus einer Immobilie und Darstellung<br />
der zusätzlichen Anforderungen an den Brandschutz<br />
Roedig, Sebastian Untersuchung der Baumethoden von Sakralbauten<br />
im Zeitraum vom Mittelalter bis zur Renaissance<br />
in Europa<br />
Scholz, Benjamin Praxisanforderungen an Simulationswerkzeuge<br />
im <strong>Baubetrieb</strong><br />
Schütz, Klaus-Peter Untersuchungen zur Einführung eines Computer<br />
Aided Facility Management<br />
Widera, Raphael Eine Analyse der brandschutztechnischen Mängel<br />
eines Bürogebäudes im Bestand als Grundlage<br />
zur Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
Zielonka, Marcin Bauen im Bestand: Schwerpunkt Brandschutz –<br />
Eine Marktanalyse zur Bestimmung von Kosten<br />
zur Beseitigung häufig auftretender Mängel<br />
beim baulichen Brandschutz<br />
Kometova,<br />
Svetlana<br />
Pflug, Christoph<br />
Giesa, Ingo<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Kometova,<br />
Svetlana<br />
Bothmann, Felix<br />
Mehr, Oliver<br />
Pallmer, Leif<br />
Motzko, Christoph<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Kometova,<br />
Svetlana<br />
Bothmann, Felix<br />
Bothmann, Felix<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 105
5.4 Bachelorarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
2008<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Nenov, Yordan Kosten- und Leistungsrechnung im kommunalen<br />
Immobilienmanagement<br />
Nikolov, Alexander Prozesskostenrechnung im kommunalen Immobilienmanagement<br />
<strong>2009</strong><br />
106 <strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
Kometova,<br />
Svetlana<br />
Kometova,<br />
Svetlana<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Schäfer, Christian<br />
Eine Analyse der Kosten zur Behebung ausgewählter<br />
brandschutztechnischer Mängel als<br />
Grundlage zur detaillierten Wertermittlung von<br />
Bestandsgebäuden<br />
5.5 Masterarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
<strong>2007</strong><br />
Bothmann, Felix<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Davoudi,<br />
Mohammad<br />
Gewerkeübergreifende Schnittstellen bei der<br />
Ausführung von Leistungen des Ausbaus und<br />
der TGA<br />
Ergin, Uluc Entwicklung und Zusammensetzung von Gebäudeerstellungskosten<br />
Haj Stifi, Ahmed Entwicklung eines Moduls zur Mängeldokumentation<br />
Kometova, Svetlana Vergleichende Untersuchung ausgewählter<br />
Baunormen zwischen Deutschland und Russland<br />
Maffini, Sebastian<br />
Maffini, Sebastian<br />
Pflug, Christoph<br />
Heck, Detlef<br />
Mutlu, Bünyamin Entwicklung eines FM-Moduls Pflug, Christoph<br />
Osmanagoglou,<br />
Enver<br />
Berührungslose LF bei Arbeiten an der TGA Maffini, Sebastian<br />
Wegner, Gabriele Entwicklung eines räumlich gestützten Softwaretools<br />
zur Leistungserfassung von Ausbau-<br />
und TGA-Arbeiten in Bauwerksinformationsmodellen<br />
Elsebach, Jens
2008<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Becker, Matthias Ermittlung von Aufwandswerten <strong>für</strong> Schalungsarbeiten<br />
bei erhöhten Anforderungen an die<br />
Betonoberfläche (Sichtbeton)<br />
Dyballa, Sebastian Eine Analyse der brandschutztechnischen Mängel<br />
eines Bürogebäudes im Bestand als Grundlage<br />
zur Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />
Schömbs, Julia<br />
Bothmann, Felix<br />
Karagüzel, Özgür 4D-Simulationen von Bauprozessen Pflug, Christoph<br />
Kilic, Ercan Methoden und Werkzeuge der Arbeitsvorbereitung<br />
im <strong>Baubetrieb</strong><br />
Krieger, Anar <strong>Baubetrieb</strong>liche Untersuchung von Fassadenarbeiten<br />
Nooryar, Fahim Schwachstellen bei Fassadensystemen – Eine<br />
Untersuchung zu Systematisierung und Prävention<br />
Szcepankiewicz,<br />
Magdalena<br />
<strong>2009</strong><br />
Pflug, Christoph<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Untersuchung der Ultra Breitband Technologie Pflug, Christoph<br />
Verfasser Titel Betreuer<br />
Ehrhardt, Anna Modellierung von Verteil- und Rüstzeiten <strong>für</strong> die<br />
Multiagentensimulation im Bauwesen<br />
Er, Bayram Anwendung der Lean Construction in Deutschland<br />
Maus, Verena Gebäudedienstleistungen am deutschen Büroimmobilienmarkt<br />
– Marktanalyse und Modellierung<br />
einer nutzungskostenoptimierten Planung<br />
Setiawan, Agus Anpassung von im Ausland entwickelten Lean<br />
Construction-Werkzeugen an die besonderen<br />
Bedingungen in der Deutschen Bauindustrie<br />
Bergmann,<br />
Matthias<br />
Klingenberger,<br />
Jörg<br />
Giesa, Ingo<br />
Giesa, Ingo<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 107
6 Mandate<br />
6.1 Mandate von Prof. Motzko innerhalb der Universität<br />
seit 13/01/1999 Vertreter der Professoren im Förderungsausschuss <strong>für</strong> ausländische<br />
Studierende an der Technischen Universität Darmstadt<br />
01/10/2001 – 30/09/2004 Dekan des Fachbereiches Bauingenieurwesen und Geodäsie<br />
01/10/2004 – 30/09/<strong>2007</strong> Prodekan des Fachbereiches Bauingenieurwesen und Geodäsie<br />
seit 2003 Vorstandsrat in der „Vereinigung von Freunden der<br />
Technischen Universität zu Darmstadt e.V.“<br />
seit 2003 Vorstandsmitglied „Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar e.V.“<br />
seit 2005 Mitglied der Auswahlkommission „Kurt-Ruths-Preis“<br />
6.2 Mandate von Prof. Motzko außerhalb der Universität<br />
seit 1994 Mitglied des Aufsichtsrates der HOCHTIEF Polska und<br />
vormaliger Beteiligungsgesellschaften<br />
seit 1999 1. Vorsitzender Güteschutzverband Betonschalungen e.V.<br />
seit 2001 Mitveranstalter des Kassel-Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminars<br />
Schalungstechnik<br />
seit 2004 Mitglied im Kuratorium der Stiftung Bauwesen<br />
seit 2005 Gutachter „Alexander von Humboldt-Stiftung“<br />
108 <strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>
7 <strong>Institut</strong>sleben<br />
7.1 2. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong> in München<br />
Die 2. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
fanden vom 29. November bis 02.<br />
Dezember <strong>2007</strong> in München statt. Neben<br />
der intensiven Diskussion der laufenden<br />
Forschungsvorhaben standen Besuche<br />
interessanter Bauvorhaben im Mittelpunkt<br />
der Veranstaltung.<br />
Den Auftakt der <strong>Institut</strong>stage bildete am<br />
Donnerstag ein gemeinsamer Besuch des<br />
Kabaretts „Niveauwonieniveauwar“ des<br />
Duos „Schwarze Grütze“.<br />
Am Freitag stand zunächst ein Besuch der<br />
Baustelle zur Erweiterung der Münchner<br />
U-Bahn in Moosach auf dem Programm.<br />
Hier konnten sich alle ein Bild von den<br />
technologisch und baubetrieblich komplexen<br />
Anforderungen an ein Bauvorhaben<br />
mit Tunnelbohrmaschine im Innenstadtbereich<br />
machen.<br />
Abb. 1: Besuch der U-Bahnbaustelle „Moosach“<br />
Nachmittags folgte ein Tagungsblock mit<br />
der Vorstellung und Diskussion der aktuellen<br />
Promotionsvorhaben des <strong>Institut</strong>s. Im<br />
Zentrum der Präsentationen standen die<br />
Darstellung der bisher erzielten Ergebnis-<br />
se sowie ein Ausblick hinsichtlich der weiteren<br />
Forschungsschritte. Die Teilnehmer<br />
konnten einen Überblick über das Spektrum<br />
der Forschung gewinnen und im<br />
Rahmen der sich anschließenden Diskussionen<br />
wertvolle Anregungen und ein<br />
konstruktives Feedback zu ihrer eigenen<br />
Forschungsarbeit erhalten.<br />
Am Samstagvormittag wurde die Baustelle<br />
des Hochhauses „Süddeutscher Verlag“<br />
besucht. Hier stand vor allem die anspruchsvolle<br />
Logistik in der Ausbauphase<br />
eines derartigen Gebäudes im Zentrum<br />
des Interesses der Teilnehmer.<br />
Abb. 2: Gruppenfoto auf der Baustelle „SV-Hochhaus“<br />
Im Anschluss an den Baustellenrundgang<br />
konnten die Teilnehmer die Brückenbauausstellung<br />
im Deutschen Museum erkunden<br />
und die Münchner Innenstadt im<br />
Rahmen einer Führung kennen lernen.<br />
Diese endete am Weihnachtsmarkt auf<br />
dem Marienplatz. Den Abschluss der <strong>Institut</strong>stage<br />
bildete ein gemeinsames Abendessen.<br />
7.2 3. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> 2008 in Hamburg<br />
Vom 27. bis 30. November 2008 fanden<br />
die 3. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />
in Hamburg statt. Neben der intensiven<br />
Diskussion der laufenden Forschungs-<br />
und Promotionsvorhaben stan-<br />
den ein Baustellenbesuch sowie aktuelle<br />
und strategische Themen im Mittelpunkt<br />
der Veranstaltung.<br />
Nach der gemeinsamen Anreise am Donnerstagnachmittag<br />
per Bahn begann die<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 109
Veranstaltung mit dem Besuch von Alma<br />
Hoppes Lustspielhaus in Eppendorf. Das<br />
immer aktuelle Kabarett-Programm „Ich<br />
war’s nicht!“ fand regen Anklang bei den<br />
Teilnehmern.<br />
Der zweite Tag startete mit einem Rundgang<br />
durch die Hafen-City, dem größten<br />
europäischen Stadtentwicklungsgebiet.<br />
Im Anschluss wurden die Teilnehmer von<br />
der HOCHTIEF Construction AG auf der<br />
Baustelle Elbphilharmonie am Sandtorhafen<br />
empfangen. Neben einer allgemeinen<br />
Einführung in das Projekt, das schwierige<br />
politische Umfeld und den bisherigen<br />
Bauablauf machten vor allem die intensive<br />
Diskussion der Elementfassade und der<br />
anschließende Rundgang diesen Baustellenbesuch<br />
zu einem Höhepunkt der gesamten<br />
Veranstaltung (Abb. 1).<br />
Abb. 1: Rundgang auf der Baustelle Elbphilharmonie<br />
Nachmittags wurde mit einem Tagungsblock<br />
fortgesetzt. Alle Doktoranden präsentierten<br />
im Rahmen von Vorträgen den<br />
Fortschritt ihrer Forschungsarbeiten. Die<br />
Forschungsziele, die Forschungsmethodik<br />
und die angestrebten Forschungsergeb-<br />
110 <strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />
nisse sorgten vielfach <strong>für</strong> intensive Diskussionen.<br />
Am dritten Tag reflektierte Prof. Motzko in<br />
einem zweiten Tagungsblock zunächst die<br />
Diskussionen des Vortags, bevor er die<br />
Ziele und die zentralen Aufgaben der <strong>Institut</strong>sarbeit<br />
<strong>für</strong> das Jahr <strong>2009</strong> darlegte.<br />
Danach referierte Dr. Klingenberger über<br />
die Regularien bei der Abwicklung von<br />
studentischen Studien- bzw. Abschlussarbeiten<br />
und gab wertvolle Hinweise zur<br />
Realisierung wissenschaftlicher Veröffentlichungen.<br />
Im Anschluss fand eine Führung durch die<br />
Quartiere der Speicherstadt und der Hafen-City<br />
statt. Dabei wurden historische,<br />
stadtplanerische und bautechnische Aspekte<br />
thematisiert (Abb. 2).<br />
Abb. 2: Gruppenfoto vor dem Überseequartier in der Hafen-City<br />
Nach einer Besichtigung des alten Elbtunnels<br />
fanden die <strong>Institut</strong>stage mit einem<br />
stimmungsvollen Abend in St. Pauli ihren<br />
Abschluss.<br />
7.3 4. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2009</strong> im Kleinwalsertal<br />
Für das Jahr <strong>2009</strong> wurde als Veranstaltungsort<br />
der <strong>Institut</strong>stage vom 10. bis 13.<br />
September das Waldemar-Petersen-Haus<br />
(Abb. 1) der TU Darmstadt im Kleinwalsertal<br />
gewählt.<br />
Der erste Tag war dem praktischen Teil<br />
des <strong>Baubetrieb</strong>s gewidmet: So wurde<br />
eine Exkursion auf die Baustelle des Pfändertunnels<br />
unternommen. Hier gab es die<br />
Möglichkeit, eine Tunnelbormaschine<br />
(Abb. 2) unmittelbar im Betrieb zu erkunden.<br />
Von der Bauleitung des Pfändertunnels<br />
wurden zahlreiche Informationen betreffend<br />
der technologischen und ökonomischen<br />
Aspekte der Bauausführung vorgestellt.<br />
Das Programm am Freitag sah einen Tagungsblock<br />
mit strategischen <strong>Institut</strong>sthemen<br />
und der Diskussion der laufenden<br />
Promotionsvorhaben vor.
Abb. 1: Waldemar-Petersen-Haus<br />
Abb. 2: Tunnelbohrmaschine im Pfändertunnel<br />
Zunächst wurde von Prof. Motzko eine<br />
positive Bilanz hinsichtlich der Arbeit des<br />
vergangenen Jahres gezogen sowie die<br />
Ziele und Aufgaben <strong>für</strong> das kommende<br />
Jahr definiert. Anschließend erläuterte<br />
Prof. Motzko allgemeine Anforderungen<br />
an die Qualität der Forschung und die Erarbeitung<br />
von Dissertationen am <strong>Institut</strong>.<br />
Dem folgte die Vorstellung und Diskussion<br />
der laufenden Promotionsprojekte. So<br />
konnten alle Teilnehmer einen aktuellen<br />
Überblick über die Forschung am <strong>Institut</strong><br />
„en détail“ gewinnen und die Schnittstellen<br />
zwischen den verschiedenen Themen<br />
diskutieren.<br />
Am Samstagvormittag folgte eine Besichtigung<br />
der Breitachklamm. Diese ist ein<br />
einzigartiges Naturschauspiel, das vor etwa<br />
10.000 Jahren durch das Abschmelzen<br />
des Breitachgletschers entstanden ist<br />
(Abb. 3).<br />
Nach einem Mittagessen an der Talstation<br />
der Söllereckbahn und dem Erleben der<br />
dortigen Sommerrodelbahn folgte eine<br />
Wanderung von der Bergstation der<br />
Söllereckbahn zurück zum Waldemar-<br />
Petersen-Haus.<br />
Abb. 3: Breitachklamm<br />
Abb. 4: Wanderung im Kleinwalsertal<br />
Der gemütliche Abschluss der <strong>Institut</strong>stage<br />
fand schließlich bei einem Abendessen<br />
in Oberstdorf statt.<br />
Abb. 5: Ausklang der <strong>Institut</strong>stage<br />
<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 111
��������������������������������<br />
�����������������������<br />
���������������������<br />
���������������<br />
�����������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
��������������������������������������<br />
����������������������