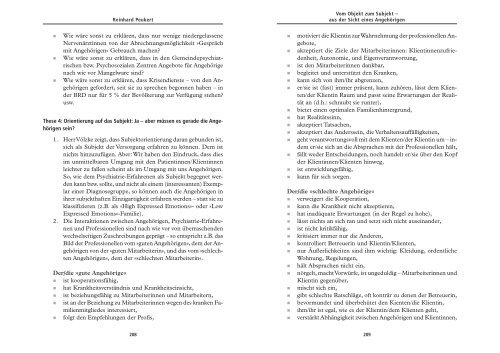25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.
25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.
25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Reinhard Peukert<br />
n Wie wäre sonst zu erklären, dass nur wenige niedergelassene<br />
Nervenärztinnen von der Abrechnungsmöglichkeit »Gespräch<br />
mit Angehörigen« Gebrauch machen?<br />
n Wie wäre sonst zu erklären, dass in den Gemeindepsychiatrischen<br />
bzw. Psychosozialen Zentren Angebote für Angehörige<br />
nach wie vor Mangelware sind?<br />
n Wie wäre sonst zu erklären, dass Krisendienste – von den Angehörigen<br />
gefordert, seit sie zu sprechen begonnen haben – in<br />
der BRD nur für 5 % der Bevölkerung zur Verfügung stehen?<br />
usw.<br />
These 4: Orientierung auf das Subjekt: Ja – aber müssen es gerade die Angehörigen<br />
sein?<br />
1. Herr Völzke zeigt, dass Subjektorientierung daran gebunden ist,<br />
sich als Subjekt der Versorgung erfahren zu können. Dem ist<br />
nichts hinzuzufügen. Aber: Wir haben den Eindruck, dass dies<br />
im unmittelbaren Umgang mit den Patientinnen/Klientinnen<br />
leichter zu fallen scheint als im Umgang mit uns Angehörigen.<br />
So, wie dem <strong>Psychiatrie</strong>-Erfahrenen als Subjekt begegnet werden<br />
kann bzw. sollte, und nicht als einem (interessanten) Exemplar<br />
einer Diagnosegruppe, so können auch die Angehörigen in<br />
ihrer subjekthaften Einzigartigkeit erfahren werden – statt sie zu<br />
klassifizieren (z.B. als »High Expressed Emotions«- oder »Low<br />
Expressed Emotions«-Familie).<br />
2. Die Interaktionen zwischen Angehörigen, <strong>Psychiatrie</strong>-Erfahrenen<br />
und Professionellen sind nach wie vor von überraschenden<br />
wechselseitigen Zuschreibungen geprägt – so entspricht z.B. das<br />
Bild der Professionellen vom »guten Angehörigen«, dem der Angehörigen<br />
von der »guten Mitarbeiterin«, und das vom »schlechten<br />
Angehörigen«, dem der »schlechten Mitarbeiterin«.<br />
Der/die »gute Angehörige«<br />
n ist kooperationsfähig,<br />
n hat Krankheitsverständnis und Krankheitseinsicht,<br />
n ist beziehungsfähig zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,<br />
n ist an der Beziehung zu Mitarbeiterinnen wegen des kranken Familienmitgliedes<br />
interessiert,<br />
n folgt den Empfehlungen der Profis,<br />
Vom Objekt zum Subjekt –<br />
aus der Sicht eines Angehörigen<br />
208 209<br />
n motiviert die Klientin zur Wahrnehmung der professionellen Angebote,<br />
n akzeptiert die Ziele der Mitarbeiterinnen: Klientinnenzufriedenheit,<br />
Autonomie, und Eigenverantwortung,<br />
n ist den Mitarbeiterinnen dankbar,<br />
n begleitet und unterstützt den <strong>Kranke</strong>n,<br />
n kann sich von ihm/ihr abgrenzen,<br />
n er/sie ist (fast) immer präsent, kann zuhören, lässt dem Klienten/der<br />
Klientin Raum und passt seine Erwartungen der Realität<br />
an (d.h.: schraubt sie runter),<br />
n bietet einen optimalen Familienhintergrund,<br />
n hat Realitätssinn,<br />
n akzeptiert Tatsachen,<br />
n akzeptiert das Anderssein, die Verhaltensauffälligkeiten,<br />
n geht verantwortungsvoll mit dem Klienten/der Klientin um – indem<br />
er/sie sich an die Absprachen mit der Professionellen hält,<br />
n fällt weder Entscheidungen, noch handelt er/sie über den Kopf<br />
der Klientinnen/Klienten hinweg,<br />
n ist entwicklungsfähig,<br />
n kann für sich sorgen.<br />
Der/die »schlechte Angehörige«<br />
n verweigert die Kooperation,<br />
n kann die Krankheit nicht akzeptieren,<br />
n hat inadäquate Erwartungen (in der Regel zu hohe),<br />
n lässt nichts an sich ran und setzt sich nicht auseinander,<br />
n ist nicht kritikfähig,<br />
n kritisiert immer nur die Anderen,<br />
n kontrolliert Betreuerin und Klientin/Klienten,<br />
n nur Äußerlichkeiten sind ihm wichtig: Kleidung, ordentliche<br />
Wohnung, Regelungen,<br />
n hält Absprachen nicht ein,<br />
n nörgelt, macht Vorwürfe, ist ungeduldig – Mitarbeiterinnen und<br />
Klientin gegenüber,<br />
n mischt sich ein,<br />
n gibt schlechte Ratschläge, oft konträr zu denen der Betreuerin,<br />
n bevormundet und überbehütet den Kienten/die Klientin,<br />
n ihm/ihr ist egal, wie es der Klientin/dem Klienten geht,<br />
n verstärkt Abhängigkeit zwischen Angehörigen und Klientinnen,