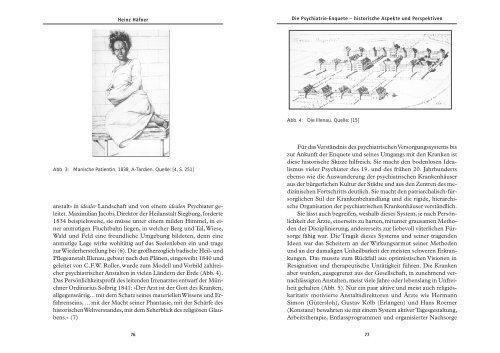25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.
25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.
25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Heinz Häfner<br />
Abb. 3: Manische Patientin, 1838, A-Tardien. Quelle: [4, S. <strong>25</strong>1]<br />
anstalt« in idealer Landschaft und von einem idealen Psychiater geleitet.<br />
Maximilian Jacobi, Direktor der Heilanstalt Siegburg, forderte<br />
1834 beispielsweise, sie müsse unter einem milden Himmel, in einer<br />
anmutigen Fluchtbahn liegen, in welcher Berg und Tal, Wiese,<br />
Wald und Feld eine freundliche Umgebung bildeten, denn eine<br />
anmutige Lage wirke wohltätig auf das Seelenleben ein und trage<br />
zur Wiederherstellung bei (6). Die großherzoglich badische Heil- und<br />
Pflegeanstalt Illenau, gebaut nach den Plänen, eingeweiht 1840 und<br />
geleitet von C.F.W. Roller, wurde zum Modell und Vorbild zahlreicher<br />
psychiatrischer Anstalten in vielen Ländern der Erde (Abb. 4).<br />
Das Persönlichkeitsprofil des leitenden Irrenarztes entwarf der Münchner<br />
Ordinarius Solbrig 1841: »Der Arzt ist der Gott des <strong>Kranke</strong>n,<br />
allgegenwärtig... mit dem Schatz seines materiellen Wissens und Erfahrenseins,<br />
... mit der Macht seiner Phantasie, mit der Schärfe des<br />
historischen Weltverstandes, mit dem Seherblick des religiösen Glaubens.«<br />
(7)<br />
Die <strong>Psychiatrie</strong>-Enquete – historische Aspekte und Perspektiven<br />
Abb. 4: Die Illenau. Quelle: [15]<br />
76 77<br />
Für das Verständnis des psychiatrischen Versorgungssystems bis<br />
zur Ankunft der Enquete und seines Umgangs mit den <strong>Kranke</strong>n ist<br />
diese historische Skizze hilfreich. Sie macht den bodenlosen Idealismus<br />
vieler Psychiater des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts<br />
ebenso wie die Auswanderung der psychiatrischen <strong>Kranke</strong>nhäuser<br />
aus der bürgerlichen Kultur der Städte und aus den Zentren des medizinischen<br />
Fortschritts deutlich. Sie macht den patriarchalisch-fürsorglichen<br />
Stil der <strong>Kranke</strong>nbehandlung und die rigide, hierarchische<br />
Organisation der psychiatrischen <strong>Kranke</strong>nhäuser verständlich.<br />
Sie lässt auch begreifen, weshalb dieses System, je nach Persönlichkeit<br />
der Ärzte, einerseits zu harten, mitunter grausamen Methoden<br />
der Disziplinierung, andererseits zur liebevoll väterlichen Fürsorge<br />
fähig war. Die Tragik dieses Systems und seiner tragenden<br />
Ideen war das Scheitern an der Wirkungsarmut seiner Methoden<br />
und an der damaligen Unheilbarkeit der meisten schweren Erkrankungen.<br />
Das musste zum Rückfall aus optimistischen Visionen in<br />
Resignation und therapeutische Untätigkeit führen. Die <strong>Kranke</strong>n<br />
aber wurden, ausgegrenzt aus der Gesellschaft, in zunehmend vernachlässigten<br />
Anstalten, meist viele <strong>Jahre</strong> oder lebenslang in Unfreiheit<br />
gehalten (Abb. 5). Nur ein paar aktive und meist auch religiöskaritativ<br />
motivierte Anstaltsdirektoren und Ärzte wie Hermann<br />
Simon (Gütersloh), Gustav Kolb (Erlangen) und Hans Roemer<br />
(Konstanz) bewahrten sie mit einem System aktiver Tagesgestaltung,<br />
Arbeitstherapie, Entlassprogrammen und organisierter Nachsorge