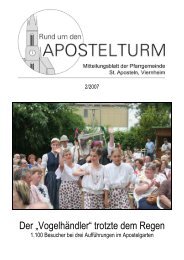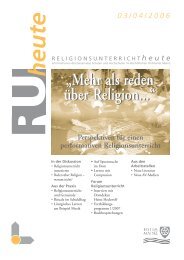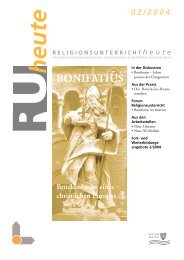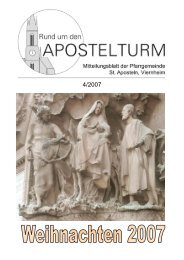R U - beim Bistum Mainz
R U - beim Bistum Mainz
R U - beim Bistum Mainz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
RELIGIONSUNTERRICHTheute 03-04/2005<br />
en, so meint man feststellen zu können, „wichtige religionsdidaktische<br />
Impulse ausgegangen“ 10 . Es ist also nicht etwa das Empfinden,<br />
der Religionsunterricht müsse (wieder einmal) aus einer<br />
Krise herausgeführt werden, die diese Erklärung veranlasst hat,<br />
sondern vielmehr die Einsicht, dass die positive Gesamtsituation<br />
nur gesichert werden könne, wenn man (erneut) zu Innovationen<br />
bereit ist und jetzt „neue religionspädagogische Schwerpunktsetzungen“<br />
11 vornimmt.<br />
Die kirchliche Bedeutung des Religionsunterrichts wird<br />
herausgestrichen.<br />
Schon im Vorwort von Kardinal Lehmann steht zu lesen, „dass<br />
der Religionsunterricht für eine wachsende Zahl von Kindern<br />
und Jugendlichen der wichtigste und oft auch einzige Ort der<br />
Begegnung mit dem Glauben“ 12 ist. Und die Erklärung selbst<br />
lässt keinen Zweifel daran, dass „der Religionsunterricht in der<br />
Schule für die Kirche und für die Zukunft des Glaubens von<br />
großer Bedeutung“ 13 ist. Das hat man in dieser Deutlichkeit<br />
von den deutschen Bischöfen meines Wissens noch nicht gehört.<br />
Es ist dies ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung der<br />
Arbeit der Religionslehrerinnen und Religionslehrer, einer Arbeit,<br />
die eben auch einen Dienst an der Lebendigkeit des Glaubens<br />
und der Kirche darstellt.<br />
Von der gegenwärtigen Schülerschaft wird mit Realitätssinn<br />
und Verständnis gesprochen.<br />
Am Würzburger Synodenbeschluss wurde zu Recht seine realistische<br />
Situationsdiagnose gerühmt. Solchen Realitätssinn beweist<br />
auch die neue Erklärung. Die weitgehende Bezugslosigkeit<br />
vieler Schüler zu Glaube und Kirche wird nicht beschönigt.<br />
Auch den Bischöfen ist bewusst: „Viele Schülerinnen und Schüler<br />
(kennen) weder Kreuzzeichen noch Vaterunser“ 14 ; eine religiöse<br />
Erziehung in der Familie findet kaum mehr statt. Daraufhin<br />
wird aber nicht der Zeigefinger ausgefahren und vom konsumistischen,<br />
hedonistischen und/oder relativistischen Geist unserer<br />
Zeit gesprochen, wie man es in diesem Zusammenhang von allen<br />
möglichen Kanzeln (und ja auch keineswegs ganz zu Unrecht)<br />
hören kann. Vielmehr wird auf die „veränderte religiöse<br />
Situation“ 15 mit geradezu erstaunlichem Verständnis reagiert.<br />
So wird eine ganze Reihe von Motiven angesprochen, die für<br />
eine Abstinenz der Eltern im Bereich religiöser Erziehung verantwortlich<br />
sein könnten: z. B. eigene Unsicherheit im Glauben,<br />
religiöse Sprachlosigkeit, (falsch verstandener) Respekt vor<br />
der religiösen Entscheidungsfreiheit des Kindes, „unbewältigte<br />
16<br />
Erfahrungen mit Fehlformen religiöser Erziehung“ 16 . Keineswegs<br />
dürfe man diese Abstinenz „einfach als Indiz für ein religiöses<br />
Desinteresse“ 17 verstehen. Kurz: Hier wird eine ungeschönte<br />
Darstellung von Veränderungen gegeben, die für die<br />
Kirche gewiss schmerzlich sind; zugleich wird aber eine Interpretation<br />
versucht, die von einem grundsätzlichen Wohlwohlen<br />
gegenüber den Menschen getragen ist; diese Sicht ermöglicht<br />
es, auch in der veränderten Situation produktive Handlungsmöglichkeiten<br />
zu entdecken. Und genau das ist ja nötig, wenn<br />
man „vor neuen Herausforderungen“ steht.<br />
Drei religionsunterrichtliche Aufgaben werden besonders in<br />
den Vordergrund gestellt.<br />
Wie soll den neuen Herausforderungen nun begegnet werden?<br />
Die Antwort darauf stellt das Kernstück der Erklärung dar. Sie<br />
umfasst drei Aufgaben, von denen die Bischöfe wünschen, dass<br />
man sich ihnen im Religionsunterricht zukünftig „mit noch größerem<br />
Nachdruck“ 18 stellt: 1. die „Vermittlung von strukturiertem<br />
und lebensbedeutsamem Grundwissen über den Glauben<br />
der Kirche“, 2. das „Vertrautmachen mit Formen gelebten Glaubens“<br />
und 3. die „Förderung religiöser Dialog- und Urteilsfähigkeit“<br />
19 .<br />
• Mit der ersten Aufgabe (Stichwort „Grundwissen“) wird vor<br />
allem auf die Debatte um Unterrichtsqualität und Unterrichtseffizienz<br />
reagiert. Man möchte in Zukunft klarer sagen<br />
können, „was Schülerinnen und Schüler können sollen, nachdem<br />
sie zehn oder zwölf Jahre am Religionsunterricht teilgenommen<br />
haben“ 20 . Gleichzeitig ist man sich im Klaren darüber,<br />
dass dies nicht dazu führen darf, religiöse Lernprozesse<br />
an der Lebenswirklichkeit und den Fragen der Schüler/innen<br />
vorbei einem vordefinierten Ziel zuzuführen, um so einen<br />
vermeintlich besseren ‚Output‘ zu erzielen. 21<br />
• Mit der zweiten Aufgabe (Stichwort „Erfahrung“) wird auf<br />
die veränderten religiösen Voraussetzungen der Schüler/innen<br />
reagiert, besonders auf den Mangel an Erfahrungen mit<br />
gelebtem Glauben. Die Bischöfe machen deutlich, dass es<br />
für einen „Religionsunterricht in der Teilnehmerperspektive“<br />
22 unerlässlich ist, Bezüge zwischen unterrichtlich gelehrtem<br />
und praktisch gelebtem Glauben herstellen zu können.<br />
Wo man solche Bezüge freilich nicht auf gelegentliche Begegnungen<br />
und Hospitationen beschränken, sondern religiöse<br />
Erfahrung zu einer Dimension religionsunterrichtlichen<br />
Handelns selbst machen möchte, begibt man sich, wie die<br />
bisherige Diskussion um einen solchen „performativen Reli-