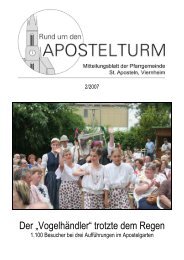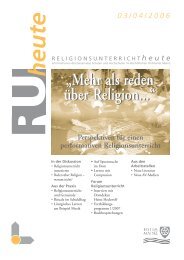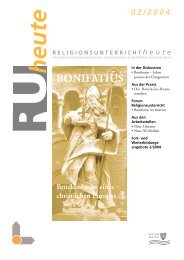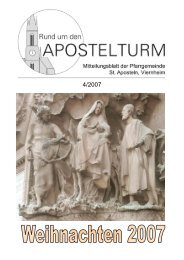R U - beim Bistum Mainz
R U - beim Bistum Mainz
R U - beim Bistum Mainz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
RELIGIONSUNTERRICHTheute 03-04/2005<br />
bundenen Denkoperationen und Verfahren und das ihnen zuzuordnende<br />
Grundlagenwissen“ 9 . Bildungsstandards reduzieren<br />
die Stofffülle vieler Lehrpläne auf die grundlegenden Wissensbestände<br />
eines Faches und schreiben sie verbindlich fest, so dass<br />
überprüft werden kann, ob die Schülerinnen und Schüler über<br />
diese Wissensbestände auch tatsächlich verfügen.<br />
Wie die anderen Fächer steht der Religionsunterricht damit vor<br />
der Herausforderung, die zentralen Inhalte des Faches zu definieren,<br />
die in der Schule realistischerweise vermittelt werden<br />
können und sollen. Die Herausforderung ist nicht neu. Der<br />
Synodenbeschluss hatte schon 1974 gefordert, der Religionsunterricht<br />
müsse sich „entsprechend den Aussagen des Zweiten<br />
Vatikanischen Konzils über die Hierarchie der Wahrheiten (Unitatio<br />
reintegratio 11) auf das Fundament des Glaubens konzentrieren<br />
und das Gesamt des Glaubens vom Zentralen her verstehen.“<br />
(Synodenbeschluss 2.4.1) Allerdings ist die Forderung der<br />
Würzburger Synode nur unzureichend in den Lehrplänen umgesetzt<br />
worden. Insbesondere fehlt es bis heute an einer didaktischen<br />
Strukturierung der Inhalte, die zum einen im Sinne des<br />
vernetzten und kumulativen Lernens für Schülerinnen und Schüler<br />
nachvollziehbare Lernfortschritte und damit motivierende<br />
Lernerfolge ermöglicht und zum anderen den Schülerinnen und<br />
Schülern hilft, eine Vorstellung vom Ganzen des christlichen<br />
Glaubens, von seiner inneren Struktur und Logik zu entwikkeln.<br />
Denn nur in strukturierter Form ist das religiöse Grundwissen<br />
anschlussfähig an das Wissen anderer Fächer und anderer<br />
Lebensbereiche.<br />
Die Frage, welche Inhalte in welchem Umfang und auf welchem<br />
Niveau im Religionsunterricht der Sekundarstufe I realistischerweise<br />
vermittelt werden können, ist nicht leicht zu beantworten.<br />
Die Autoren der Kirchlichen Richtlinien haben in<br />
Anlehnung an die bestehenden Lehrpläne für Real- und Gesamtschulen<br />
inhaltsbezogene Kernkompetenzen definiert und<br />
diese durch Spiegelstriche konkretisiert. Aufgrund der Unterrichtserfahrung<br />
kann man davon ausgehen, dass die fettgedruckten<br />
Kernkompetenzen auch tatsächlich in der Sekundarstufe I<br />
erworben werden können, bei einzelnen Spiegelstrichen mag das<br />
hingegen fraglich sein.<br />
Kompetenz wird von den Autoren der Klieme-Expertise primär<br />
als Fähigkeit zur Problemlösung verstanden. Entsprechend sollen<br />
<strong>beim</strong> Wissenserwerb die möglichen Anwendungssituatio-<br />
22<br />
nen mitbedacht werden. 10 Im Unterschied zum Mathematikoder<br />
zum Fremdsprachenunterricht in der Spracherwerbsphase<br />
kann das Wissen im Religionsunterricht nicht einfach an Anwendungskontexte<br />
gebunden werden. Wissen ist nicht gleich<br />
Wissen. Hilfreich ist hier die Unterscheidung von Verfügungsund<br />
Orientierungswissen, die Willi Oelmüller in den 80er Jahren<br />
in die Debatte eingeführt hat. 11 Jürgen Mittelstraß definiert<br />
Verfügungswissen als „Wissen um Ursachen, Wirkungen und<br />
Mittel; es ist das Wissen, das Wissenschaft und Technik unter<br />
gegebenen Zwecken zur Verfügung stellen“ 12 . Orientierungswissen<br />
hingegen ist „ein Wissen um gerechtfertigte Zwecke und<br />
Ziele; gemeint sind Einsichten, die im Leben orientieren (zum<br />
Beispiel als Orientierung im Gelände, in einem Fach, in persönlichen<br />
Beziehungen), aber auch solche, die das Leben orientieren<br />
(und etwa den ‚Sinn‘ des eigenen Lebens ausmachen).“ 13<br />
Zum Orientierungswissen gehört auch das religiöse Wissen. Eine<br />
biblische Geschichte oder ein Gebet können nicht einfach auf<br />
eine Situation angewandt werden. Der christliche Glaube ist<br />
keine Problemlösungs- oder Lebensbewältigungsstrategie, die<br />
man funktional und effizient anwenden könnte. Der Glaube<br />
verändert vielmehr die Erkenntnis und Deutung von Lebenssituationen<br />
und Problemen, indem er sie auf ein umfassenderes<br />
Verständnis von Wirklichkeit und Wahrheit bezieht. Religiöses<br />
Wissen wird nur dann zum Orientierungswissen, wenn seine<br />
Bedeutung für das Leben der Schülerinnen und Schüler deutlich<br />
wird. 14 Ohne den Subjektbezug verliert es seine Orientie-<br />
Literatur zum Nachlesen<br />
Eckhard Klieme u.a., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards.<br />
Eine Expertise, hg. v. Bundesministerium für<br />
Bildung und Forschung, Berlin 2003.<br />
Ulrich Hemel, Ziele religiöser Erziehung. Beiträge zu einer<br />
integrativen Theorie, Frankfurt/M. 1988.<br />
Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards für den katholischen<br />
Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10/ Sekundarstufe<br />
I (Mittlerer Schulabschluss), hg. v. Sekretariat<br />
der Deutschen Bischofskonferenz (= Die deutschen<br />
Bischöfe 78), Bonn 2004.