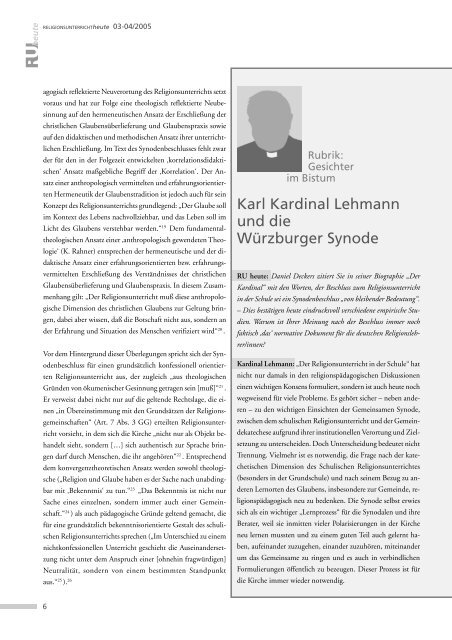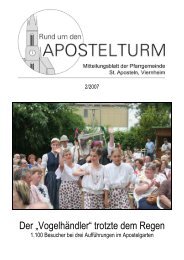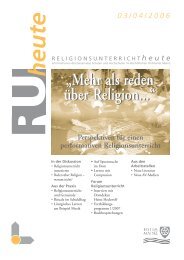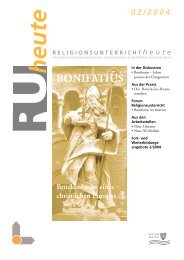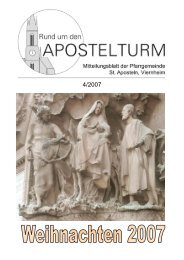R U - beim Bistum Mainz
R U - beim Bistum Mainz
R U - beim Bistum Mainz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
RELIGIONSUNTERRICHTheute 03-04/2005<br />
agogisch reflektierte Neuverortung des Religionsunterrichts setzt<br />
voraus und hat zur Folge eine theologisch reflektierte Neubesinnung<br />
auf den hermeneutischen Ansatz der Erschließung der<br />
christlichen Glaubensüberlieferung und Glaubenspraxis sowie<br />
auf den didaktischen und methodischen Ansatz ihrer unterrichtlichen<br />
Erschließung. Im Text des Synodenbeschlusses fehlt zwar<br />
der für den in der Folgezeit entwickelten ‚korrelationsdidaktischen‘<br />
Ansatz maßgebliche Begriff der ‚Korrelation‘. Der Ansatz<br />
einer anthropologisch vermittelten und erfahrungsorientierten<br />
Hermeneutik der Glaubenstradition ist jedoch auch für sein<br />
Konzept des Religionsunterrichts grundlegend: „Der Glaube soll<br />
im Kontext des Lebens nachvollziehbar, und das Leben soll im<br />
Licht des Glaubens verstehbar werden.“ 19 Dem fundamentaltheologischen<br />
Ansatz einer ‚anthropologisch gewendeten Theologie‘<br />
(K. Rahner) entsprechen der hermeneutische und der didaktische<br />
Ansatz einer erfahrungsorientierten bzw. erfahrungsvermittelten<br />
Erschließung des Verständnisses der christlichen<br />
Glaubensüberlieferung und Glaubenspraxis. In diesem Zusammenhang<br />
gilt: „Der Religionsunterricht muß diese anthropologische<br />
Dimension des christlichen Glaubens zur Geltung bringen,<br />
dabei aber wissen, daß die Botschaft nicht aus, sondern an<br />
der Erfahrung und Situation des Menschen verifiziert wird“ 20 .<br />
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen spricht sich der Synodenbeschluss<br />
für einen grundsätzlich konfessionell orientierten<br />
Religionsunterricht aus, der zugleich „aus theologischen<br />
Gründen von ökumenischer Gesinnung getragen sein [muß]“ 21 .<br />
Er verweist dabei nicht nur auf die geltende Rechtslage, die einen<br />
„in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“<br />
(Art. 7 Abs. 3 GG) erteilten Religionsunterricht<br />
vorsieht, in dem sich die Kirche „nicht nur als Objekt behandelt<br />
sieht, sondern […] sich authentisch zur Sprache bringen<br />
darf durch Menschen, die ihr angehören“ 22 . Entsprechend<br />
dem konvergenztheoretischen Ansatz werden sowohl theologische<br />
(„Religion und Glaube haben es der Sache nach unabdingbar<br />
mit ‚Bekenntnis‘ zu tun.“ 23 „Das Bekenntnis ist nicht nur<br />
Sache eines einzelnen, sondern immer auch einer Gemeinschaft.“<br />
24 ) als auch pädagogische Gründe geltend gemacht, die<br />
für eine grundsätzlich bekenntnisorientierte Gestalt des schulischen<br />
Religionsunterrichts sprechen („Im Unterschied zu einem<br />
nichtkonfessionellen Unterricht geschieht die Auseinandersetzung<br />
nicht unter dem Anspruch einer [ohnehin fragwürdigen]<br />
Neutralität, sondern von einem bestimmten Standpunkt<br />
aus.“ 25 ). 26<br />
6<br />
Rubrik:<br />
Gesichter<br />
im <strong>Bistum</strong><br />
Karl Kardinal Lehmann<br />
und die<br />
Würzburger Synode<br />
RU heute: Daniel Deckers zitiert Sie in seiner Biographie „Der<br />
Kardinal“ mit den Worten, der Beschluss zum Religionsunterricht<br />
in der Schule sei ein Synodenbeschluss „von bleibender Bedeutung“.<br />
– Dies bestätigen heute eindrucksvoll verschiedene empirische Studien.<br />
Warum ist Ihrer Meinung nach der Beschluss immer noch<br />
faktisch ‚das‘ normative Dokument für die deutschen Religionslehrer/innen?<br />
Kardinal Lehmann: „Der Religionsunterricht in der Schule“ hat<br />
nicht nur damals in den religionspädagogischen Diskussionen<br />
einen wichtigen Konsens formuliert, sondern ist auch heute noch<br />
wegweisend für viele Probleme. Es gehört sicher – neben anderen<br />
– zu den wichtigen Einsichten der Gemeinsamen Synode,<br />
zwischen dem schulischen Religionsunterricht und der Gemeindekatechese<br />
aufgrund ihrer institutionellen Verortung und Zielsetzung<br />
zu unterscheiden. Doch Unterscheidung bedeutet nicht<br />
Trennung. Vielmehr ist es notwendig, die Frage nach der katechetischen<br />
Dimension des Schulischen Religionsunterrichtes<br />
(besonders in der Grundschule) und nach seinem Bezug zu anderen<br />
Lernorten des Glaubens, insbesondere zur Gemeinde, religionspädagogisch<br />
neu zu bedenken. Die Synode selbst erwies<br />
sich als ein wichtiger „Lernprozess“ für die Synodalen und ihre<br />
Berater, weil sie inmitten vieler Polarisierungen in der Kirche<br />
neu lernen mussten und zu einem guten Teil auch gelernt haben,<br />
aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören, miteinander<br />
um das Gemeinsame zu ringen und es auch in verbindlichen<br />
Formulierungen öffentlich zu bezeugen. Dieser Prozess ist für<br />
die Kirche immer wieder notwendig.