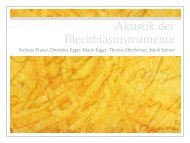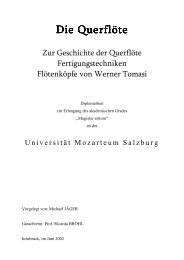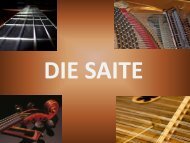Interferometrische Messungen an Querflötenköpfen - JAEGER ...
Interferometrische Messungen an Querflötenköpfen - JAEGER ...
Interferometrische Messungen an Querflötenköpfen - JAEGER ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.2. DIE ENTSTEHUNG EINES FLÖTENTONES 45zum Wert P 1max steigern, um erst d<strong>an</strong>n in die höhere Oktave zu springen.Von hieraus lässt er sich bis zum Wert P 2min absenken, bevor der Ton zurückspringt.Derselbe Vorg<strong>an</strong>g wiederholt sich bei weiterer Drucksteigerungzwischen der 2. und der 3. Reson<strong>an</strong>z, wobei der Sprung diesmal dem Intervalleiner Quinte entspricht. Wie breit der Hysterese-Bereich ist, hängt vonder Stabilität der Schwingungszustände - und damit vom Verlauf der Amplitudenkurveder Imped<strong>an</strong>z im Bereich der betreffenden Reson<strong>an</strong>zen - abund k<strong>an</strong>n auch vom Spieler über die Lenkung des Luftstrahles beeinflusstwerden. Für die Sicherheit der Ansprache tiefer Töne ist ein hoher Wertvon P 1max erstrebenswert. Überblasene Töne sprechen sicherer <strong>an</strong>, wenn derHysterese-Bereich nicht zu groß ist. Wichtig für die Stabilität hoher überblasenerTöne ist jedoch auch, dass ihre ersten Obertöne durch harmonischliegende Reson<strong>an</strong>zen unterstützt werden.3.2.5 Die Spieltechnik und deren EinflussDie Anblastechnik eines Querflötisten erfordert vier Parameter [Mey95]:der im Mund erzeugte Luftdruckder Grad der Abdeckung des Mundlochesdie Richtung des Luftstrahlesdie Form und die Größe der LippenöffnungDie ersten drei Parameter wurden mit einem künstlichen Bläser sehr genauerforscht [Bor90], wobei eine Form der Lippenöffnung Verwendung f<strong>an</strong>d,die zu einem möglichst geräuscharmen Kl<strong>an</strong>g führte. Die Abdeckung desMundloches und die Richtungsänderung des Luftstrahles werden vom Spielerdadurch erreicht, dass er das Instrument zum einen vor den Lippen etwasdreht, und zum <strong>an</strong>deren mehr oder weniger fest gegen die Unterlippe druckt.Dabei beeinflussen beide Maßnahmen stets beide gen<strong>an</strong>nten Parameter. DerÜbersichtlichkeit halber sind diese Einflüsse bei den Versuchen mit der Anblasvorrichtungjedoch getrennt dargestellt.3.2.6 AnblasdruckDie unterschiedlichen Anblasdrücke wurden schon in Abb. 3.8 gezeigt undkonnten dort mit der Frequenzlage der einzelnen Reson<strong>an</strong>zen in Verbindunggebracht werden. Abb. 3.10 gibt nun die Abhängigkeit des Pegels der erstenvier Teiltöne eines Flötentones der tiefen Lage vom Anblasdruck wieder.Da das Kl<strong>an</strong>gspektrum einer Schallquelle naturgemäß von Entfernung undRichtung des Aufnahmeortes abhängt, wurden diese Spektren im Inneren derFlöte gemessen, um so möglichst allgemeingültige und vergleichbare Ergebnissezu erhalten. Das obere Diagramm bezieht sich auf eine Flöte üblicherBauform, bei der sich der Innendurchmesser im Kopfstück von etwa 19 mm