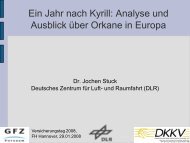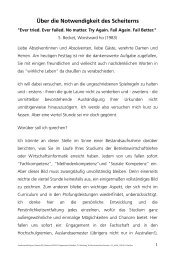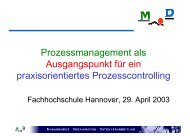Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Arbeitspapier</strong> / <strong>Abteilung</strong> <strong>Wirtschaft</strong><br />
<strong>Günter</strong> <strong>Buchholz</strong>,<br />
<strong>Ralf</strong> <strong>Hoburg</strong>,<br />
Christiane Burbach,<br />
Friedrich Heckmann<br />
Fakultät IV – <strong>Wirtschaft</strong> und Informatik<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik heute<br />
Dokumentation der öffentlichen Vorträge am 18. November 2008 mit zwei Ergänzungen<br />
<strong>Arbeitspapier</strong> 03-2009<br />
ISSN Nr. 1436-1035 (print) ISSN Nr. 1436-1507 (Internet)<br />
www.fh-hannover.de/f4
Vorwort<br />
Das Thema dieser Vorträge verdankt sich einem Gesprächskreis der Fakultät IV und der Fakultät V<br />
im Herbst 2008 anlässlich der Integration der ehemaligen Evangelischen Fachhochschule Hannover<br />
als neue Fakultät V in die niedersächsische Fachhochschule Hannover (FHH); es ging dabei um<br />
eine mögliche Kooperation.<br />
So entstand die Idee des Versuchs einer interdisziplinären Kooperation zum Thema<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik – heute.<br />
Dieses <strong>Arbeitspapier</strong> soll die Vorträge der Veranstaltung (1, 2, 3 im Inhaltsverzeichnis) in ihrer<br />
zeitlichen Reihenfolge dokumentieren und zugleich ergänzen (4, 5, 6 im Inhaltsverzeichnis).<br />
An Stelle des erkrankten Friedrich Heckmann übernahm <strong>Ralf</strong> <strong>Hoburg</strong> (2) recht kurzfristig die<br />
Aufgabe einer kritischen Auseinandersetzung mit den „Fragen und Thesen zur <strong>Wirtschaft</strong>sethik“<br />
von <strong>Günter</strong> <strong>Buchholz</strong> (1), mit denen der Abend begann.<br />
Christiane Burbach hat ihre Präsentation (3) durch Thesen ergänzt (4).<br />
Der Text - ohne Titel - des ursprünglich geplanten Beitrags von Friedrich Heckmann wird hier<br />
unter (5) nachgetragen. Der Herausgeber hat als Titel „<strong>Wirtschaft</strong> und Ethik“ eingefügt.<br />
<strong>Günter</strong> <strong>Buchholz</strong> hat – im Hinblick auf politisch-moralische Probleme und die jüngere Diskussion<br />
der <strong>Wirtschaft</strong>s- bzw. Unternehmensethik in der Betriebswirtschaftslehre ergänzend ein kurzes<br />
Nachwort angefügt (6).<br />
2
Inhalt<br />
1 <strong>Günter</strong> <strong>Buchholz</strong> 4<br />
Fragen und Thesen zur <strong>Wirtschaft</strong>sethik<br />
2 <strong>Ralf</strong> <strong>Hoburg</strong> 13<br />
Protestantische Aspekte der Unternehmensethik<br />
3 Christiane Burbach 19<br />
Präsentation: Der ehrbare Kaufmann<br />
4 Christiane Burbach 30<br />
Der ehrbare Kaufmann – Variationen zur Tugend der Mäßigung<br />
(Thesen zur Präsentation)<br />
5 Friedrich Heckmann 33<br />
<strong>Wirtschaft</strong> und Ethik<br />
6 <strong>Günter</strong> <strong>Buchholz</strong> 40<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik heute – ein Nachwort<br />
3
Meine sehr geehrten Damen und Herren,<br />
Prof. Dr. <strong>Günter</strong> <strong>Buchholz</strong><br />
Fragen und Thesen zur <strong>Wirtschaft</strong>sethik<br />
Fakultät IV FH Hannover: „FH meets economy“<br />
18. November 2008<br />
bis vor kurzem war die Auffassung vorherrschend, daß das Management auch ohne eine<br />
<strong>Wirtschaft</strong>smoral auskomme, schließlich bestünde, nach Milton Friedman, die Aufgabe der<br />
Unternehmen ausschließlich darin, Gewinne zu machen:<br />
„The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits.“<br />
(The Times Magazine Sept. 1970)<br />
Der Anspruch der Ethik, das Handeln der <strong>Wirtschaft</strong>subjekte zu regulieren, wurde von ihm also<br />
zurückgewiesen und zugleich dem Gesetzgeber überlassen.<br />
Mit dem Eintritt in die gegenwärtige Finanz- und <strong>Wirtschaft</strong>skrise ist mittlerweile eine gewisse<br />
Nachdenklichkeit zu beobachten, erfreulicherweise auch im Management selbst.<br />
Ein prominentes Beispiel hierfür ist das m. E. sehr lesenswerte, neu erschienene Buch des<br />
Top-Managers Daniel Goeudevert. Es heißt:<br />
„Das Seerosen-Prinzip – Wie uns die Gier ruiniert“,<br />
und es ist in diesem Jahr bei DuMont in Köln erschienen.<br />
Falls Sie sich darüber hinaus eine wissenschaftlich-systematische Einführung in das Thema<br />
Unternehmensethik wünschen, möchte ich Ihnen sehr das inhaltlich ausgezeichnete und doch<br />
zugleich verständlich geschriebene, leicht lesbare Buch von Elisabeth Göbel mit dem Titel<br />
„Unternehmensethik“<br />
empfehlen, das im Jahr 2006 in Stuttgart erscheinen ist.<br />
Hier und heute möchte ich mich darauf beschränken, einige<br />
Fragen und Thesen zur <strong>Wirtschaft</strong>sethik<br />
zu formulieren, um die Diskussion mit ihnen vorzubereiten und anzuregen.<br />
4
1. Was verstehen wir unter <strong>Wirtschaft</strong>sethik?<br />
Ethik ist ein Zweig der praktischen Philosophie, wie sie seit mehr als zweitausend Jahren betrieben<br />
wird. Es geht hier um die Frage, was wir tun und wie wir handeln sollen - und damit umgekehrt<br />
auch, was wir nicht tun und wie wir nicht handeln sollen.<br />
Diese Frage nach dem Sollen setzt Freiheit voraus, und sie impliziert, daß eben nicht alles, was<br />
getan werden könnte, auch getan werden sollte – wofür Gründe existieren. Die hier als Beispiel<br />
geeigneten öffentlichen Debatten aus dem Bereich der Medizinethik werden Ihnen sicherlich allen<br />
gegenwärtig sein.<br />
In der <strong>Wirtschaft</strong>sethik werden ethische Überlegungen auf das Praxisfeld <strong>Wirtschaft</strong> angewandt. Es<br />
geht hierbei nicht um die strikt verbindliche Legalitätsgrenze sondern um die faktisch weder strikt<br />
verbindliche noch völlig unverbindliche Moralitätsgrenze.<br />
Während der Gesetzgeber in Verbindung mit der Justiz die jeweilige Grenze zwischen Legalität und<br />
Illegalität bestimmt, muß die in der Regel enger gezogene Moralitätsgrenze von der Zivilgesellschaft<br />
in einem öffentlichen ethisch-politischen Reflexionsprozeß bestimmt und als verbindlich<br />
anerkannt werden.<br />
So wurde zum Beispiel Bestechung im Ausland, aber nicht im Inland, jahrzehntelang als moralisch<br />
unbedenklich angesehen; Bestechungsgelder konnten sogar steuermindernd geltend gemacht<br />
werden. Das ist inzwischen geändert worden.<br />
Die Bestimmung von Moralitätsgrenzen kann sich auch innerhalb einer Berufsgruppe oder Branche<br />
vollziehen; in der Consulting-Branche gibt es z. B. verschiedene Professional Codes (Kubr, Milan:<br />
Management Consulting, Geneva 1996), d. h. vereinbarte und anerkannte Regelwerke für das<br />
ethisch korrekte berufliche Handeln von Unternehmensberatern.<br />
Zwar ist damit noch nicht gesichert, daß diese Regeln tatsächlich hinreichend beachtet werden,<br />
aber sie sind damit immerhin als ein allgemein gültiger Maßstab greifbar, und das tatsächliche<br />
Handeln kann an ihnen gemessen und beurteilt werden.<br />
5
2. Weshalb wird überhaupt vermehrt über <strong>Wirtschaft</strong>sethik gesprochen?<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik wird deshalb immer häufiger ein wissenschaftliches und ein öffentliches Thema,<br />
weil die Erfahrungen mit dem massiv unethischen Verhalten von Unternehmungen in den<br />
Vereinigten Staaten von Amerika (der Fall ENRON) in Italien (der Fall Parmalat) und in<br />
Deutschland (die Fälle Siemens und VW) exemplarisch zeigen, daß eben dieses Verhalten von den<br />
entfesselten Märkten nicht nur nicht verhindert, sondern ermöglicht und begünstigt worden ist.<br />
Für das internationale Banksystem und speziell jene US-Banken, die die Subprime-Krise im<br />
amerikanischen Immobiliensektor allem Anschein nach fahrlässig verursacht und die im<br />
fragwürdigen Zusammenspiel mit privaten Rating-Agenturen die vermutlich vorsätzliche weltweite<br />
Verteilung der Kreditrisiken zu verantworten haben, gilt dies in ganz besonderer Weise. Das FBI<br />
ermittelt inzwischen in zahlreichen Fällen.<br />
„Was ist die Beraubung einer Bank gegen die Gründung einer Bank?“,<br />
hat Brecht einmal rhetorisch gefragt.<br />
Der deutsche Steuerzahler ist jedenfalls durch die staatliche Rettung der privaten IKB-Bank mit<br />
mehr als 10 Milliarden € geschädigt worden. Es ist deshalb geboten, öffentlich zu fordern, daß ein<br />
Bundestagsuntersuchungsausschuß das Geschäftsgebaren des Vorstandes und des Aufsichtsrats der<br />
IKB-Bank, durch das diese an den Rand des Konkurses gebracht worden ist, samt Vorgeschichte im<br />
einzelnen aufklärt und die Verantwortlichen benennt.<br />
Denn es besteht der Verdacht, daß es sich bei der Rettung der IKB-Bank durch die staatliche KfW-<br />
Gruppe um eine Sozialisierung von privaten Verlusten anderer Privatbanken handeln könnte. Dieser<br />
Verdacht sollte im Interesse der Privatwirtschaft selbst sorgfältig geprüft und ggf. ausgeräumt<br />
werden.<br />
Transparenz und Kontrolle sind zwar die richtigen Stichwörter, aber weitergehend wird die<br />
internationale Finanzarchitektur grundlegend verändert werden müssen, wenn eine Wiederkehr der<br />
Finanzkrise ausgeschlossen werden soll.<br />
Dazu müßte wohl vor allem die Spekulation auf allen Märkten (Währungen, Wertpapiere, Güter)<br />
eingeschränkt werden.<br />
Hochriskante Produkte mit unkalkulierbarer Hebelwirkung oder Intransparenz (wie bei Asset<br />
backed Securities usw.) müßten ganz verboten werden.<br />
Die internationalen Finanzinstitutionen (Weltbank, Internationaler Währungsfonds) müßten<br />
reformiert, und die internationale <strong>Wirtschaft</strong>spolitik (World Trade Organization) müßte modifiziert<br />
werden.<br />
Eine verläßliche Kontrolle der privaten Rating-Agenturen dürfte dazu ebenso notwendig sein wie<br />
eine Austrocknung der Steueroasen und die Beseitigung von Einkommensanreizen, die ein<br />
spekulatives Geschäftsgebaren fördern. Außerdem könnte eine Änderungen der Haftungsnormen<br />
hilfreich sein.<br />
Letztlich müßte sich die <strong>Wirtschaft</strong>spolitik auch um eine stärker egalitäre Einkommens- und<br />
Vermögensverteilung bemühen, weil von dieser die positive Entwicklung der gesellschaftlichen<br />
Wohlfahrt und für die realwirtschaftliche Konunktur- und Wachstumsentwicklung abhängig ist.<br />
6
3. Was wird von <strong>Wirtschaft</strong>sethik erwartet oder befürchtet?<br />
Diejenigen, die an eine wirtschaftsethische Diskussion sowie an die Implementierung praktischer<br />
wirtschaftsethischer Konzepte positive Erwartungen knüpfen, sind im Prinzip der Auffassung, daß<br />
erstens die empirischen Mängel nicht bagatellisiert oder geleugnet werden können und dürfen, daß<br />
zweitens von den deregulierten Märkten keine Besserung zu erwarten sei, und daß es daher drittens<br />
notwendig sei, die Mängel normativ, durch Gesetz und durch eine verbindliche institutionelle Moral<br />
zu korrigieren.<br />
So gilt bekanntlich nach neuester höchstrichterlicher Rechtsprechung im Fall Siemens das Anlegen<br />
„Schwarzer Kassen“ in Unternehmen strafrechtlich als Untreue. Und in manchen Unternehmungen<br />
werden unter der Bezeichnung „Corporate Social Responsibility“ moralische Codices diskutiert und<br />
teils auch implementiert.<br />
Es wird dabei klar gesehen, daß es sich um zusätzliche Einschränkungen, Begrenzungen und<br />
Kontrollen von privatwirtschaftlichen Handlungsspielräumen handeln muß, wenn eine praktische<br />
Besserung erreicht werden soll.<br />
Man vergleiche hierzu auch: Aus Politik und Zeitgeschichte (ApuZ) Beilage der Wochenzeitung<br />
„Das Parlament“, das Heft Nr 31/2008; 28. Juli 2008) mit dem Titel „Corporate Citizenship“.<br />
Und eben wegen dieser drohenden Einschränkungen gibt es andererseits diejenigen, die eine<br />
wirtschaftsethische Diskussion ganz zurückweisen (Vgl. Friedman 1970), und zwar entweder mit<br />
dem Argument, es bestehe gar kein Bedarf aufgrund der Selbstregulierungsfähigkeit der<br />
Marktwirtschaft, das ist die Position der Problemverleugner, oder aber, es seien in der<br />
wettbewerbsgetriebenen <strong>Wirtschaft</strong> ohnehin nur solche zusätzlichen Normen durchsetzbar und<br />
zumutbar, die mit den ökonomischen Verwertungsbedingungen verträglich sind. Das ist die Position<br />
derjenigen, die trotz der aufgetretenen Probleme die unbeschränkte Ausschöpfung aller erreichbarer<br />
Nutzungschancen auch gegen eine moralische Kritik und Normierung verteidigen wollen: damit<br />
alles weitergehen kann wie bisher.<br />
Man kann hier erkennen, daß und in welcher Art und Weise gesellschaftliche Interessen – in diesem<br />
Fall an einer schrankenlosen Kapitalverwertung und Einkommenserzielung – die akademische<br />
Diskussion in den <strong>Wirtschaft</strong>s- und Sozialwissenschaften schon vorab prägen.<br />
Diese Präformierung des Denkens durch vorgängige gesellschaftliche Interessen sind für die<br />
Wissenschaft ein höchst problematischer Umstand, der eine ganz besondere Aufmerksamkeit<br />
verdient.<br />
7
4. Kann die <strong>Wirtschaft</strong>sethik überhaupt leisten, was von ihr erwartet wird?<br />
Die <strong>Wirtschaft</strong>sethik kann dann wirksam werden, wenn möglichst alle - oder wenigstens genügend<br />
zahlreiche - autonome und ethisch einsichtige Handelnde vorhanden sind, die - ohne dazu<br />
gezwungen zu sein - entschlossen sind, das gemeinsam erkannte gute Ziel wirklich erreichen zu<br />
wollen. Dazu müßte aber ein gesellschaftlicher Prozeß ablaufen, der demjenigen der Erosion der<br />
geschäftlichen Moral entgegengesetzt wäre; so etwas zu erwarten oder appellativ zu fordern, dürfte<br />
aber ein Ausdruck von Idealismus und somit zum Scheitern verurteilt sein.<br />
Diese Vorstellung enthält allerdings eine Schwachstelle, nämlich die Voraussetzung der Autonomie<br />
der Entscheidungssubjekte; diese aber ist zwischen den Theorien strittig. Zwar wird in den<br />
Handlungstheorien von dieser Voraussetzung ausgegangen, aber die Systemtheorien widersprechen<br />
und verweisen auf die Prägung der Subjekte durch Sozialisation sowie auf ihre Integration in bereits<br />
vorgegebene sozioökonomische Verhältnisse, also auf den Vorrang des sozioökonomischen Systems<br />
und seiner Logik. Die systemische Objektivität wirkt danach prägend und hat deshalb Vorrang<br />
gegenüber dem individuellen Handeln mit seiner Subjektivität. (Horkheimer und Adorno 1933).<br />
Aus dieser theoretischen Perspektive bestünde folglich kein oder nur ein sehr begrenzter<br />
Handlungsspielraum. Wo er jedoch existierte, dort könnte prinzipiell individuell ethisch motiviert<br />
gehandelt werden.<br />
Sofern die systemtheoretische Sichtweise relevant ist, kann sich die Wirksamkeit der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik zwar entfalten, aber nur inerhalb des Systems, aufgrund seiner spezifischen<br />
Funktionslogik und der darin möglicherweise enthaltenen freien Handlungsspielräume. In der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> wirkt sich beispielsweise der Wettbewerb auf den Märkten beschränkend auf die<br />
Handlungsspielräume der Unternehmer aus, aber andererseits gibt es in der Geschichte und in der<br />
Gegenwart auch immer wieder beeindruckende Beispiele originellen unternehmerischen Handelns,<br />
das von ausgetretenen Pfaden und Managementmoden abweicht. Nicht jede Phantasielosigkeit kann<br />
eben mit dem Diktat der Systemlogik entschuldigt werden.<br />
8
5. Welche Ziele könnten mit einer <strong>Wirtschaft</strong>s- bzw. eine Unternehmensethik verfolgt<br />
werden?<br />
Damit haben wir die Ebene des ethisch-moralischen Diskurses erreicht:<br />
- Welche Ziele sind als „gut“ und damit als ethisch gerechtfertigt anzusehen? Und aus welchen<br />
Gründen?<br />
- Wie gelangen wir zu einem konsensfähigen Ergebnis, und was soll geschehen, wenn es zu keinem<br />
Konsens kommt?<br />
- Ist ein solches Ergebnis in der bürgerlichen Gesellschaft mit ihren charakteristischen<br />
Interessenskonflikten überhaupt möglich?<br />
- Sollte eine solche Zielbestimmung möglich sein, wie könnten dann moralisch akzeptierte Ziele<br />
unterhalb der Schwelle der Gesetzgebung hinreichend verbindlich gemacht werden?<br />
- Welche Kontroll- und welche Sanktionsmechanismen sind denkbar und praktikabel?<br />
Die letzten beiden Fragen operieren bereits auf der Managementebene, damit auch von Konzepten<br />
wie jener der „Corporate Social Responsibility“. Ich werde darauf hier nicht weiter eingehen.<br />
9
6. Die ethische Problematik der Shareholder-Value-Orientierung in der <strong>Wirtschaft</strong><br />
Ich werde - auch um des besseren Verständnisses willen - zunächst eine kurze analytische Skizze<br />
vortragen, um mich dann den ethischen Fragen zuzuwenden.<br />
Der Gegenbegriff zum Shareholder-Value-Konzept ist die sogenannte Stakeholder-Orientierung.<br />
Diese impliziert ein bestimmtes Grundverständnis der privaten Unternehmung, das dahin geht, daß<br />
diese Institution mehr ist als eine Privatangelegenheit der Eigentümer. Es wird gesehen und darauf<br />
aufmerksam gemacht, daß es auch andere relevante Anpruchsgruppen an die private Unternehmung<br />
gibt. Hier zählen vorrangig die Beschäftigten, aber auch die Kunden, die Lieferanten, die<br />
Kreditgeber und der Staat, nämlich in seinen Rollen als Gewährleister der Infrastruktur, als<br />
Subventionszahler und als Steuereinnehmer. Alle diese Gruppen haben bestimmte legitime<br />
Erwartungen an die private Unternehmung, und diese Legitimität entsteht durch die fortwährende<br />
Interaktion und Wechselwirkung der privaten Unternehmung mit ihrer sozioökonomischen Umwelt.<br />
Sie wird dadurch zwar nicht formal und nicht explizit, wohl aber material und implizit als eine<br />
gesellschaftliche Institution in privater Form begriffen. Ihr privater Charakter wird dadurch deutlich<br />
relativiert.<br />
Das Shareholder-Value-Konzept rückt demgegenüber erstens das monetäre Einkommensinteresse<br />
der Eigentümer an die oberste Stelle der Zielhierarchie, und es bindet zweitens das Einkommens-<br />
Interesse der leitenden Manager durch den teilweisen Entgelt mit stock options eng an den<br />
Börsenkurs des Unternehmens und damit an die monetären Interessen der Eigentümer, d. h. der<br />
shareholder.<br />
Damit wird das Management dem Diktat der Quartalszahlen und der Finanzanalysten unterworfen,<br />
und der Zeit- und Denkhorizont der geschäftlichen Planung verkürzt sich entsprechend. Zugleich<br />
wird damit die reale Ökonomie der monetären Ökonomie untergeordnet. Die Börsen werden zu<br />
Leitinstitutionen der Gesamtwirtschaft. Der güterwirtschaftliche Kapitalismus wandelt sich zum<br />
Finanzmarkt-Kapitalismus, dessen Krise mit dem Schwarzen Montag, dem 15.09.2008, manifest<br />
geworden ist.<br />
Zugleich werden jene gesellschaftlichen Kompromisse brüchig und aufgekündigt, die der<br />
Stakeholder-Orientierung entsprachen. Die gesellschaftlichen Strukturen geraten politisch und<br />
ökonomisch vermittelt in Bewegung. Es kommt zum steilen gesellschaftlichen Aufstieg kleinerer<br />
Gruppen und zugleich zum sozialen Abstieg breiter Schichten. Auch die Stabilität der<br />
Mittelschichten erweist sich auf die Dauer als gefährdet. Sie werden aufgespalten in einen Teil, der<br />
die Prekarisierung fürchten muß, und in einen anderen Teil, der seine soziale Position noch<br />
bewahren kann.<br />
Wenn diese skizzenhafte Charakterisierung annähernd zutreffend sein sollte, wie wäre diese<br />
Entwicklung und der heutige gesellschaftliche Zustand dann aus ethischer Sicht zu beurteilen?<br />
Mir scheint hier eine Frage im Zentrum zu stehen, nämlich ob ein solcher gesellschaftlicher Zustand<br />
rational und objektivierend als gerecht oder als ungerecht begründet werden kann. Die bloß<br />
subjektive Empfindung von Ungerechtigkeit, wie sie das Alltagsbewußtsein bestimmt, sie bleibt<br />
m. E. unzureichend. Zwar weiß ich nicht, ob das so gestellte Problem überhaupt lösbar ist, aber wir<br />
müßten uns, wenn wir uns denn darauf einließen, Gedanken darüber machen, wie der Begriff der<br />
Gerechtigkeit als orientierende Norm und als Maßstab bestimmt werden könnte. Damit kehren wir<br />
allerdings zwangsläufig zurück zu den großen, miteinander im Konflikt liegenden Gesellschaftstheorien,<br />
die uns zu unterschiedlichen und zum Teil gegensätzlichen Deutungen und Erklärungen<br />
führen. Und wir kehren zurück zu den interdependenten Werten der Französischen Revolution:<br />
liberté, egalité, fraternité oder, sinngemäß: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit<br />
10
7. Was Gerechtigkeit im Hinblick auf Gesellschaft bedeuten könnte<br />
In einer gerechten Gesellschaft sollten alle Menschen ihr Leben frei entfaltet können, nicht nur eine<br />
bestimmte soziale Schicht oder Klasse; der historische Entwicklungsstand der Gesellschaft läßt dies<br />
seit langem zu.<br />
Da politische Unfreiheit eine freie Entfaltung aller verhindert, steht sie in jeder Form im Gegensatz<br />
zur Gerechtigkeit.<br />
Gerechtigkeit ist ohne eine funktionierende Demokratie nicht möglich. Demokratie funktioniert<br />
wirklich in dem Maße, in dem sie tatsächlich durch Willensbildungsprozesse von unten nach oben<br />
bestimmt wird, indem sich also die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung Geltung verschaffen<br />
können. Diese Willensbildungsprozesse erfordern kurzfristig Klarheit über die eigenen Interessen,<br />
und sie erfordern politische Bildung sowie politische Urteilskraft.<br />
Ungerecht wird Demokratie, wenn sie durch die Herrschaftspraxis Privilegierter ausgehöhlt wird,<br />
indem die demokratische Willensbildung durch publizistische Manipulation der Bevölkerung, durch<br />
Abkoppelung der Parlamentarier von den Wählern, durch Privilegierung der Abgeordneten, durch<br />
politischen Lobbyismus gegenüber Parteien, Parlamenten und Regierungen, durch Schwächung der<br />
Parlamente und durch konzeptionelle Lenkung der Exekutive seitens privater Stiftungen oder<br />
Verbände erschwert oder durch Willensbildungsprozesse von oben nach unten ersetzt wird.<br />
Brecht hat hierzu die treffende Frage gestellt:<br />
Die Macht geht vom Volke aus – aber wo geht sie hin?<br />
Gerechtigkeit ist aber auch nicht möglich ohne eine fundamentale soziale Gleichheit.<br />
Soziale Gleichheit bedeutet keineswegs Gleichmacherei oder Verneinung der Individualität und der<br />
natürlichen und kulturellen Unterschiedlichkeit der Menschen, sondern vielmehr deren<br />
Anerkennung und Akzeptanz ohne Diskriminierung.<br />
Gleichheit bedeutet mehr als die glücklicherweise verwirklichte Gleichheit vor dem Gesetz und<br />
auch mehr als eine - tatsächlich leider nicht gewährleistete - Gleichheit der Entwicklungschancen.<br />
Soziale Gleichheit bedeutet insbesondere die Abwesenheit von faktischen Privilegien sozialer und<br />
ökonomischer Art.<br />
Es sind diese faktischen Privilegien, die den Kern unseres gesellschaftlichen Gerechtigkeitsproblems<br />
bilden.<br />
Gerechtigkeit existiert erst dann, wenn sich die - in diesem Sinne - freien und gleichen<br />
menschlichen Individuen in ihrer Unterschiedlichkeit dennoch wechselseitig als Mitglieder ein und<br />
derselben menschlichen Gemeinschaft begreifen und wenn sie daraus praktische Konsequenzen für<br />
ihre gemeinsame Lebensgestaltung ziehen.<br />
11
Literatur<br />
Corporate Citizenship, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (ApuZ) – Beilage der Wochenzeitung<br />
„Das Parlament“, Heft Nr 31/2008 vom 28.Juli 2008.<br />
Friedman, Milton, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, in: The New York<br />
Times Magazine, September 13, 1970<br />
Göbel, Elisabeth, Unternehmensethik, UTB 2797- Lucius & Lucius: Stuttgart 2006<br />
Goeudevert, Daniel, Das Seerosen-Prinzip – Wie uns die Gier ruiniert, DuMont: Köln 2008<br />
Horkheimer, Max und Adorno, Theodor W., Materialismus und Moral, in: Zeitschrift für<br />
Sozialforschung; Heft 2, II. Jahrgang, 1933<br />
Kubr, Milan, Management Consulting, 3 th edition, Geneva 1996, S. 735 ff.<br />
12
Protestantische Aspekte der Unternehmensethik<br />
Prof. Dr. <strong>Ralf</strong> <strong>Hoburg</strong><br />
Mit jeder Handlung bin ich als Handelnder bereits ein moralisches Subjekt. Dies gilt im<br />
individuellen Bereich ebenso wie im Kontext des öffentlichen Handelns – etwa in der Politik – und<br />
nicht weniger im Feld des ökonomischen Handelns. In jeder Handlung steckt das Wissen um<br />
„gut“/“böse“, richtig oder falsch, von „angemessen“ bzw. „unangemessen“ und dieses Wissen<br />
kommt zustande durch mein persönliches Werturteil. 1 Auch das ökonomische Handeln setzt ein<br />
solches Werturteils-Wissen voraus und ich möchte die These wagen, dass das subjektive Werturteil<br />
auch die Grundlage aller ökonomischer Entscheidungen und Handlungen darstellt. Von dieser<br />
Perspektive einer moralisch gesättigten Handlungstheorie aus möchte ich meine Überlegungen zur<br />
Begründung von Unternehmensethik dezidiert christ-lich protestantisch formulieren. 2 Ich beziehe<br />
mich hierbei auf die Überlegungen des Kollegen Günther <strong>Buchholz</strong> von der Fakultät <strong>Wirtschaft</strong> der<br />
FH-Hannover und dessen Thesen zum Thema der <strong>Wirtschaft</strong>sethik und möchte den Versuch<br />
unternehmen, auf der Grundlage seiner Überlegungen Übereinstimmung und kritische Einwände zu<br />
formulieren. Es war gewünscht, zu den Thesen kritisch Position zu beziehen, was ich durch<br />
insgesamt vier Zwischenrufe tun möchte.<br />
Erster Zwischenruf: Das Märchen von der wertfreien Ökonomie<br />
Wie es kein Handeln ohne moralische Grundierung gibt, so gibt es auch keinen „wertfreien“ Markt,<br />
denn die dort stattfindenden Handlungen sind in sich reduzierbar auf Resultate subjektiven<br />
Handelns, also an sich Ergebnisse von diversen Handlungsmotivationen und Handlungsketten,<br />
deren Teil auch die moralische Reflexion darstellt. So ist jede Manage-rin/Manager und jeder<br />
Besitzer von Aktien an sich auch ein moralisches Subjekt und alles Handeln – einschließlich des<br />
wirtschaftlichen Handelns – setzt in mir Maßstäbe von Fairness und Gerechtigkeit und damit<br />
durchaus ethische Kriterien voraus. Dass etwa Unternehmer auch „ethische Subjekte“ sind und<br />
Unternehmen in vielfacher Weise ethische Handlungs-dimensionen inmitten ihrer ökonomischen<br />
Überlegungen aufweisen, wurde in der Vergan-genheit in der öffentlichen Debatte leider oft<br />
vernachlässigt, woran die Ökonomen nicht ganz unschuldig sind. 3 Zu oft wird etwa das Faktum<br />
übersehen, dass in der Bundesrepublik Deutschland die maßgebliche <strong>Wirtschaft</strong>ssäule Betriebe des<br />
Mittelstands sind und eben nicht Aktiengesellschaften. Es sind also in der Mehrzahl „Unternehmer“<br />
und nicht „Unternehmen“, deren Ziel die radikale Steigerung des an der Börse notierten<br />
Unternehmenswertes zur Befriedigung der Shareholder-Value sind, die ökonomisch handeln. Die<br />
Frage nach der Ethik bekommt hier also schon ein ganz anderes Gewicht, wenn im Vorfeld der<br />
Referenzrahmen kritisch betrachtet wird. 4<br />
Die Ausführungen des Kollegen <strong>Buchholz</strong> setzen in gewisser Weise das von dem Soziologen Max<br />
Weber in seiner Schrift „Die protestantische <strong>Wirtschaft</strong>sethik“ begründete Theorem rationaler<br />
Handlungsweisen bzw. dem Ansatz zweckrationaler Gewinnoptimierung als Grundlage des<br />
ökonomischen Handelns voraus. Zwar spricht der Kollege von einer gewissen „Nachdenklichkeit“,<br />
die durch die jüngste <strong>Wirtschaft</strong>skrise in dieser Sache in Gang gekom-men ist, aber das Prinzip der<br />
optimierenden Handlungsrationalität als solches stellt er nicht in Frage. Aus meiner Sicht müsste<br />
die Ökonomie weiter gehen und genau dieses Theorem der Ökonomie neu überdenken. Denn die<br />
jüngste Finanzkrise zeigt: Das moralische Werturteil, dass der Markt eine inhärente Ethik aufweist<br />
und sich selbst normativ reguliert, stimmt unter den Bedingungen der Globalisierung nur noch sehr<br />
1 Vgl. hierzu Hans Joas, Die Entstehung der Werte, Frankfurt 1997; den Kontext von Urteilen und Handeln reflektiert<br />
prinzipiell Detlef Garz/ Fritz Oser/ Wolfgang Althof (Hgg.), Moralisches Urteil und Handeln, Frankfurt 1999.<br />
2 Grundlage einer modernen <strong>Wirtschaft</strong>sethik beschreibt Traugott Jähnichen, <strong>Wirtschaft</strong>sethik. Konstellationen –<br />
Verantwortungsebenen – Handlungsfelder, Stuttgart 2008.<br />
3 Eine Untersuchung auf dem Hintergrund qualitativer Probanden-Interviews hat jüngst vorgelegt Klaus Hartmann,<br />
Manager und Religion. Zum Wandel beruflicher und religiöser Lebensführung, Konstanz 2007.<br />
4 Siehe <strong>Ralf</strong> <strong>Hoburg</strong>, Jenseits des Ökonomischen, DtPfBl 2007.<br />
13
gebrochen. 5 Mit grundsätzlichen Beibehaltung des von Adam Smith in seiner Schrift: „Der<br />
Reichtum der Nationen“ begrün-deten Annahme 6 hat der Kollege <strong>Buchholz</strong> durchaus im Konsens<br />
mit der ökonomischen Theorie – wo er ein ethisches Türchen geöffnet hat – ein entscheidendes<br />
Türchen wieder zu gemacht. Denn genau hier besteht bis jetzt die „Krux“ im Dialogfeld von Ethik<br />
und Ökonomie. Aus ökonomischer Perspektive wird sehr wohl die Notwendigkeit ethischer<br />
Überlegungen gesehen, aber Ethik wird nicht in genügender Form in das Theoriekonzept von<br />
Ökonomie „integrativ“ eingebunden, sondern fast ausschließlich aus den Erfordernissen der Praxis<br />
bei gleichzeitiger Geltung gängiger Theoreme begründet. 7 So schreibt der Kollege <strong>Buchholz</strong>: „In<br />
der <strong>Wirtschaft</strong>sethik werden ethische Überlegungen auf das Praxisfeld Wirt-schaft angewandt.“<br />
Ethik wird damit zu einem „Adiaphoron“ ökonomischer Prozesse und geriert zur blanken<br />
„Legitimationsethik“ bestehender Theorieannahmen bzw. des praktischen unternehmerischen<br />
Handelns. Aus der Sicht der protestantischen Sozialethik ist das zu wenig und muss sich die Ethik<br />
als Wissenschaft „missbraucht“ vorkommen. Damit bleibt der Kol-lege dem Modell der Dominanz<br />
der Ökonomie gegenüber der Ethik verhaftet. Bislang hat einzig Peter Ulrich mit dem St. Gallener<br />
Konzept den Versuch einer „integrativen Wirt-schaftsethik“ unternommen, der Ethik und wirtschaft<br />
gleichrangig einander zuordnet. 8<br />
Demnach ist Unternehmensethik weit mehr als ein praktisch von außen zu implementierendes<br />
Konzept, sondern vielmehr ein in der Ökonomie selbst zu verankerndes theoretisches Postulat. Für<br />
den Ökonomen Peter Ulrich ist der Wert der „Kritik“ bzw. der Ideologiekritik ein wichtiges Feld in<br />
der Argumentation, die er „Ökonomismuskritik“ nennt. Er will den Schein der ökonomischen<br />
„Wertfreiheit“ und der ethischen Neutralität der ökonomischen Sachlogik durchschauen. 9 Aus<br />
dieser Perspektive ist es das Verdienst von Ulrich, als erster Ökonom den „Mythos des Marktes“<br />
beschrieben zu haben. Das wirtschaftliche Handeln muss hierbei wieder mehr an den<br />
gesellschaftlichen Kontext herangerückt werden.<br />
Lese ich die Überlegungen des Kollegen <strong>Buchholz</strong>, so begegnet mir bei ihm trotz des für ihn<br />
maßgeblich im Hintergrund nach wie vor gültigen Rationalitätstheorems, wie es klassisch die<br />
Ökonomie formuliert, in Ansätzen ein ähnlicher gedanklicher Zusammenhang wie bei Peter Ulrich.<br />
Grundsätzlich besteht demnach Übereinstimmung zwischen uns, dass die Grundlage aller<br />
ökonomischen Prozesse handelnde Subjekte sind, die wie der Kollege schreibt – in<br />
Handlungsautonomie – agieren wollen. Damit haben wir aber eine gemeinsame Basis zwischen<br />
Ökonomie und Theologie, nämlich vor dem Hintergrund von Handlungs- oder Systemtheorie geht<br />
es „subjektorientiert“ um die Prinzipien ökonomischen Handelns von Individuen. 10 Anders<br />
formuliert: Der ökonomisch handelnde Mensch und der ethisch handelnde Mensch sind ein und<br />
dieselbe Person!<br />
Räumt man nämlich den Mythos von der Zweckrationalität des „homo oeconomicus“ einmal<br />
beiseite und legt ihn vorläufig in die Mottenkiste wissenschaftlicher Theorien, kommt die<br />
Anthropologie als gemeinsame Grundlage von Ökonomie, Ethik und Theologie zu Tage. Der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sjournalist Uwe Jean Heuser räumt in seinem jüngsten Buch „Humanomics. Über die<br />
Entdeckung des Menschen in der <strong>Wirtschaft</strong>“ dem anthropologischen Faktor eine enorme Rolle<br />
zu. 11 Für ihn ist es eben nicht das Prinzip optimierender Handlungen, sondern das reziproke<br />
5 Darauf weist schon sehr grundlegend hin Martin Büscher (Hg.), Markt als Schicksal? Zur Kritik und Überwindung<br />
neoliberaler <strong>Wirtschaft</strong>s- und Gesellschaftspolitik, Bochum 1998. Es ist doch für den wissen-schaftlich-theoretischen<br />
Zustand der <strong>Wirtschaft</strong>swissenschaften äußerst tiefblickend, dass die Lehrbuch-Ökonomie so Ideologie-resistent<br />
gegenüber neueren kritischen Ansätzen ist.<br />
6 Zur <strong>Wirtschaft</strong>sgeschichte siehe etwa Peter Jay, Das Streben nach Wohlstand. Die <strong>Wirtschaft</strong>sgeschichte des<br />
Menschen, Düsseldorf 2006.<br />
7 Darin liegt etwa auch die Schwierigkeit im Lehrbuch Elisabeth Göbel, Unternehmensethik. Grundlagen und<br />
praktische Umsetzung, Stuttgart 2006.<br />
8 Peter Ulrich, Integrative <strong>Wirtschaft</strong>sethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, Berlin/ Stuttgart/ Wien, 4.<br />
Auflage, 2008.<br />
9 Ebd., 125.<br />
10 Vgl. etwa Johannes Eurich/ Alexander Brink, Zur Rolle der Moral im ökonomischen Modell des Homo oeconomicus,<br />
in: Heinz Schmidt (Hg.), Ökonomie und Religion. Fatal Attraction – Fortunate Correction, Heidelberg 2006, 95-128.<br />
11 Vgl. Uwe-Jean Heuser, Humanomics. Die Entdeckung des Menschen in der <strong>Wirtschaft</strong>, Campus 2008.<br />
14
Handeln zum gegenseitigen Nutzen, das auch das ökonomische Handeln leitet. Nach Heuser<br />
gewinnt derjenige, der teilt! Damit ist das Gespräch über ethisches Handeln als Teil eines<br />
ökonomischen Prinzips eröffnet. Im Menschenbild könnte durchaus die gemein-same Grundlage für<br />
das zukünftige Gespräch zwischen den Disziplinen liegen. Und vom Menschenbild aus gesehen<br />
sind es die moralischen Werthaltungen, die gesellschaftlich und biographisch mein Handeln<br />
prägen. 12 Hier gibt es viel Stoff, den Ökonomen zusammen mit Ethikern, Psychologen, Soziologen<br />
und Theologen entdecken können. 13 Die Voraussetzung dazu ist allerdings, dass sich die<br />
<strong>Wirtschaft</strong>swissenschaft konkret als Humanwissenschaft begreift und sich auf den Weg zu neuen<br />
Theorieufern macht.<br />
Zweiter Zwischenruf: Klare Unterscheidung von Unternehmensethik und <strong>Wirtschaft</strong>sethik<br />
Eine der für mich wichtigen Faktoren im gemeinsamen Gespräch zwischen Ökonomie und<br />
Theologie besteht in der Klarheit der Verhandlungsgegenstände. Der Verweis auf die Regelungsmechanismen,<br />
die der Kollege <strong>Buchholz</strong> in seinen Thesen mit Rückgriff auf die Argumentationen<br />
von Milton Friedman anführt, verweist darauf, dass es ihm im Gespräch vor allem um<br />
die „<strong>Wirtschaft</strong>sethik“ als Gegenstandsbereich geht. Insoweit führt der Kollege in seiner<br />
Argumentation mehrfach den Gesetzgeber als Instanz zur Definition von Legalitäts- und<br />
Illegalitätsgrenzen an. Aber bereits der öffentlich-ethische Reflexionsprozess über Moralitätsgrenzen,<br />
der am Beispiel von Bestechungsskandalen im Ausland angeführt wird, ist<br />
wiederum kein wirtschaftsethischer, sondern ein unternehmensethischer Diskurs. Ebenso ist das<br />
angeführte „unethische“ Verhalten von Unternehmungen kein Gegenstand der Wirt-schaftsethik.<br />
Aus der Sicht der Ethik mahne ich also die <strong>Wirtschaft</strong>swissenschaft an, klarer zu unterscheiden und<br />
sich wissenschaftlich präziser auf das Feld der Ethik zu beziehen, was auch bedeutet sich auf deren<br />
theoretische Argumentationsebenen zu beziehen.<br />
Der wirtschaftsethische Diskurs lässt sich zurückführen auf die katholische Soziallehre und die<br />
Ordnungstheorie von Karl Hohmann. Im engeren Sinne besteht der Gegenstand der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik in der Reflexion der Ordnungsprinzipien des wirtschaftlichen Handelns, d.h. der<br />
„frame“ wird hierbei zum Thema. 14 Letztendlich geht es der <strong>Wirtschaft</strong>sethik um die Definition der<br />
Rahmenordnung oder anders formuliert: um die Definition der Spielregeln des Wettbewerbs.<br />
Kommen wir im Gespräch zwischen Ökonomie, Ethik und Theologie also über wirtschaftsethische<br />
Fragen ins Gespräch, geht es um die Positionierung und Reflexion der Grundlagenwerte von<br />
„Markt“ und „Wettbewerb“. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat hierzu in ihrer<br />
wirtschaftsethischen Denkschrift Position bezogen. 15 Das normative Thema der <strong>Wirtschaft</strong>sethik<br />
besteht daher in Fragen von Teilhabefähigkeit und sozialer Inklusion unter dem Gesichtspunkt von<br />
Chancengleichheit und Beteiligung. Der ethische Maßstab dieser Fragestellung ist der öffentliche<br />
Diskurs über die „soziale Gerechtigkeit“. 16 Es ist letzt-lich die von dem Kollegen angeführte<br />
Position, dass der Markt sich selbst ordnet und regelt, die im wirtschaftsethischen Gespräch<br />
überprüft werden sollte. Diesem Anliegen ist dann auch die protestantische <strong>Wirtschaft</strong>sethik in der<br />
Tradition von Arthur Rich bis Eilert Herms gefolgt. 17 Das Ziel ist die Gewinnung einer ethischen<br />
Grundlagenreflektion des ökonomischen Denkens in der Gesellschaft.<br />
Der Gegenstand wirtschaftsethischer Überlegungen muß daher für die Ökonomie die Frage sein,<br />
wie durch die Prozesse von Globalisierung und der Gestaltung von Unternehmensstruk-turen bzw.<br />
den Prinzipien ökonomischen Handelns soziale Differenz im negativen Fall gefördert und im<br />
12<br />
Letztlich ließe sich von hier aus eine attraktive Form einer Berufsethik für ökonomische Berufe entwickeln. Vgl. etwa<br />
in anderem Zusammenhang <strong>Ralf</strong> <strong>Hoburg</strong> (Hg.), Theologie der helfenden Berufe, Stuttgart 2008. Die Implementierung<br />
einer solchen wirtschaftlichen Berufsethik wäre ein wichtiger Standort- und Erfolgsfaktor einer Fachhochschule.<br />
13<br />
Siehe auch Jean-Pierre Wils (Hg.), Orientierung durch Ethik?, Paderborn 1993.<br />
14<br />
Vgl. hierzu mein <strong>Arbeitspapier</strong> im Seminar Unternehmensethik <strong>Ralf</strong> <strong>Hoburg</strong>, <strong>Wirtschaft</strong>sethik und Unternehmensethik.<br />
15<br />
Vgl. EKD (Hg.),<br />
16<br />
Vgl. EKD (Hg.), Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland. Gemeinsame Text Bd. 3, Hannover 1997.<br />
17<br />
Stellvertretend sei genannt Eilert Herms, Theoretische Voraussetzungen einer Ethik des wirtschaftlichen Handelns,<br />
in: Ders. (Hg.), Gesellschaft gestalten. Beiträge zur evangelischen Sozialethik, Tübingen 1991, 146ff.<br />
15
positiven Fall gemindert wird. In diesem Sinne ist die notwendige Diskussion über<br />
„Managergehälter“, die der Kollege <strong>Buchholz</strong> in seinen Thesen als Beispiel anführt, ein typisches<br />
wirtschaftsethisches Thema oder die Frage nach dem Zusammenhang von ökonomischer<br />
Gewinnsteigerung und Streichung von Arbeitsplätzen. Was ist die Funk-tion der <strong>Wirtschaft</strong> in der<br />
Gesellschaft? Darüber würde ich in der Tat gerne mit Ökonomen in die Diskussion kommen. Das<br />
klassische Lehrbuch zur <strong>Wirtschaft</strong>spolitik von Bruno Molitor antwortet darauf nur mit einem<br />
kleinen Satz: Das Ziel der <strong>Wirtschaft</strong> und damit ihr Sinn und Zweck liegt in der<br />
„gesamtgesellschaftlichen Wohlstandssteigerung“. 18 Zu dieser gesamtge-sellschaftlichen Aufgabe<br />
der <strong>Wirtschaft</strong> gehört dann aber auch ein Diskurs über Geldmit-telverteilung, Beseitigung sozialer<br />
Notlagen sowie wirtschaftwissenschaftliche Reflexionen zum Thema der Arbeitsmarktpolitik. Der<br />
Kollege hat insofern recht, als mit der <strong>Wirtschaft</strong>s-ethik immer ein gesellschaftlicher Diskurs<br />
verbunden ist. Als Fachhochschule täten wir daher gut daran, den wirtschaftsethischen Diskurs<br />
normativ für alle Ausbildungsfächer sozusagen als „Studium generale“ zu implementieren, in dem<br />
das Bewusstsein einer ethischen Verant-wortung für die Studierenden zu einem Teil ihrer<br />
beruflichen Identität wird – eben nicht nur als ethisches Fähnlein in der Sozialarbeit oder einem<br />
kirchlich-religiösen Berufsfeld wie dem der Religionspädagogen, sondern gerade und besonders bei<br />
Maschinenbauern oder im Bereich der Medien oder gar von Textil und Design. Wer heute die<br />
Förderung von Wertebewusstsein der Studierenden im Rahmen eines Studiums als eine zu<br />
vernachlässigende Größe ansieht und allein auf technologische Innovation setzt oder die<br />
Bildungsvoraussetzungen der Studie-renden, ist leider nicht auf dem aktuellen Stand der<br />
Bildungsdiskussion. Die Abschaffung einer Institution wie des Studium Generale an der FH-<br />
Hannover durch das Präsidium ist daher m.E. genau die falsche Entscheidung.<br />
Die Ebene der sog. „Codes of Conduct“ bzw. der gesamte Bereich der sog. „Corporate Governance“<br />
betrifft im engeren Sinne die Unternehmensethik. Kommen wir über sie ins Gespräch, geht<br />
es um die Frage des ethischen Verhaltens von Unternehmen und der sozialen Gestaltung von<br />
ökonomischer Interaktion. Hier sind es vor allem „ethische Haltungen“, die auf der Grundlage<br />
ökonomischer Handlungen von Subjekten betrachtet werden müssen. Dahinter verbergen sich<br />
eminent praktische Fragen einer „Produzenten-„ bzw. „Rezipientenethik“ so etwa die Frage: wie<br />
sind die umweltethischen Bedingungen in Produktions- und Verkaufs-prozesse mit ein zu<br />
beziehen? 19 Etwas simpel ausgedrückt ist die Unternehmensethik „Lei-tungs- und Führungsethik“<br />
und beschreibt dann die ethischen Handlungsmaßstäbe im gesamten Managementprozess. Etwas<br />
komplizierter wird es, wenn man die Umwelt des Unternehmens mit hinzuzieht. Dann wird<br />
Unternehmensethik in einem 6-fachen Feld relevant. Ethische Prinzipien kommen dann zur<br />
Diskussion<br />
� Im Umgang mit Wettbewerbern im Markt<br />
� Im Umgang mit Kunden<br />
� Im Umgang mit Mitarbeitern<br />
� Im Umgang mit der Umwelt<br />
� In der Produkt- und Preispolitik<br />
� In der Unternehmenskommunikation<br />
Dritter Zwischenruf: Der Begriff der Ethik<br />
In der Definition der Ethik liegt mein größter Dissens zu den Überlegungen des Kollegen. Ganz im<br />
Rückgriff auf die klassisch griechische Definition, die dann bei dem Philosophen Kant aufgegriffen<br />
wird, definiert der Kollege <strong>Buchholz</strong> Ethik als den Bereich dessen, was zu tun oder zu sollen ist. 20<br />
18 Bruno Molitor, <strong>Wirtschaft</strong>spolitik, München/Wien, 6. Auflage, 25.<br />
19 Die Diskussion im Bereich der NPO’s bzw. der NGO’s ist hier weit gediehen. Vgl. zum gesamten Komplex Hanns-<br />
Stephan Haas/ Udo Krolzik (Hg.), Unternehmen Diakonie, Stuttgart 2007.<br />
20 Damit bewegt er sich auf dem Pfad deontologischer Denktradition. Wer aber setzt in einer pluralistischen<br />
Gesellschaft die normativen bzw. objektiven Maßstäbe des Handelns? Ethische Begründung kann daher im Kontext der<br />
Moderne nicht deduktiv vorgehen, sondern induktiv. Es geht um die Begründungszusammenhänge des moralischen<br />
Urteilens von Subjekten.<br />
16
Mein Einwand dagegen ist die sehr pragmatische Überlegung, dass in pluralistischen und<br />
individualistischen Gesellschaft kein Konsens über das Prinzip des guten Handelns mehr besteht.<br />
So wie sich individuelles Handeln aufgelöst hat in die Erfordernisse der Situation, ist auch<br />
ökonomisches Handeln kontextabhängig. Eine Ethik, die sich auf die Festlegung von Prinzipien des<br />
guten Handelns festnageln ließe, wäre im Keim bereits erstickt. Wie kommt es – das ist meine<br />
kritische Rückfrage an den Kollegen – zu der Entschei-dungsfindung – welche Ziele im<br />
Unternehmen als gut und damit als „ethisch“ gerechtfertigt anzusehen sind?<br />
Vielmehr ist der Begriff der Ethik in Aufnahme der Subjektivitäts- und Handlungstheorien als<br />
Reflexion der Moral zu verstehen, deren Ziel die Übernahme von Verantwortung in konkreten<br />
Handlungssituationen ist. Im Begriff der Ethik, wie ihn der Kollege verwendet, fehlt mir der Aspekt<br />
der Wertorientierung des Handelns. Die Ethik in Bezug auf ökonomisches Handeln lässt sich von<br />
hier aus betrachtet gut ergänzen durch den systemtheoretischen Aspekt der Umwelt des<br />
Unternehmens.<br />
Mit den Eckwerten von „Wertorientierung“ als unternehmensethischem Grundsatz und der<br />
Einbeziehung der sozialen Umwelt von Unternehmen wird jedes Unternehmen zu einem sozialen<br />
Akteur im gesellschaftlichen Feld. 21 Mit dieser Beschreibung der Grundlage der Ethik als<br />
„Wertorientierung“ öffnet sich ein weites Feld normativer Beschreibungen einer<br />
Unternehmenskultur oder Unternehmensphilosophie. Der Begriff des „Wertes“ setzt dabei eine<br />
ethische Normorientierung voraus. Die Wertorientierung des Handelns ist es, die das gute Handeln<br />
des Kaufmanns ausmacht, denn der gute Kaufmann wird so handeln, dass er nicht den Gewinn um<br />
jeden Preis realisiert, sondern ihm geht es um die Zufriedenheit des Kunden und demnach um den<br />
Aspekt der „Nachhaltigkeit“. Damit ist die „Wertschätzung“ von Personen, fairen Tauschprozessen<br />
und Sachen ein wichtiger Bestandteil unternehmens-ethischer Reflexion, die es in jedem<br />
Studiengang als „soziale und ethische Kompetenz“ eigens zu vermitteln gilt. Dadurch wird der<br />
Faktor „Sozialität“ als neuartige Kategorie in die Ökono-mie eingeführt. Das ist an sich nichts<br />
Neues, denn im Mittelalter war die wirtschaftliche Aktivität eingegliedert in den organischen<br />
Zusammenhang der gesamten Gesellschaft. Noch in der frühen Neuzeit hatte die <strong>Wirtschaft</strong> eine<br />
soziale Funktion. Es existierte die Lehre vom „gerechten Preis“ (iustus pretium) und das kirchliche<br />
Zinsverbot entwickelte eine Wirkung in der Gesellschaft. Dies änderte sich erst mit dem<br />
Aufkommen des Utilitarismus, der mit John Stuart Mill theorieprägend wurde.<br />
Ich stimme mit dem Kollegen Günther <strong>Buchholz</strong> deshalb darin überein, dass es primär die<br />
Orientierung an den Stakeholdern ist, die den Referenzrahmen einer Unternehmensethik als den<br />
Prinzipien wertorientierten unternehmerischen Handelns bilden sollte. Aber wer sind diese? Zu den<br />
Stakeholdern gehört dann neben den Interessen des Unternehmens selbst auch das Interesse des<br />
lokalen Gemeinwesens und seiner sozialen und ökonomischen Entwicklung. Es wird eine<br />
wissenschaftliche Aufgabe der Zukunft sein, die sozialen Interaktionsprozesse der Unternehmen mit<br />
ihrer Umwelt genauer zu erforschen. Die neu erschienene Studie der Bertelsmann-Stiftung über<br />
Unternehmen als Sozialpartner bietet hier etliche Anregungen. 22<br />
Vierter Zwischenruf: Mahnung zur Bescheidenheit oder: wider die Erwartungen<br />
Ethik ist nicht das Allheilmittel für die Probleme, deren Wurzeln woanders liegen. Was kann also<br />
die Unternehmensethik bzw. ein wirtschaftsethischer Diskurs im konkreten Dialog zwischen<br />
Unternehmen und Wissenschaft leisten? Der aus der Perspektive des Kollegen der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>swissenschaften benannte Diskurs über Gerechtigkeitsfragen steht natürlich einem<br />
protestantischen Denker durchaus wohl, waren es doch die Aspekte des jüdischen und paulinischen<br />
Gerechtigkeitsbegriffs, die Martin Luther in der Reformation zum Klingen ge-bracht und die dann<br />
in der Französischen Revolution neu aufgegriffen wurden. Ich möchte den Aspekt der Gleichheit,<br />
wie ihn der Kollege in seinen Thesen abschließend reflektiert, aufnehmen: Aus theologischer Sicht<br />
21 So agieren inzwischen die Management-Lehrbücher für den Bereich der NPO’s. Uto Meier/ Bernhard Sill (Hg.),<br />
Zwischen Gewissen und Gewinn. Wertorientierte Personalführung und Organisationsentwicklung, Regensburg 2005.<br />
22 Vgl. Bertelsmann-Stiftung (Hg.), Grenzgänger – Pfadfinder – Arrangeure. Mittlerorganisationen zwischen<br />
Unternehmen und Gemeinwohlorganisationen, Gütersloh 2008.<br />
17
– die philosophische Ethik mag hier durchaus abweichen – sollte der Gedanke der sozialen<br />
Gleichheit (der sicherlich als absolute Forderung eine Utopie bleibt) ergänzt werden durch den<br />
Aspekt der „Gabe“, der aus der jüdischen Tradition heraus stammt. Danach bilden Wohlstand und<br />
Reichtum ein „Geschenk“ bzw. eine Gabe, die es zu teilen gilt. Wenn man so will, ist die Klausel<br />
des Grundgesetzes, wonach das Eigentum verpflichtet, eine tiefes soziales Erbe jüdischer Kultur in<br />
Europa. Kann man so weit gehen und von der „Sozialität des Geldes“ sprechen? M.a.W. stehen wir<br />
heute vor der eminent wirtschaftsethischen Frage: Ist der Markt mit seinem ihm implizit<br />
zugesprochenen morali-schen „Wertuteil“ gut für alle Bereiche der Gesellschaft zu sein, die<br />
wirklich für alle Bereiche der Gesellschaft angemessene Form des ökonomischen<br />
Gestaltungsprinzips? Oder deutlicher formuliert: Bedarf es nicht gerade um des „Wohlstandes“ der<br />
Nationen willen Bereiche, die dem Marktgeschehen enthoben und eher nach moralisch-ethischen<br />
Kriterien behandelt werden? Ich gestehe, dass ich zumindest in zwei Bereichen diese Auffassung<br />
vertreten könnte: „Geld“ sollte etwa in der Gesellschaft eine Ware „sui generis“ sein und bleiben,<br />
das dem kompletten Zugriff des Marktes enthoben ist und die Systeme der Sozialen Sicherung sind<br />
Bereiche, die sich der totalen Ökonomisierung verweigern, weil es in ihnen um das „Letzte“ des<br />
Menschen, nämlich seinen Tod bzw. seine Gesundheit geht.<br />
Bei alledem wird es darauf ankommen, bescheiden zu bleiben, d.h. es wäre doch schon viel<br />
gewonnen, wenn Unternehmer vor Ort mit Wissenschaftlern ins Gespräch kämen über die ethischen<br />
Grundsätze ihres persönlichen ökonomischen Handelns. Dabei würden wir fest-stellen, dass jenseits<br />
theoretischer Modelle und Diskussionen viel unternehmensethisches Handeln bereits vorhanden ist.<br />
Es ist nur noch zu wenig erforscht! Und das ist dann unsere Aufgabe.<br />
18
Nikolaus von Myra,<br />
Schutzpatron der Kaufleute,<br />
Seefahrer und Bäcker<br />
Der ehrbare Kaufmann<br />
Variationen zur Tugend der Mäßigung<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
19<br />
Hermes/Merkur,<br />
Schutzgott des<br />
Verkehrs, der<br />
Reisenden, der<br />
Kaufleute<br />
Variation 1<br />
Johann Siegmund Mann I alias Johann<br />
Buddenbrook der Ältere (1765–1842)<br />
„Mein Sohn, sey mit Lust bey den Geschäften am<br />
Tage,<br />
aber mache nur solche, daß wir bey Nacht ruhig<br />
schlafen können“.<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
1<br />
2
Hanseatische Tradition 1<br />
• Bildung: liest Chroniken und Historien<br />
• Interkulturelle Kompetenz<br />
• Gewinnstreben in Balance mit Risiko und<br />
Sicherheit<br />
• Pflegt sein Ansehen zum Erhalt seiner<br />
Kreditwürdigkeit<br />
• Vermögenssicherung durch Sparsamkeit,<br />
Bescheidenheit und Maßhalten<br />
• Politiker im Dienste seiner Heimatstadt<br />
• Mitglied der Handelsgesellschaften<br />
• Wahrnehmung von Sozialverpflichtung<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Hanseatische Tradition 2<br />
Kaufmännische Solidität/Moral der<br />
Vertragstreue (Sombart):<br />
• Zuverlässigkeit im Halten von<br />
Versprechungen<br />
• Reelle Bedingungen<br />
• Pünktlichkeit der Erfüllung der<br />
Verpflichtungen<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
20<br />
3<br />
Hinrich Castorp, Lübeck1420-80<br />
4
Hanseatische Tradition 3<br />
• Nüchtern kalkulieren<br />
• Hart verhandeln<br />
• Pünktlich liefern<br />
• Sauber abrechnen<br />
• Toleranz<br />
• Engagement für das Gemeinwesen<br />
• Firma und Mitarbeiter sind im Zweifelsfall<br />
wichtiger als die eigene Person 1<br />
1 Vgl. Fandel,G./Schwalbach,J.<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Hanseatische Tradition 4<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
21<br />
Adolph Woermann<br />
Der ehrbare Kaufmann arbeitet sicher,<br />
langsam, beharrlich, besonnen und ist<br />
genügsam in seinen Ansprüchen.<br />
• „Eile mit Weile!“<br />
• Arbeit soll Segen sein und nicht Geißel<br />
• Maßhalten im Ton<br />
• Klarheit des Ausdrucks<br />
• Kulanz<br />
Oswald Bauer, 1906<br />
Work-Live-Balance<br />
5<br />
6
Variation 2<br />
Die italienische Tradition<br />
• Entstehung der Kaufmannsgilden: Einfluss<br />
auf die Ehre des Kaufmanns nach außen<br />
und innen<br />
• 13.Jahrhundert: Städte wurden sozial und<br />
politisch von Kaufleuten dominiert<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Der italienische Kaufmann<br />
• Gewinnstreben<br />
• Rationale und emotionale Kompetenz<br />
• Organisationstalent<br />
• Politischer und wirtschaftlicher Weitblick<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
22<br />
7<br />
8
Der tugendhafte italienische<br />
Kaufmann<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Palazzo dei Priori, Perugia<br />
Collegio del Cambio<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
23<br />
Palazzo dei Priori, Perugia, 1452<br />
9<br />
10
Perugia: Palazzo dei Priori/<br />
Collegio del Cambio<br />
Prudentia und Justitia<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Pietro Vannucci „Il Perugino“<br />
1496-1500 gemalt<br />
11<br />
24<br />
Perugia: Palazzo dei Priori/<br />
Collegio del Cambio<br />
Fortitudo und Temperantia<br />
Tafel der Temperantia<br />
Dic, dea, quae tibi vis! Mores rego,<br />
pectoris aestus<br />
tempero et his alios, cum volo, reddo<br />
pares.<br />
Me sequere et, qua te superes<br />
ratione, docebo.<br />
Quid, tu quod valeas vincere, maius<br />
erit?<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Sage, Göttin, was Du für Dich willst!<br />
Ich lenke die Sitten,<br />
ich mäßige die ungestümen<br />
Leidenschaften des Herzens<br />
und mache andere<br />
diesen gewachsen, wenn ich will.<br />
Folge mir und ich werde Dich lehren,<br />
auf welche Weise Du Dich<br />
überwindest.<br />
Was wird größer sein, als dass Du in<br />
der Lage bist zu siegen?<br />
Die Beispiel-Gestalten<br />
• Publio Scipione= Publius Scipio<br />
Aemilianus Africanus<br />
• Pericles Atheniense= Perikles von Athen<br />
• Quinto Cicinnato= Lucius Quinctius<br />
Cincinnatus.<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
13<br />
14<br />
Pietro Vannucci „Il Perugino“<br />
1496-1500 gemalt<br />
12
Perugia: Palazzo dei Priori/<br />
Collegio del Cambio<br />
Fortitudo und Temperantia<br />
Niki de Saint Phalle: La Grande<br />
Temperance,<br />
Hauptpost Luxemburg<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
25<br />
Pietro Vannucci „Il Perugino“<br />
1496-1500 gemalt<br />
15<br />
16
Variation 3<br />
Italienische Tradition<br />
Die Tugenden der „Guten Regierung“<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Pubblico,<br />
Siena: Gute Regierung, 14.Jd.<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
26<br />
17<br />
18
Säen und das Feld bestellen<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Der eigenen Arbeit nachgehen<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
27<br />
19<br />
20
Heiraten<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Feiern und Tanzen<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
28<br />
21<br />
22
Variation 4<br />
Globalisierte Welt:<br />
Der ehrbare Manager?<br />
• Kern: Menschlichkeit und <strong>Wirtschaft</strong>lichkeit<br />
• Kein schamloses Ausnutzen der<br />
Lohnunterschiede: Schutz der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sordnung<br />
• Langfristige wirtschaftliche Ziel statt kurzfristiger<br />
Rendite<br />
• Förderung sozialer Entwicklung: Finanzierung<br />
von Schulen; Aufbau von Infrastruktur<br />
Literatur u.a.:<br />
Daniel Klink: Der ehrbare Kaufmann, 2007<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
Dank:<br />
Prof. Dr. Wolfram Ax, Institut für Altertumskunde, Klassische Philologie, Köln<br />
Frank Schönfeld, Seminar für Kunstgeschichte, Göttingen<br />
Prof. Dr. Christiane Burbach, FH,<br />
Fakultät V<br />
29<br />
23<br />
24
Prof. Dr. Christiane Burbach<br />
Der ehrbare Kaufmann<br />
Variationen zur Tugend der Mäßigung<br />
Thesen zur Präsentation am 18.11.2008<br />
anlässlich „FH meets economy“ zum Thema <strong>Wirtschaft</strong>ethik<br />
1. Nachdem zuvor die Makro- und Mesoebene der <strong>Wirtschaft</strong>sethik betrachtet wurde, möchte<br />
ich den Mikrobereich ins Auge fassen. Ich möchte ihnen im folgenden kleinen Intermezzo<br />
das Leitbild des ehrbaren Kaufmannes als einer bedeutenden europäischen Tradition der<br />
Selbstinterpretation des Standes der Kaufleute nahe bringen. Unter den vielen Facetten, die<br />
dieses Ethos beinhaltet, möchte ich aus aktuellen Gründen der Entwicklung im Management<br />
der Finanzwirtschaft, die zu einer gigantischen Finanzkrise geführt hat, besonders den<br />
Aspekt der vierten Kardinaltugend, der Mäßigung herausheben.<br />
2. Das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns entstand im Mittelalter und wurde im Hochmittelalter<br />
zur Zeit der kommerziellen Revolution in Norddeutschland mit der Entstehung der Hanse<br />
wie auch in Italien elaboriert. 23 Es war die Zeit erster Globalisierungstendenzen in der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>. Dieses Leitbild wurde bis in das 21. Jahrhundert hinein weiter entwickelt.<br />
Verschiedentlich wird derzeit dieses Leitbild zitiert, allerdings ohne explizit auf diese große<br />
standesethische Tradition zu rekurrieren. Anhand von Bildern möchte ich einige Stationen<br />
nachzeichnen.<br />
3. Eine Variante des Maßhaltens des ehrbaren Kaufmanns treffen wir in der Ermahnung Johann<br />
Siegmund Manns, den wir als Johann Buddenbrook d. Ä. kennen, an seinen Sohn (Folie 2).<br />
Hier zeigt sich der Geist dieses Leitbildes im 19. Jahrhundert: Es gilt gute Geschäfte und<br />
den eigenen Seelenfrieden in der Balance zu halten. Geschäfte, deren Risiko so hoch ist,<br />
dass die Nachtruhe, die ja eine Voraussetzung für besonnenes Handeln bei Tage darstellt,<br />
gefährdet ist, müssen als ruinös gelten. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass man als<br />
erstes über das eigene Gewissen, die erkennbaren psychosomatischen Zusammenhänge<br />
hinweggeht, um schließlich zu erkennen, dass der interne und externe Preis zu hoch war.<br />
- Die Balance von Geschäft und Seelenfrieden kann jedoch nur als ein Indikator des<br />
ehrbaren Kaufmanns betrachtet werden. Angesichts des Traditionsabbruches eines<br />
gemeinsamen Wertesystems könnte es sein, dass einige Manager heute gut schlafen<br />
können, weil sie sich weit genug von den Konsequenzen und Folgen ihres Handelns<br />
entfernt haben, sich gegen diese Folgen immunisiert haben. Am steigenden Verbrauch<br />
von Betablockern, Beruhigungsmedikamenten etc. lässt sich jedoch andererseits ablesen,<br />
dass der Zusammenhang von guten Geschäften und Seelenfrieden dennoch nicht obsolet<br />
ist.-<br />
Stationen des Profils eines ehrbaren Kaufmanns nach hanseatischem Modell finden sich auf<br />
den Folien 3-6 in den Kriterien Hinrich Castorps, der 1420 bis 1480 in Lübeck lebte, Werner<br />
Sombarts, Adolf Woermanns 24 , Präses der Handelskammer Hamburgs, Abgeordneter der<br />
Hamburger Bürgerschaft und im Reichstag sowie Oswald Bauers. Hier fällt besonders auf,<br />
wie der Gedanke der Balance zwischen Eigeninteresse und Sozialverpflichtung, wie die<br />
Vorstellung des Maßhaltens und der Balance zwischen kurzfristigen Zielen und<br />
Nachhaltigkeit sowie Langfristigkeit herausgearbeitet werden.<br />
4. Die italienische Variante des ehrbaren Kaufmanns ist im 13. Jahrhundert entstanden, einer<br />
Zeit, in der die oberitalienischen Städte sozial und politisch von Kaufleuten dominiert<br />
wurden. In vieler Hinsicht zeigen sich Überschneidungen im Hinblick auf die Kriterien.<br />
Allerdings gibt es Darstellungen für den tugendhaften Kaufmann, die noch weit über das<br />
23 Vgl. Daniel Klink; Der ehrbare Kaufmann, www.der-ehrbare-kaufmann.de, 2007, 13ff<br />
24 Woermann war mit seinem Brandweinhandel in Afrika kein unkritisierter Kaufmann, dennoch kann das Dass seines<br />
bürgerschaftliches Engagements als wegweisend gelten.<br />
30
hanseatische Leitbild hinausgehen. Diese finden sich z.B. im Collegio del Cambio in<br />
Perugia.<br />
5. Der Saal der Geldwechsler-Zunft, übrigens auch wieder einer der der Globalisierung<br />
verpflichteten Metiers, wurde 1452-57 gebaut und bis 1500 eingerichtet und befindet sich<br />
im Palazzo dei Priori. 25 Dieser Versammlungsraum verfügt über eine ausgesprochen<br />
prächtige und solide Wandverkleidung. Am interessantesten jedoch sind in meinen Augen<br />
die Wandfresken, die ein bemerkenswertes Bildprogramm zeigen. Dieses Programm wurde<br />
von dem in Perugia lehrenden Humanisten Francesco Maturanzio erstellt und von Pietro<br />
Vannucci >il Perugino< ausgeführt. An der linken Wand befinden sich u.a. die<br />
Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Stärke und Mäßigung, auf denen die<br />
wesentlichen bürgerlichen Lebensnormen beruhen. Diese Darstellungen wollen wir uns aus<br />
gegebenem Anlass näher anschauen. Je zwei der Kardialtugenden sind zu einer Bildtafel<br />
zusammengefasst. Das Bildprogramm ist so aufgebaut, dass die Allegorie der beiden<br />
Tugenden die obere Hälfte des Bildes dominiert. Jeweils zu ihrer Seite haben sie eine Tafel<br />
mit zwei charakterisierenden und erklärenden Distichen. In der unteren Hälfte finden sich je<br />
drei historische Exempel der jeweiligen Tugend. Werfen wir einen genaueren Blick auf die<br />
zweite Tafel: links sehen wir die Fortitudo (Tapferkeit) in Ritterkleidung mit Schild, Zepter<br />
und Siegesfahne; rechts neben ihr: Temperantia (Mäßigung) Wein und Wasser in zwei<br />
Krügen mischend. Auffallend ist, dass sowohl die Fortitudo als auch ihre historischen<br />
Helden ihre Blicke zur rechten Bildhälfte, der der Temperantia, richten. Von ihr ist offenbar<br />
die höhere Ordnung und größere Orientierung zu erwarten.<br />
Besonders aufschlussreich ist ihre Texttafel. Darin wird ihr das Regieren der Sitten, die<br />
Mäßigung der ungestümen Leidenschaften des Herzens und das Gewachsensein diesen<br />
Leidenschaften gegenüber zugeschrieben. In Aussicht gestellt wird die Selbstüberwindung,<br />
die als der größte Sieg, den man erringen kann, verstanden wird. Ungestüm und<br />
Affektbesessenheit sind das Gegenteil von Balance der Kräfte und Impulse.<br />
Die drei historischen Helden sind Publius Scipio Aemilianus Africanus, Perikles von Athen<br />
und Lucius Quintius Cincinnatus, auf die ich hier nicht weiter eingehe. Sie waren damals<br />
bekannt und ihre Taten populär. Heute müssten wir ihren exemplarischen Charakter erst<br />
wieder herausarbeiten.<br />
Bemerkenswert aber ist, dass die Zunft der Geldwechsler in Perugia sich zur Selbstformung<br />
u.a. die Kardinaltugenden an die Wand malen ließen, auch die Temperantia. Bei jeder<br />
Versammlung, jedem Zusammentreffen in illustrer Runde, trafen sie unweigerlich auch auf<br />
die Tugend der Mäßigung, neben der Tapferkeit, Klugheit und Gerechtigkeit; also eine selbst<br />
inszenierte Konfrontation mit universalen Maßstäben.<br />
6. Temperantia wurde in der Renaissance, aber auch in früheren und späteren Epochen in<br />
vielfältiger Weise dargestellt 26 :<br />
� als Plastik am Dogenpalast<br />
� als Fresko<br />
� als Türrelief<br />
� als Majolika und auch<br />
� als Statue von Niki de Saint Phalle.<br />
Temperantia stellt die Balance her zwischen dem berauschenden und dem ernüchternden<br />
Element (Wein und Wasser), zwischen verschiedenen Interessen, zwischen verschiedenen<br />
Charaktereigenschaften. Temperantia sorgt dafür, dass die gegensätzlichen und<br />
spannungsvollen Kräfte des Lebens in dem bekömmlichen Ausmaß Raum erhalten. Die<br />
Mäßigung ist so gesehen kein Knebel, sondern erst das recht verstandene Lebenselixier.<br />
7. In Italien ging man aber noch weiter, die lebensfördernden Kräfte im öffentlichen Raum<br />
darzustellen. Im Palazzo Pubblico in Siena finden wir die Darstellung der „Guten<br />
Regierung“ (und der „schlechten Regierung“) von Ambrogio Lorenzetti (Folie 18). Die<br />
25 Vgl. Klaus Zimmermann: Umbrien. Eine Landschaft im Herzen Italiens 4 , Köln 1987, 78f.<br />
26 Vgl. z.B.: M.J.Tracy/R.Newhauser/D.Briesemeister: Art. Tugenden und Laster, in LexMA, Bd. VIII, 1085-1090.<br />
31
Regierung selbst ist eine Allegorie der Sienesischen Kommune, gekleidet in Schwarz-Weiß,<br />
den Farben des Stadtwappens. 27 Zur Linken der Allegorie befinden sich die<br />
Personifikationen der Gerechtigkeit, Mäßigung und Großherzigkeit, zur Rechten die<br />
Umsicht, Stärke und der Frieden (jeweils von r.n.l.) Es handelt sich um ein modifiziertes und<br />
erweitertes Programm der Kardinaltugenden. Für unseren Zusammenhang ist interessant,<br />
dass auch hier die Mäßigung eine der wesentlichen Kräfte der guten Regierung darstellt. Die<br />
Folien 19 bis 22 zeigen die Folgen der guten Regierung: es sind die Früchte der alltäglichen<br />
Arbeit wie z.B. Säen und Ernten, was man gesät hat; handwerkliche Tätigkeiten<br />
(Schuhmacherwerkstatt) ebenso wie Lernen (Schule). Zur guten Regierung gehört es, dass<br />
Menschen in Ruhe heiraten und eine Familie gründen können! Auch Feste feiern und Tanzen<br />
sind Merkmale einer guten Regierung.<br />
8. Wie nun aber könnte und sollte die vierte Variante im Zeitalter der globalisierten Welt<br />
aussehen? Gibt es Hinweise auf den „ehrbaren Manager“? Gibt es eine Chance für die<br />
Balance unternehmerischer Interessen und die Interessen einer breiten Gesellschaft, der<br />
Balance von kurz- und längerfristigen Gesichtspunkten des <strong>Wirtschaft</strong>ens? Oder muss man<br />
sagen: das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns ist ein vorkapitalistisches Modell, das heute<br />
nicht mehr aktualisierbar ist. Wenn man aber zu dieser Antwort kommt, dann stellt sich die<br />
Frage: Können wir es uns wirklich leisten, dass dieses Leitbild veraltet ist? Und: Wer trägt<br />
die Kosten dafür?<br />
27 Vgl. Klaus Zimmermann: Toscana. Das Hügelland und die historischen Stadtzentren 4 , Köln 1980, 284f.<br />
32
Prof. Dr. Friedrich Heckmann,<br />
Sozial- und <strong>Wirtschaft</strong>sethiker, Theologe und Philosoph<br />
Das Handelsblatt – einige von Ihnen werden es lesen und schätzen – bez. die Verlagsgruppe<br />
Handelsblatt GmbH gibt seit Jahren eine wunderbare Reihe von Büchern heraus, die Klassiker der<br />
Nationalökonomie. Dort finden Sie wichtige Schriften zur Entwicklung der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>swissenschaften von Aristoteles und seiner Politeia über Adam Smith28 (An Inquiry<br />
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776) und Thomas Robert Malthus29 (Essay<br />
on the Principle of Population) bis hin zu Friedrich August von Hayeks Preise und Produktion von<br />
1931. Sie finden jeweils das wieder abgedruckte Originalwerk eines Klassikers und zum anderen<br />
ein Kommentar, wie ich ihn hier zu einem nationalökonomischen Klassiker in der Hand halte.<br />
Erstaunlicherweise hat das Handelsblatt auch diesen Autoren hier, der vor wenigen Tagen 525 Jahre<br />
alt geworden ist, zu den Klassikern der <strong>Wirtschaft</strong>swissenschaften gezählt:<br />
Es ist Martin Luther!<br />
Der evangelische Reformator hat sich in vier berühmten Schriften und Predigten mit ökonomischen<br />
Fragen auseinandergesetzt. In dieser Schrift von 1524 mit „(Von) Kauffshandlung und Wucher“<br />
erklärte und beurteilte er ein zentrales Phänomen der Ökonomie: Den Wert und den Preis beim<br />
Tausch von Gütern, Geld und Dienstleistungen.<br />
Mit Martin Luther betrat nicht der erste <strong>Wirtschaft</strong>sethiker das Feld der <strong>Wirtschaft</strong>sgeschichte –<br />
denn diese Professionsbezeichnung gab es 1524 natürlich noch nicht – und mit Martin Luther betrat<br />
auch nicht der erste Theologe die wirtschaftsethische Bühne und es wird auch nicht der letzte sein,<br />
ich komme darauf zurück.<br />
Luther am Vorabend der Moderne zwischen Mittelalter, Scholastik und Renaissance machte sich<br />
nicht folgenlos Gedanken über die Beurteilung der Ökonomie.<br />
Nach ihm sind viele andere gekommen, die wirtschaftliche Fragen, Fragen der Ökonomie ethisch<br />
reflektieren, die beurteilen wollen, was richtig und was falsch ist - das ist nämlich die ethische<br />
Aufgabe - vor allem in unserer Zeit, einer Zeit, die uns mit einer Fülle von ökonomischen<br />
Problemen bedrängt: die leidige Finanzkrise, die immer kürzer folgenden Zyklen von Aufschwung<br />
und Rezession, sowie Globalisierung, Kurssteigerungen und Kursstürze an den Börsen,<br />
Arbeitslosigkeit, Fusionen und Entlassungen, Umweltprobleme...<br />
Mit Martin Luther habe ich einen wichtigen Strang wirtschaftsethischer Reflektion benannt.<br />
Religiöse, kirchliche und theologische Reflexion wirtschaftlicher Realität und gesellschaftlichen<br />
Umgangs mit der <strong>Wirtschaft</strong> bestimmt bis heute den wissenschaftlichen Diskurs und die öffentliche<br />
28 In seinem wohl berühmtesten Buch entwickelt Adam Smith das erste geschlossene System der Volkswirtschaftslehre.<br />
Auf Smith beziehen sich alle späteren Theoretiker, nehmen Bezug auf seine Thesen, dass es erstens im Menschen einen<br />
natürlich angelegten Ausgleich zwischen Egoismus und Nächstenliebe gibt und dass sich zweitens das <strong>Wirtschaft</strong>s- und<br />
Gesellschaftsleben ohne staatliche Eingriffe selbst reguliert.<br />
29 Wie Adam Smith sich als <strong>Wirtschaft</strong>spolitiker und David Ricardo sich als Wegbereiter des monetären Denkens<br />
ausgezeichnet haben, so liegt der herausragende Beitrag Malthus’ auf dem Gebiet der Sozialwissenschaft. Sein »Essay<br />
on the Principle of Population« entfachte das Interesse und entwickelte Methoden für sozialwissenschaftliche<br />
Untersuchungen. Seine These, die Menschheit verdoppele sich alle fünfundzwanzig Jahre und vermehre sich damit<br />
schneller als die Nahrungsmittel, die für ihre Existenz notwendig seien, war damals nicht zu widerlegen. Malthus war<br />
sich der Bedeutung der von ihm ausgesprochenen Gedanken bewußt - er war überzeugt, die Ursache menschlichen<br />
Elends gefunden zu haben. Seine Forderung, das Anwachsen der Bevölkerung durch Enthaltsamkeit zu stoppen,<br />
schaffte ihm erbitterte Gegner. Dennoch: Sein Buch »darf Anspruch erheben auf einen Platz unter jenen, die den<br />
Fortschritt des Denkens in hohem Maße beeinflußt haben«, schrieb John Maynard Keynes über Malthus’ »Essay«. Und<br />
weiter: »Der Essay ist nicht nur in der Methode apriorisch und philosophisch, sondern er ist im Stil kühn und<br />
rednerisch, mit viel Bravour in Sprache und Gefühl.«<br />
33
Diskussion mit. Die erste deutschsprachige <strong>Wirtschaft</strong>sethik hat der reformierte Zürcher<br />
Theologieprofessor Arthur Rich in den 80er Jahren vorgelegt, einen sozialethischer Ansatz als<br />
mittleren Weg zwischen den Interessen der Arbeitnehmer und rigiden unternehmerischen<br />
Shareholder- value - Standpunkt. Ein Ansatz, der damals in der Schweiz und in Süddeutschland auf<br />
großes Interesse der <strong>Wirtschaft</strong> stieß.<br />
Auch heute lassen sich die wirtschaftsethischen Ansätze noch grob so kategorisieren:<br />
evangelisch - katholisch - "weltlich"<br />
Mit Arthur Rich habe ich einen protestantischen Wissenschaftler benannt, auf katholischer Seite<br />
wäre vor allem der etwas ältere Jesuit Oswald von Nell-Breuning (1890-1991) zu nennen: Theologe<br />
und Sozialwissenschaftler, einer der Väter der katholischen Soziallehre.<br />
Relativ spät - eigentlich erst seit einigen Jahren - dafür aber mit einer fast unübersehbare Flut von<br />
Publikationen mischen die weltlichen Wissenschaften mit, die praktische Philosophie und die<br />
Politik- und Sozialwissenschaften, zu denen ich nach alter Lesart auch die<br />
<strong>Wirtschaft</strong>swissenschaften zähle! Manchmal ist die Flut der Publikationen etwas ärgerlich, weil viel<br />
Oberflächlichkeit im Spiel ist, auch viel Polemik, aber um es mit Peter Ulrich zu sagen, das weist<br />
wohl auch drauf hin, dass die Sache "brennt".<br />
Vor 15 Jahren, erst 1993 wurde das Deutsche Netzwerk <strong>Wirtschaft</strong>sethik (DNWE) wurde<br />
gegründet. Mitglieder sind Vertreter aus <strong>Wirtschaft</strong>, Politik, Kirchen und Wissenschaft, die an<br />
wirtschaftsethischen Fragen interessiert sind.<br />
Bevor ich jetzt weiter über das Phänomen <strong>Wirtschaft</strong>sethik rede, gebe ich Ihnen eine<br />
Arbeitsdefinition für diesen Abend, damit Sie wissen, was ich unter Ethik verstehe:<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik ist die wissenschaftliche Reflexion über ethische, moralische und sittliche Fragen<br />
in der <strong>Wirtschaft</strong>.<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik hat keine unmittelbaren Rezepte für konkrete Einzelfragen,<br />
sie gibt aber durchaus Entscheidungshilfen und zielt auf grundsätzliche Sensibilisierung.<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik zielt auf den vor – politischen und vor – rechtlichen Raum; hier beansprucht sie<br />
Normativität, will sie argumentativ festlegen, was gut und richtig ist!<br />
Ich komme zu meinem Überblick zurück, die gelernten oder selbst ernannten <strong>Wirtschaft</strong>sethiker,<br />
von denen ich in meiner Groborientierung gesprochen habe, teilen heute beileibe nicht mehr alle<br />
den Standpunkt Luthers Luthers Position war ja die, dass es für die <strong>Wirtschaft</strong> noch andere, d.h.<br />
nicht ökonomische Kriterien geben könne und müsse.<br />
Ethik und <strong>Wirtschaft</strong> – ein Gegensatz oder ein Widerspruch? – passen Ethik und <strong>Wirtschaft</strong><br />
zusammen – oder eher doch nicht?<br />
Eine wichtige Position ist diese: Ethische Kriterien für die <strong>Wirtschaft</strong> – nein danke! Ethik hat in der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> nichts zu suchen, wo kämen wir denn da hin. Das ist ein Standpunkt, den Sie sowohl bei<br />
Praktikern finden als auch bei Philosophen, selbst unter wirtschaftswissenschaftlich orientierten<br />
Theologen finden Sie diese Position. Der bekannteste ist neben den strengen Rationalisten unter den<br />
Ökonomen der bekannte Systemtheoretiker Niklas Luhmann.<br />
In den modernen differenzierten Gesellschaften hat das Teilsystem Moral faktisch keine<br />
integrierende Funktion. Erst recht kann das Teilsystem Ethik oder Moral andere gesellschaftliche<br />
Teilsysteme nicht bestimmen oder normieren, d.h. die Spielregeln bestimmen.<br />
Die Regelsysteme der Moral und der <strong>Wirtschaft</strong>, so Luhmann, sind voneinander unabhängig und<br />
folgten jeweils ihrer eigenen immanenten Logik. Wenn dagegen der Versuch unternommen werde,<br />
wirtschaftliche Effizienz an moralische Kriterien zu binden, komme es leicht zu einer Verletzung<br />
der Effizienzkriterien. <strong>Wirtschaft</strong>ssysteme folgten eben nicht moralischen, sondern ausschließlich<br />
34
Effektivitätsregeln. Luhmann behauptet eine Systemneutralität oder sogar Systemschädlichkeit von<br />
Moral gegenüber der <strong>Wirtschaft</strong>. Dieser sozialwissenschaftliche Ansatz trifft sich mit der Theorie<br />
einer eigenen Rationalität der Ökonomie: Die Ökonomie hat eine Rationalität, die nicht mit der<br />
allgemeinen Rationalität übereinstimmt, insofern kann man ihr mit klarer Vernunft oder gar mit<br />
ethischer Vernunft nicht in den Diskurs gehen.<br />
Meine Position dazu möchte ich so beschreiben: Weder stimmt dies empirisch, dass Moral und<br />
<strong>Wirtschaft</strong> voneinander unabhängige Regelsysteme sind, noch sollte es so sein. Empirisch sind<br />
wirtschaftliche Entscheidungen, bereits die Entscheidung für ein bestimmtes <strong>Wirtschaft</strong>ssystem<br />
unvermeidlich von bestimmten Wertannahmen geprägt, etwa dem dass Effizienz,<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sliberalität oder Prosperität primäre Handlungsziele und -werte sind. Selbst wenn aber<br />
<strong>Wirtschaft</strong> und Moral wirklich voneinander völlig abgetrennte Teilsysteme wären, wäre ein<br />
derartiger Zustand nicht wünschenswert, da jedes menschliche Handeln, auch das wirtschaftliche,<br />
an moralischen Kriterien zu messen ist, wenn man jedenfalls, wie offensichtlich auch Luhmann<br />
selbst, Moral grundsätzlich akzeptiert, etwa als System von "Achtung und Missachtung".<br />
<strong>Wirtschaft</strong> ist <strong>Wirtschaft</strong>, Moral ist Moral - Zufallsüberschneidungen<br />
sind nicht ausgeschlossen. Moral insgesamt erweist sich als naiv oder störend angesichts der<br />
marktwirtschaftlichen Effizienzregeln, das wäre eine etwas abgemilderte Position Die<br />
Konsequenzen bleiben dieselben<br />
Ethik und <strong>Wirtschaft</strong> - passt das zusammen - oder doch nicht ?<br />
Ein alte Streitfrage, die einen sagen wie Luhmann und neoliberale Ökonomen „nein“, die anderen<br />
sagen wie Luther „ja“, aber dieses „ja“ ist nicht so eindeutig wie am Vorabend der Moderne zu<br />
Luthers Zeiten, sondern ist heute so differenziert, dass die Vielzahl der Positionen einen<br />
schwindelig machen kann.<br />
Wenn aber, so setze ich einmal voraus, Geld wirklich die Welt regiert, ist es dann wünschenswert,<br />
dass wirtschaftliches Handeln ausgeschlossen ist, oder besser gesagt ausgenommen wird von der<br />
Diskussion, ob etwas richtig ist oder falsch, gut ist oder böse ist.<br />
Die ökonomische Theorie der Gegenwart neigt mehrheitlich einer Position zu, die sich so<br />
umschreiben lässt: <strong>Wirtschaft</strong>liches Handeln gehorcht den Kriterien der ökonomischen Vernunft<br />
und keinen ethischen.<br />
Eine durchaus strittige Frage ist das in der philosophischen und politikwissenschaftlichen<br />
Diskussion, die Frage also, ob sich <strong>Wirtschaft</strong>, wirtschaftliches Handeln, die Fragen der Produktion,<br />
des <strong>Wirtschaft</strong>ens, des Handelns und des Geldes ethisch beurteilen lassen.<br />
Pecunia non olet, - Hildesheimern kommt dieser lateinische Satz unangenehm bekannt vor - sagte<br />
Kaiser Vespasian im 1. Jahrhundert nach Christus: Vespasian bekannt für seine rigorose Spar- und<br />
Steuerpolitik, besteuerte die öffentlichen Klos in Rom. Geld stinkt nicht, Geld ist neutral, es ist egal,<br />
woher es kommt, ob aus den römischen Toiletten, oder der modernen Variante Mc Clean, ob es um<br />
Sponsoring im sozialen Bereich durch suspekte Geldgeber geht oder um Finanzierung<br />
wissenschaftlicher Publikationen aus Glücksspielgewinnen und Mitteln aus dem Lotto. Auch Aktien<br />
von MacDonalds und Coca Cola sind anscheinend wertneutral. Der Kollege Hans Küng hat sein<br />
weltweites ambitioniertes Programm für den Weltfrieden aus Coca Cola – Gewinnen finanzieren<br />
lassen, das Weltethos – Projekt.<br />
Dagegen hält Thomas von Aquin, der vielleicht einflussreichste Philosoph und Theologe der<br />
westlichen Christenheit: Nummus non parit nummos, - Geld darf nicht Geld gebären. Und daran hat<br />
sich die Christenheit auch lange gehalten:<br />
Zinsverbot, welch eine Wohltat wäre dies für alle Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen -<br />
35
welch eine Horrorvision für die Banken weltweit - mit Ausnahme der streng islamischen<br />
Geldinstitute. Bankleute, die Zins nehmen, sind Diebe am Eigentum Gottes, Zeitdiebe, sie<br />
verdienen ihr Geld nicht selber im Schweiße ihres Angesichts, ja sie verdienen sogar am Sonntag,<br />
am Feiertag, denn ihr Zinsvertrag trägt ja auch sonntags Früchte, Geld arbeitet am Feiertag, das<br />
wendet sich gegen die Zinsnehmer. Und diese heißen noch bei Martin Luther „Wucherer“, er hatte<br />
seinen Kirchenvater Thomas gut studiert.<br />
Wider die Wucherer zog er kräftig vom Leder in seinen wirtschaftsethischen Schriften „Eyn Sermon<br />
von dem Wucher“ (1522),<br />
„Von Kauffshandlung und Wucher“ (1524),<br />
„Vom Zinsgroschen“ (1535) und kurz vor seinem Tode noch<br />
„An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen, Vermanung“ .<br />
Nun, Luther ist aber gleichzeitig mit für das verantwortlich, was wir heute die Moderne nennen.<br />
Ohne Luther hätte das Mittelalter nicht überwunden werden können Er stellt die Weichen in unsere<br />
Zeit. Und die Moderne brachte uns ein nie gekanntes <strong>Wirtschaft</strong>sleben - weltweit - global -<br />
allumfassend.<br />
Mit der Moderne und der Demokratisierung des Lebens blieben auch immer mehr die<br />
Folterinstrumente der Kirche im Keller, die physischen und die psychischen. Mit dem Fegefeuer<br />
hatte man Jahrhunderte lang die Zinsnehmer und Wucherer in Schach gehalten - Zinsnahme war<br />
Todsünde, nicht erst seit Thomas, aber seit ihm und durch ihn philosophisch über Aristoteles und<br />
theologisch über die Tradition des biblischen Zinsverbotes abgesichert. Nun haben die Menschen ja<br />
immer schon Zinsen von ihren Mitmenschen genommen, um zu mehr Geld zu kommen, auch wenn<br />
es Todsünde war, im Christentum wie im Islam. Die traditionelle katholische Theologie hatte einen<br />
kleinen Ausweg offen gelassen, eben das Fegefeuer, Bankiers und andere Wucherer blieben nicht<br />
auf Dauer sanktioniert, sie mussten halt einige Jahrhunderte ins Feuer, aber was tut man nicht alles<br />
für Macht und Reichtum hier und jetzt.<br />
Zudem gab es ein weiteres kleines Schlupfloch, das in die soziale und kirchliche Richtung weist.<br />
Früher hieß man das die mildtätigen Werke. Und die konnten die Dauer des Fegefeuers spürbar<br />
abkürzen. Viele Werke der Barmherzigkeit sind der früheren Hartherzigkeit und der späteren Milde<br />
alternder Bankiers und Kaufleute geschuldet, dieses bekannte Hospital, jenes Altenheim.<br />
Eine der fortschrittlichsten und imposantesten Sozialeinrichtungen des Spät - Mittelalters, noch<br />
heute existent, steht in Augsburg: die Fuggerei, gestiftet von den Bankiers der Kaiser und Päpste,<br />
der Könige und Bischöfe, der Familie Fugger. Zeichen des Glaubens?<br />
Zumindest Ausdruck dessen, dass man Geld nicht mit ins Grab nehmen kann und dass dies vielen,<br />
häufig leider erst zu spät, im Alter bewusst wird. Auch heute ist das noch ein Phänomen, vor allem<br />
in den USA, dem Land der Stiftungen und Fonds. Ein frommer calvinistischer Millionär stirbt dort<br />
auch heute nicht als Millionär. Er hat sein Geld gestiftet. Wir nennen es Sponsoring und<br />
Foundraising, wenn Alte von Sozialen Einrichtung hinsichtlich der Verwendung ihres Erbes<br />
umworben werden... .<br />
Das Zinsverbot ist gefallen, Auswüchse der Zinsnahme juristisch eingeschränkt, aber eben nur<br />
dieses. Wer auch nur einen Tag in einer Schuldnerberatung einer deutschen Großstadt verbringt,<br />
kommt ins Grübeln, ob nicht der Weg des Verbotes in Islam und Christentum doch etwas für sich<br />
hat.<br />
Aber die Linie des Vespasian hat sich durchgesetzt: Geld stinkt nicht.<br />
Das hat Auswirkungen auf den Geruch des Geldes. Es wird so hoch geschätzt, dass wir alle eher<br />
geneigt sind, Veilchen oder Rosen zu riechen, wenn wir zu Geld kommen, als uns Gedanken zu<br />
machen, was das für Geld ist.<br />
Lohn für ehrliche Arbeit oder Teilhabe an ungerechtem <strong>Wirtschaft</strong>shandeln?<br />
Notwendiges Lebensmittel oder Ergebnis von Ausbeutung anderer?<br />
36
Und kein Banker denkt mehr ans Fegefeuer.<br />
Aber damit wir sind mitten drin in der ethischen Diskussion.<br />
Wir fragen nach der ethischen Qualität des Bankwesens, in diesen Tagen aktueller denn je.<br />
Wir fragen, ob es richtig ist, ja auch danach, ob es gut ist, dass sich die Weltwirtschaft in dieser<br />
Weise entwickelt, die wir mit dem Schlagwort der Globalisierung versehen haben.<br />
Wir fragen danach, ob das Verhältnis gut ist zwischen den Ländern des Südens, die überwiegend die<br />
Rohstoffe dieser Welt besitzen und den Ländern des Nordens mit ihren transnationalen<br />
Unternehmen.<br />
Wir fragen danach, ob das Handeln jenes niedersächsischen Monopolisten und europäischen<br />
Marktführers (VW) den Menschen in Hannover und der Region wirklich hilft und nützt oder eher<br />
doch nicht? Wir fragen aber zunehmend auch nach den Machtstrukturen und Marktverhalten der<br />
sozialen Organisationen und Unternehmungen, ist das wirtschaftlich noch vertretbar und ethisch<br />
legitim? Wir fragen nach der Rangfolge zwischen Ökologie und Ökonomie.<br />
Und letztlich können wir, wenn wir vor uns glaubwürdig bleiben wollen, das ist eine moralische,<br />
wohl auch ethische Kategorie, wenn wir also weiterhin uns selbst glauben wollen, dann können wir<br />
nicht vor uns Halt machen.<br />
Wir fragen also nach uns als wirtschaftlichen Subjekten, als Unternehmer, aber auch als<br />
Verbraucher, als Kunden, als Kleinaktionäre und als politisch und sozial Handelnde - und das auf<br />
der privaten Ebene und auf der professionellen Ebene im Hinblick.<br />
Und damit bin ich bei zwei weiteren Groborientierungen dessen, was wir <strong>Wirtschaft</strong>sethik nennen:<br />
a) Individualethik – Sozialethik, den ethischen Fragen für den Einzelnen und den Fragen, die das<br />
Gemeinsame, eben das Soziale betreffen. Zu letzterem gehören auch die strukturellen und<br />
institutionellen Fragen.<br />
b) Die drei Ebenen wirtschaftlichen Handelns und ethischer Reflexion:<br />
Mikroebene - Mesoebene - Makroebene<br />
Vor 220 Jahren veröffentlichte Adams Smith das Grundlagenwerk der modernen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>swissenschaften „Der Wohlstand der Nationen!“ Oder genauer übersetzt: „Eine<br />
Untersuchung über die Natur und die Ursache des Wohlstandes der Nationen“.<br />
Wenn irgendwo in Deutschland oder in anderen westlichen Ländern darüber gestritten wird, was<br />
denn die richtige <strong>Wirtschaft</strong>spolitik sei, wird dieser Herr Smith angerufen als die Autorität dessen,<br />
was wir den freien Markt zu nennen gelernt haben, sozusagen als den ersten Kronzeugen und<br />
Heiligen der reinen <strong>Wirtschaft</strong>slehre. Da ich mich, wenn auch nur als protestantischer Theologe mit<br />
Heiligen und Scheinheiligen einigermaßen auskenne, will ich Ihnen ein paar Grundzüge seiner<br />
Lehre, um deren reine und pure Auslegung und Interpretation immer wieder gestritten wird,<br />
vorstellen.<br />
1.<br />
Staatseingriffe und künstliche Produktionsbeschränkunken sind abzulehnen, Zollbarrieren und<br />
künstliche Privilegierungen sind also schädlich, nicht förderlich.<br />
2.<br />
Wohlstand des Volkes entsteht durch „Erwerbsfleiß“ und „Sparsamkeit“.<br />
3.<br />
Gibt es in einer freien <strong>Wirtschaft</strong> das freie Spiel der <strong>Wirtschaft</strong>skräfte werden Menschen, Männer<br />
und Frauen des Volkes durch das eigene Interesse motiviert, unter den Bedingungen des freien<br />
37
Wettbewerbes genau dieses lernen.<br />
4.<br />
Die Bedürfnisse der Menschen sind in etwa gleich, da ihre natürlichen Anlagen gleich sind. Dies<br />
führt zu einem Gleichgewicht in der Verteilung der vorhandenen Güter.<br />
5.<br />
Das freie Wechselspiel von Angebot und Nachfrage erzwingt eine Preisgestaltung, die sich an den<br />
wirklichen Kosten, also an den Produktionskosten orientiert. Der Verbraucher profitiert also von<br />
einem freien Markt.<br />
Die Konsequenz aus diesen wenigen Grundannahmen ist nach Adam Smith und seiner Nachfolgern<br />
bis heute, dass der freie Markt die <strong>Wirtschaft</strong> reguliert, selbsttätig und ohne anderen Antrieb, das<br />
passiert alles von allein - wie durch eine „unsichtbare Hand“. Das ist die berühmte invisible hand<br />
des Adam Smith.<br />
Sein bekanntester Nachfolger ist Friedrich v. Hayek, der Begründer der Chikago School:<br />
Wettbewerb, so die reine Lehre heute, bewirke materiell die höchste Leistung und das kommt auch<br />
der Allgemeinheit zugute. Für das Gemeinwohl ist nicht nur gesorgt, sondern es wird der<br />
größtmögliche Effekt erzielt (Milton Friedman), mehr als der Wohlfahrtsstaat erreichen kann.<br />
Das individuelle Eigeninteresse ist etwas, was feststeht, es bedarf keiner Begründung auch keiner<br />
ethischen Legitimation (ethisches a priori), ex post wird alles legitimiert, weil der Erfolg, das<br />
wirtschaftliche Wachstum diese Legitimation liefert. Das Denken und Handeln spielt sich quasi in<br />
einem geschlossenen System ab: The business of business is business.<br />
Soziale Gesichtspunkte, ethische Kriterien gibt es nicht! Es geht um marktliche Selbstbehauptung,<br />
Nutzenstreben allein aus Eigeninteresse und Gewinnmaximierung.<br />
Lediglich die Kundschaft, die ja auch von Eigeninteresse geleitet wird (wirklich allein aus<br />
Eigeninteresse?) oder die öffentliche Meinung können sozialen und ethischen Kriterien bei der<br />
Kaufentscheidung Rechnung tragen und beeinflussen natürlich so die Bedingungen wirtschaftlicher<br />
Kalkulation.<br />
Mehr wird Moral und Ethik nicht zugestanden in der Art von Ökonomie, die zu Liberalisierung,<br />
Privatisierung, Deregulierung der letzten zwei Jahrzehnte beigetragen hat, zu der Krise der<br />
Finanzmärkte und zu einer Verantwortungslosigkeit der wirtschaftlichen Subjekte, die ohne Beispiel<br />
in der <strong>Wirtschaft</strong>sgeschichte ist, mit immer nur einem Ziel, den international akzeptablen Renditen<br />
für die Shareholder in Höhe von 15 Prozent bis zu den 25 Prozent, von denen der Deutsche-Bank-<br />
Chef Ackermann noch vor kurzem geredet hat.<br />
Aber im Unterschied zu seinen Nachfolgern in der gegenwärtigen Ökonomie hatte die<br />
<strong>Wirtschaft</strong>slehre des Adam Smith noch ein Ziel!<br />
Das Ziel der <strong>Wirtschaft</strong> ist der Mensch. Smith blendet die Frage, wozu wir wirtschaften, welchen<br />
Sinn das macht, er fragt, wem das alles nützen soll. Cui bonum? – Wem kommt das zugute? Und<br />
seine Antwort, es dient dem Menschen. Der Mensch ist Ziel und Zweck der <strong>Wirtschaft</strong>. Wie das<br />
auszuführen ist, bleibt Aufgabe der Ethik im Gespräch mit der Anthropologie.<br />
Einer der <strong>Wirtschaft</strong>sethiker, der in diese Richtung forscht, denkt und lehrt, ist Peter Ulrich, der St<br />
Gallener Ökonom und Philosoph. Sein Ziel ist der freie und liberale <strong>Wirtschaft</strong>sbürger, der nicht nur<br />
Ziel, sondern auch handelndes Subjekt von <strong>Wirtschaft</strong> ist. Die Gemeinschaft der <strong>Wirtschaft</strong>sbürger,<br />
als wir alle als Stakeholder mit - diskutieren und bestimmen über das, was Ziel einer „guten“<br />
<strong>Wirtschaft</strong> ist, bestimmt das Ziel und die Art und Weise guten <strong>Wirtschaft</strong>ens. Argumente geben den<br />
Ausschlag über die Richtung, nicht die Macht der Global Player oder die Akkumulation immer<br />
größerer Kapitalmengen in den Händen weniger. Im Diskurs zeigt sich, was die richtige Art des<br />
<strong>Wirtschaft</strong>ens ist, das gute <strong>Wirtschaft</strong>en. Wenn der Satz des Vespasian, das Geld nicht stinkt, meint,<br />
38
das Geld wertfrei ist, dann hat er nur zum Teil Recht. Der ethische Verstand muss darauf bestehen,<br />
dass Geld, seine Herkunft und seine Verwendung, den Kriterien des Gerechten und zwar des<br />
Sachgerechten und des Menschengerechten, unterworfen sein muss. Peter Ulrich hat in Anlehnung<br />
an Artur Rich den Begriff der lebensdienliche Marktwirtschaft eingeführt, für die politische<br />
Ordnungsaufgaben konstitutiv sind. Damit sind fortwährender Liberalisierung, Privatisierung und<br />
Deregulierung Grenzen gesetzt. Ein „Primat der Politik vor der Logik auch des globalen Marktes“<br />
hält Ulrich für unverzichtbar. 30 Nur so lässt sich die Vision einer auf anderen Werten als<br />
Wettbewerb und Gewinnmaximierung basierten <strong>Wirtschaft</strong>spolitik entwickeln.<br />
Deren „Prinzip nicht die bedingungslose globale Marktöffnung“, „sondern die<br />
Differenzierung verschiedener <strong>Wirtschaft</strong>ssektoren, die je nach den für sie vorrangigen<br />
vitalpolitischen (kulturellen, sozialen, ökologische und volkswirtschaftlichen) Gesichtspunkten<br />
vorzugsweise auf regionaler, staatlicher, oder globaler würden“. 31<br />
Aus ethischer Sicht geht es Peter Ulrich und seiner Schule darum, die ökonomische Rationalität in<br />
eine weitere, eine umfassende ethische Vernunft einzubeziehen.<br />
Die integrativen <strong>Wirtschaft</strong>sethik Peter Ulrichs scheint mir ein tauglicher Versuch in unserer Zeit,<br />
den Mensch und die Menschheit wieder in den Mittelpunkt der <strong>Wirtschaft</strong> zu rücken. Doch hier<br />
will ich abbrechen, denn das wäre eine weitere Diskussion – vielleicht auch in diesem Kreis!<br />
Vielen Dank!<br />
30 Peter Ulrich, Integrative <strong>Wirtschaft</strong>sethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, Bern 1997, 387.<br />
31 A.a.O. 389<br />
39
<strong>Günter</strong> <strong>Buchholz</strong><br />
03.02.2009<br />
FH meets economy<br />
an der Fakultät IV der Fachhochschule Hannover<br />
18. November 2008<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sethik heute –<br />
ein Nachwort<br />
Die Ablösung von Helmut Schmidt und die Wahl von Helmut Kohl durch das von Hans Tietmeyer<br />
(CDU, ehemaliger <strong>Abteilung</strong>sleiter im Bundesministerium für <strong>Wirtschaft</strong>, späterer Bundesbank-<br />
Präsident) konzeptionell und Otto Graf Lambsdorff und Genscher (FDP) politisch vorbereitete<br />
konstruktive Misstrauensvotum im Deutschen Bundestag veranlasste seinerzeit den neu gewählten<br />
Bundeskanzler Kohl seltsamerweise zu der Forderung nach einer „geistig-moralischen Wende“.<br />
Als beobachtender Staatsbürger musste man sich damals fragen, wie das denn wohl gemeint<br />
gewesen sein mochte. Denn Helmut Schmidt war ziemlich unstrittig als fachlich hoch qualifizierter,<br />
politisch kluger und moralisch integrer Staatsmann allgemein und zu Recht hoch angesehen, so<br />
dass er 2009, im Jahr seines 90. Geburtstages, zu einem Vorbild erhoben worden ist: im Blick auf<br />
60 Jahre Bundesrepublik erscheint er nicht als einer in einer Reihe, sondern fachlich, politisch und<br />
moralisch mustergültig als DER BUNDESKANZLER schlechthin.<br />
Die von Helmut Kohl geforderte Wende hat es in der Folge in der Tat gegeben, in aller Stille. Aber<br />
es war eben keine Wende zu Besseren. Das damalige Tietmeyer-Papier war - wie sich im<br />
historischen Rückblick erwiesen hat - die politische Agenda der einsetzenden neoliberalen<br />
Gegenreform (Deregulierung, Privatisierung, Abbau des Sozialstaats und öffentlicher<br />
Dienstleistungen, also Übergang zur Marktgesellschaft mit der Konsequenz der <strong>Wirtschaft</strong>skrise<br />
von 2008 ff.). Und die Wahl von Kohl öffnete anscheinend auch das Tor zu einer wohl doch neuen<br />
Qualität der politischen Korruption, oft in Form von Lobbyismus, oft auch in Form privater<br />
Anschlusskarrieren für Politiker.<br />
Das Feld der Beschaffungskorruption (Öffentliche Bauaufträge, insbesondere auf kommunaler<br />
Ebene, Beschaffung von Rüstungsgütern durch den Bund) hat es bereits in den ersten Jahrzehnten<br />
der BRD gegeben. In den 80er Jahren lag allem Anschein nach der Schwerpunkt dann auf dem<br />
Mediensektor, d. h. vor allem auf der Durchsetzung privater Fernsehprogrammangebote:<br />
überakkumuliertes Kapital suchte neue Anlagefelder; hier zu Lasten der öffentlich-rechtlichen<br />
Sender. Nach den Ereignissen des Jahres 1989 kam dann als nach wie vor großes Dunkelfeld die<br />
Abwicklung der DDR-<strong>Wirtschaft</strong> hinzu, und seither geht es im Namen des Wettbewerbs um die<br />
großen Privatisierungen (Post, Telekom, Bahn), also um die Beseitigung der öffentlichen Monopole<br />
und gleichzeitig um den Aufbau privater Monopole (z.B. im Bereich der Energiewirtschaft) – was<br />
von den Interessenten als angeblich wettbewerbspolitisch unbedenklich erklärt wird. Kein Wunder,<br />
denn kann es für einen Betriebswirt und für einen privaten Eigentümer oder seine Manager etwas<br />
Erstrebenswerteres geben als ein mächtiges privates Monopol?<br />
Alle Prozesse neoliberaler Gegenreform werden offenbar mehr oder weniger ausgeprägt von<br />
Prozessen politischer Korruption - im weiten Sinne - begleitet. Der systemische Charakter des<br />
Vorgangs besteht darin, dass die Politik insgesamt den mehr oder weniger einheitlichen privaten<br />
Interessen, wie sie von <strong>Wirtschaft</strong>sverbänden oder Unternehmens-Stiftungen formuliert wurden,<br />
untergeordnet worden ist; für die so genannten „etablierten Parteien“ gilt das jedenfalls sehr<br />
weitgehend. Die Politik wird damit faktisch aber illegitimerweise nicht mehr demokratisch<br />
bestimmt, sondern von privat-partikulären Interessen geleitet. Darin besteht die „Krise der<br />
40
Repräsentation“, und darin liegt auch die Ursache für die politische Korruption: sie ist das<br />
Instrument einer privilegierten einflussreichen Minderheit für die Durchsetzung ihrer Interessen<br />
gegen jene der Mehrheit unter den rechtlichen Bedingungen einer formalen Demokratie. Diesem<br />
Problem ist aber mit <strong>Wirtschaft</strong>s- oder Unternehmensethik prinzipiell nicht beizukommen.<br />
Dennoch soll hier abschließend auf eine lesenswerte und erhellende Veröffentlichung zum Thema<br />
Unternehmensethik hingewiesen werden:<br />
Prof. Dr. Georg Schreyögg<br />
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisation und Führung,<br />
„Unternehmensethik zwischen guten Taten und Korruption -<br />
Perspektiven für die Betriebswirtschaftslehre“<br />
in: zfbf Sonderheft 58/08, S. 116 - 135<br />
41