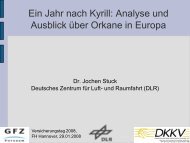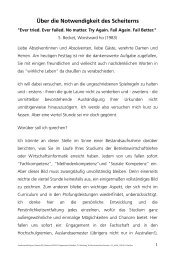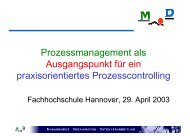Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6. Die ethische Problematik der Shareholder-Value-Orientierung in der <strong>Wirtschaft</strong><br />
Ich werde - auch um des besseren Verständnisses willen - zunächst eine kurze analytische Skizze<br />
vortragen, um mich dann den ethischen Fragen zuzuwenden.<br />
Der Gegenbegriff zum Shareholder-Value-Konzept ist die sogenannte Stakeholder-Orientierung.<br />
Diese impliziert ein bestimmtes Grundverständnis der privaten Unternehmung, das dahin geht, daß<br />
diese Institution mehr ist als eine Privatangelegenheit der Eigentümer. Es wird gesehen und darauf<br />
aufmerksam gemacht, daß es auch andere relevante Anpruchsgruppen an die private Unternehmung<br />
gibt. Hier zählen vorrangig die Beschäftigten, aber auch die Kunden, die Lieferanten, die<br />
Kreditgeber und der Staat, nämlich in seinen Rollen als Gewährleister der Infrastruktur, als<br />
Subventionszahler und als Steuereinnehmer. Alle diese Gruppen haben bestimmte legitime<br />
Erwartungen an die private Unternehmung, und diese Legitimität entsteht durch die fortwährende<br />
Interaktion und Wechselwirkung der privaten Unternehmung mit ihrer sozioökonomischen Umwelt.<br />
Sie wird dadurch zwar nicht formal und nicht explizit, wohl aber material und implizit als eine<br />
gesellschaftliche Institution in privater Form begriffen. Ihr privater Charakter wird dadurch deutlich<br />
relativiert.<br />
Das Shareholder-Value-Konzept rückt demgegenüber erstens das monetäre Einkommensinteresse<br />
der Eigentümer an die oberste Stelle der Zielhierarchie, und es bindet zweitens das Einkommens-<br />
Interesse der leitenden Manager durch den teilweisen Entgelt mit stock options eng an den<br />
Börsenkurs des Unternehmens und damit an die monetären Interessen der Eigentümer, d. h. der<br />
shareholder.<br />
Damit wird das Management dem Diktat der Quartalszahlen und der Finanzanalysten unterworfen,<br />
und der Zeit- und Denkhorizont der geschäftlichen Planung verkürzt sich entsprechend. Zugleich<br />
wird damit die reale Ökonomie der monetären Ökonomie untergeordnet. Die Börsen werden zu<br />
Leitinstitutionen der Gesamtwirtschaft. Der güterwirtschaftliche Kapitalismus wandelt sich zum<br />
Finanzmarkt-Kapitalismus, dessen Krise mit dem Schwarzen Montag, dem 15.09.2008, manifest<br />
geworden ist.<br />
Zugleich werden jene gesellschaftlichen Kompromisse brüchig und aufgekündigt, die der<br />
Stakeholder-Orientierung entsprachen. Die gesellschaftlichen Strukturen geraten politisch und<br />
ökonomisch vermittelt in Bewegung. Es kommt zum steilen gesellschaftlichen Aufstieg kleinerer<br />
Gruppen und zugleich zum sozialen Abstieg breiter Schichten. Auch die Stabilität der<br />
Mittelschichten erweist sich auf die Dauer als gefährdet. Sie werden aufgespalten in einen Teil, der<br />
die Prekarisierung fürchten muß, und in einen anderen Teil, der seine soziale Position noch<br />
bewahren kann.<br />
Wenn diese skizzenhafte Charakterisierung annähernd zutreffend sein sollte, wie wäre diese<br />
Entwicklung und der heutige gesellschaftliche Zustand dann aus ethischer Sicht zu beurteilen?<br />
Mir scheint hier eine Frage im Zentrum zu stehen, nämlich ob ein solcher gesellschaftlicher Zustand<br />
rational und objektivierend als gerecht oder als ungerecht begründet werden kann. Die bloß<br />
subjektive Empfindung von Ungerechtigkeit, wie sie das Alltagsbewußtsein bestimmt, sie bleibt<br />
m. E. unzureichend. Zwar weiß ich nicht, ob das so gestellte Problem überhaupt lösbar ist, aber wir<br />
müßten uns, wenn wir uns denn darauf einließen, Gedanken darüber machen, wie der Begriff der<br />
Gerechtigkeit als orientierende Norm und als Maßstab bestimmt werden könnte. Damit kehren wir<br />
allerdings zwangsläufig zurück zu den großen, miteinander im Konflikt liegenden Gesellschaftstheorien,<br />
die uns zu unterschiedlichen und zum Teil gegensätzlichen Deutungen und Erklärungen<br />
führen. Und wir kehren zurück zu den interdependenten Werten der Französischen Revolution:<br />
liberté, egalité, fraternité oder, sinngemäß: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit<br />
10