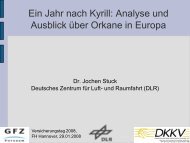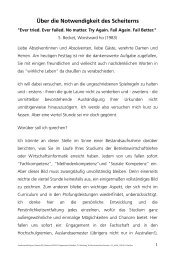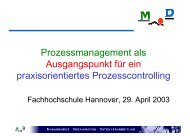Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gebrochen. 5 Mit grundsätzlichen Beibehaltung des von Adam Smith in seiner Schrift: „Der<br />
Reichtum der Nationen“ begrün-deten Annahme 6 hat der Kollege <strong>Buchholz</strong> durchaus im Konsens<br />
mit der ökonomischen Theorie – wo er ein ethisches Türchen geöffnet hat – ein entscheidendes<br />
Türchen wieder zu gemacht. Denn genau hier besteht bis jetzt die „Krux“ im Dialogfeld von Ethik<br />
und Ökonomie. Aus ökonomischer Perspektive wird sehr wohl die Notwendigkeit ethischer<br />
Überlegungen gesehen, aber Ethik wird nicht in genügender Form in das Theoriekonzept von<br />
Ökonomie „integrativ“ eingebunden, sondern fast ausschließlich aus den Erfordernissen der Praxis<br />
bei gleichzeitiger Geltung gängiger Theoreme begründet. 7 So schreibt der Kollege <strong>Buchholz</strong>: „In<br />
der <strong>Wirtschaft</strong>sethik werden ethische Überlegungen auf das Praxisfeld Wirt-schaft angewandt.“<br />
Ethik wird damit zu einem „Adiaphoron“ ökonomischer Prozesse und geriert zur blanken<br />
„Legitimationsethik“ bestehender Theorieannahmen bzw. des praktischen unternehmerischen<br />
Handelns. Aus der Sicht der protestantischen Sozialethik ist das zu wenig und muss sich die Ethik<br />
als Wissenschaft „missbraucht“ vorkommen. Damit bleibt der Kol-lege dem Modell der Dominanz<br />
der Ökonomie gegenüber der Ethik verhaftet. Bislang hat einzig Peter Ulrich mit dem St. Gallener<br />
Konzept den Versuch einer „integrativen Wirt-schaftsethik“ unternommen, der Ethik und wirtschaft<br />
gleichrangig einander zuordnet. 8<br />
Demnach ist Unternehmensethik weit mehr als ein praktisch von außen zu implementierendes<br />
Konzept, sondern vielmehr ein in der Ökonomie selbst zu verankerndes theoretisches Postulat. Für<br />
den Ökonomen Peter Ulrich ist der Wert der „Kritik“ bzw. der Ideologiekritik ein wichtiges Feld in<br />
der Argumentation, die er „Ökonomismuskritik“ nennt. Er will den Schein der ökonomischen<br />
„Wertfreiheit“ und der ethischen Neutralität der ökonomischen Sachlogik durchschauen. 9 Aus<br />
dieser Perspektive ist es das Verdienst von Ulrich, als erster Ökonom den „Mythos des Marktes“<br />
beschrieben zu haben. Das wirtschaftliche Handeln muss hierbei wieder mehr an den<br />
gesellschaftlichen Kontext herangerückt werden.<br />
Lese ich die Überlegungen des Kollegen <strong>Buchholz</strong>, so begegnet mir bei ihm trotz des für ihn<br />
maßgeblich im Hintergrund nach wie vor gültigen Rationalitätstheorems, wie es klassisch die<br />
Ökonomie formuliert, in Ansätzen ein ähnlicher gedanklicher Zusammenhang wie bei Peter Ulrich.<br />
Grundsätzlich besteht demnach Übereinstimmung zwischen uns, dass die Grundlage aller<br />
ökonomischen Prozesse handelnde Subjekte sind, die wie der Kollege schreibt – in<br />
Handlungsautonomie – agieren wollen. Damit haben wir aber eine gemeinsame Basis zwischen<br />
Ökonomie und Theologie, nämlich vor dem Hintergrund von Handlungs- oder Systemtheorie geht<br />
es „subjektorientiert“ um die Prinzipien ökonomischen Handelns von Individuen. 10 Anders<br />
formuliert: Der ökonomisch handelnde Mensch und der ethisch handelnde Mensch sind ein und<br />
dieselbe Person!<br />
Räumt man nämlich den Mythos von der Zweckrationalität des „homo oeconomicus“ einmal<br />
beiseite und legt ihn vorläufig in die Mottenkiste wissenschaftlicher Theorien, kommt die<br />
Anthropologie als gemeinsame Grundlage von Ökonomie, Ethik und Theologie zu Tage. Der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sjournalist Uwe Jean Heuser räumt in seinem jüngsten Buch „Humanomics. Über die<br />
Entdeckung des Menschen in der <strong>Wirtschaft</strong>“ dem anthropologischen Faktor eine enorme Rolle<br />
zu. 11 Für ihn ist es eben nicht das Prinzip optimierender Handlungen, sondern das reziproke<br />
5 Darauf weist schon sehr grundlegend hin Martin Büscher (Hg.), Markt als Schicksal? Zur Kritik und Überwindung<br />
neoliberaler <strong>Wirtschaft</strong>s- und Gesellschaftspolitik, Bochum 1998. Es ist doch für den wissen-schaftlich-theoretischen<br />
Zustand der <strong>Wirtschaft</strong>swissenschaften äußerst tiefblickend, dass die Lehrbuch-Ökonomie so Ideologie-resistent<br />
gegenüber neueren kritischen Ansätzen ist.<br />
6 Zur <strong>Wirtschaft</strong>sgeschichte siehe etwa Peter Jay, Das Streben nach Wohlstand. Die <strong>Wirtschaft</strong>sgeschichte des<br />
Menschen, Düsseldorf 2006.<br />
7 Darin liegt etwa auch die Schwierigkeit im Lehrbuch Elisabeth Göbel, Unternehmensethik. Grundlagen und<br />
praktische Umsetzung, Stuttgart 2006.<br />
8 Peter Ulrich, Integrative <strong>Wirtschaft</strong>sethik. Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, Berlin/ Stuttgart/ Wien, 4.<br />
Auflage, 2008.<br />
9 Ebd., 125.<br />
10 Vgl. etwa Johannes Eurich/ Alexander Brink, Zur Rolle der Moral im ökonomischen Modell des Homo oeconomicus,<br />
in: Heinz Schmidt (Hg.), Ökonomie und Religion. Fatal Attraction – Fortunate Correction, Heidelberg 2006, 95-128.<br />
11 Vgl. Uwe-Jean Heuser, Humanomics. Die Entdeckung des Menschen in der <strong>Wirtschaft</strong>, Campus 2008.<br />
14