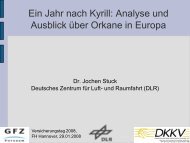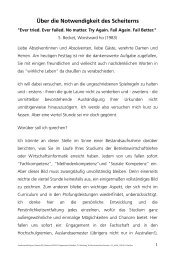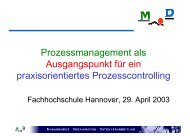Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Arbeitspapier / Abteilung Wirtschaft Günter Buchholz, Ralf Hoburg ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wettbewerbes genau dieses lernen.<br />
4.<br />
Die Bedürfnisse der Menschen sind in etwa gleich, da ihre natürlichen Anlagen gleich sind. Dies<br />
führt zu einem Gleichgewicht in der Verteilung der vorhandenen Güter.<br />
5.<br />
Das freie Wechselspiel von Angebot und Nachfrage erzwingt eine Preisgestaltung, die sich an den<br />
wirklichen Kosten, also an den Produktionskosten orientiert. Der Verbraucher profitiert also von<br />
einem freien Markt.<br />
Die Konsequenz aus diesen wenigen Grundannahmen ist nach Adam Smith und seiner Nachfolgern<br />
bis heute, dass der freie Markt die <strong>Wirtschaft</strong> reguliert, selbsttätig und ohne anderen Antrieb, das<br />
passiert alles von allein - wie durch eine „unsichtbare Hand“. Das ist die berühmte invisible hand<br />
des Adam Smith.<br />
Sein bekanntester Nachfolger ist Friedrich v. Hayek, der Begründer der Chikago School:<br />
Wettbewerb, so die reine Lehre heute, bewirke materiell die höchste Leistung und das kommt auch<br />
der Allgemeinheit zugute. Für das Gemeinwohl ist nicht nur gesorgt, sondern es wird der<br />
größtmögliche Effekt erzielt (Milton Friedman), mehr als der Wohlfahrtsstaat erreichen kann.<br />
Das individuelle Eigeninteresse ist etwas, was feststeht, es bedarf keiner Begründung auch keiner<br />
ethischen Legitimation (ethisches a priori), ex post wird alles legitimiert, weil der Erfolg, das<br />
wirtschaftliche Wachstum diese Legitimation liefert. Das Denken und Handeln spielt sich quasi in<br />
einem geschlossenen System ab: The business of business is business.<br />
Soziale Gesichtspunkte, ethische Kriterien gibt es nicht! Es geht um marktliche Selbstbehauptung,<br />
Nutzenstreben allein aus Eigeninteresse und Gewinnmaximierung.<br />
Lediglich die Kundschaft, die ja auch von Eigeninteresse geleitet wird (wirklich allein aus<br />
Eigeninteresse?) oder die öffentliche Meinung können sozialen und ethischen Kriterien bei der<br />
Kaufentscheidung Rechnung tragen und beeinflussen natürlich so die Bedingungen wirtschaftlicher<br />
Kalkulation.<br />
Mehr wird Moral und Ethik nicht zugestanden in der Art von Ökonomie, die zu Liberalisierung,<br />
Privatisierung, Deregulierung der letzten zwei Jahrzehnte beigetragen hat, zu der Krise der<br />
Finanzmärkte und zu einer Verantwortungslosigkeit der wirtschaftlichen Subjekte, die ohne Beispiel<br />
in der <strong>Wirtschaft</strong>sgeschichte ist, mit immer nur einem Ziel, den international akzeptablen Renditen<br />
für die Shareholder in Höhe von 15 Prozent bis zu den 25 Prozent, von denen der Deutsche-Bank-<br />
Chef Ackermann noch vor kurzem geredet hat.<br />
Aber im Unterschied zu seinen Nachfolgern in der gegenwärtigen Ökonomie hatte die<br />
<strong>Wirtschaft</strong>slehre des Adam Smith noch ein Ziel!<br />
Das Ziel der <strong>Wirtschaft</strong> ist der Mensch. Smith blendet die Frage, wozu wir wirtschaften, welchen<br />
Sinn das macht, er fragt, wem das alles nützen soll. Cui bonum? – Wem kommt das zugute? Und<br />
seine Antwort, es dient dem Menschen. Der Mensch ist Ziel und Zweck der <strong>Wirtschaft</strong>. Wie das<br />
auszuführen ist, bleibt Aufgabe der Ethik im Gespräch mit der Anthropologie.<br />
Einer der <strong>Wirtschaft</strong>sethiker, der in diese Richtung forscht, denkt und lehrt, ist Peter Ulrich, der St<br />
Gallener Ökonom und Philosoph. Sein Ziel ist der freie und liberale <strong>Wirtschaft</strong>sbürger, der nicht nur<br />
Ziel, sondern auch handelndes Subjekt von <strong>Wirtschaft</strong> ist. Die Gemeinschaft der <strong>Wirtschaft</strong>sbürger,<br />
als wir alle als Stakeholder mit - diskutieren und bestimmen über das, was Ziel einer „guten“<br />
<strong>Wirtschaft</strong> ist, bestimmt das Ziel und die Art und Weise guten <strong>Wirtschaft</strong>ens. Argumente geben den<br />
Ausschlag über die Richtung, nicht die Macht der Global Player oder die Akkumulation immer<br />
größerer Kapitalmengen in den Händen weniger. Im Diskurs zeigt sich, was die richtige Art des<br />
<strong>Wirtschaft</strong>ens ist, das gute <strong>Wirtschaft</strong>en. Wenn der Satz des Vespasian, das Geld nicht stinkt, meint,<br />
38