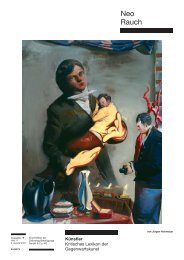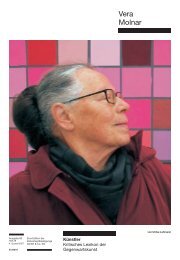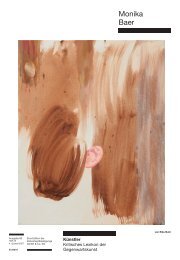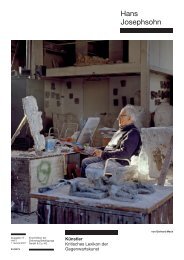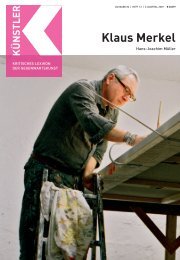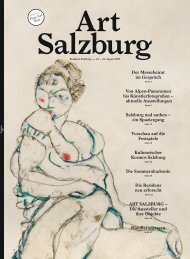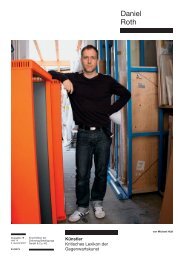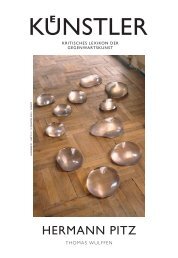rudolf herz
rudolf herz
rudolf herz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die symbolische Verletzung des Dargestellten befördert:<br />
Es sind signifikante, gleichwohl hilflose Gesten der hilflosen<br />
Aggression und einer Vergangenheitsbewältigung,<br />
„die die Wunden nicht heilen konnte.“ 30 Und sie führen<br />
die ambivalente Qualität des Mediums vor Augen. „Gerade<br />
die Fotografie eignet sich in besonderer Weise für<br />
diese magisch anmutende Substitution des Abbildes<br />
durch die Abgebildeten, weil sie aufgrund der mechanischen<br />
Reproduktionstechnik an jedes fotografisch erzeugte<br />
Bild die unaufhebbare Überzeugung knüpft, die<br />
im Foto dargestellten Personen seien so und nicht anders<br />
bei der Entstehung des Bildes anwesend gewesen. … Gerade<br />
die Zerstörung der Bilder und die Scheinhinrichtung<br />
der Abgebildeten bezeugen die realitätserzeugende<br />
Macht des bildlichen Scheins.“ 31 1997 werden neun dieser<br />
Fotografien in die Ausstellung „Deutschlandbilder:<br />
Kunst aus einem geteilten Land“ im Martin-Gropius-Bau<br />
Berlin aufgenommen.<br />
„<br />
das Werk von <strong>rudolf</strong> <strong>herz</strong> erscheint<br />
als erprobung der Grenzen der zumutbarkeit<br />
im ästhetischen wie im<br />
politischen raum.<br />
“<br />
Am Beispiel der Fotografie des Hitler-Vertrauten und<br />
„Reichsbildberichterstatters“ Heinrich Hoffmann hat<br />
Rudolf Herz 1994 eine differenzierte Analyse der systematisch<br />
konstruierten Bildrhetorik des Hitler-Porträts<br />
seit Anfang der 20er Jahre bis zum Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs vorgelegt. Anhand der Motivwahl und fotografischen<br />
Perspektive zeigte er, in welcher publizistischen<br />
Rhetorik die fotografische Stilisierung Hitlers<br />
als Visionär, als kämpferischer Eroberer, geistiger Führer,<br />
als Feldherr und als Privatmann geschah. 32 Das Inszenierungspotential<br />
greift weit über das Ende der nationalsozialistischen<br />
Gewaltherrschaft hinaus und offenbart<br />
die Fortschreibung des Hitler-Bildes sowohl in der<br />
Geschichtswissenschaft als auch in der breiten Öffentlichkeit<br />
bis in die Gegenwart durch unkritische Bildwahrnehmung.<br />
Wie bedenklich noch ein halbes Jahrhundert<br />
nach Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft<br />
die Diskussion um den ikonographischen Auftritt<br />
Hitlers erscheint, belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass<br />
die Ausstellung nach München – entgegen der vorab festgelegten<br />
Vereinbarungen – nicht in Berlin und Saarbrücken<br />
gezeigt werden durfte. 33<br />
Die Rauminstallation Zugzwang geht von einem Zufall<br />
aus. Im Sommer 1912 lässt sich der junge Marcel Duchamp<br />
anlässlich seines Aufenthalts in München vom<br />
späteren Hitlerporträtisten Hoffmann fotografieren. Im<br />
Kunstverein Essen führt Rudolf Herz 1995 die beiden<br />
Porträts in wandhohen Bildtapeten nebeneinander zu-<br />
sammen (Abb. Cover und 4). Hitler und Duchamp sind<br />
jeweils mit dem Blick auf den Betrachter gerichtet, in<br />
seriösem Anzug, gutbürgerlich gekleidet: zum einen die<br />
suggestive Präsenz des beliebtesten Staatsmanns der<br />
Deutschen im 20. Jahrhundert, der sich selbst auch als<br />
weltgestaltender Künstler verstand, zum anderen der<br />
meist diskutierte Künstler, der dem 20. Jahrhundert mit<br />
der ästhetisch-konzeptuellen Neubewertung von Kunst,<br />
Alltagswelt und Wahrnehmung seinen Stempel aufgedrückt<br />
hat. Der Begriff „Zugzwang“, dem Schachspiel<br />
entlehnt, bedeutet eine unausweichliche Situation im regelkonformen<br />
Handeln, einen Schachzug, der die eigene<br />
Position schwächt. Der Betrachter ist gefordert, sein<br />
Verhältnis zu Bild, Geschichte und Alltag, zu sich selbst<br />
zu prüfen, durch die herausfordernde wie unerträgliche<br />
Kombination eines Massenmörders mit einem Helden der<br />
Kultur des 20. Jahrhunderts – und dies in der sogenannten<br />
Alten Synagoge in Essen, in deren unteren Räumen<br />
der Kunstverein Ruhr sein Domizil hatte. 34 Seitdem wurde<br />
Zugzwang mehrfach gezeigt, u. a. 2002 in der Ausstellung<br />
„Nazi Imagery / Recent Art“ im The Jewish Museum<br />
in New York. 35<br />
d u c h a m p s z i m m e r u n d d e r<br />
A u s w e g a u s d e m K u b i s m u s<br />
Das Werk von Rudolf Herz erscheint als Erprobung der<br />
Grenzen der Zumutbarkeit im ästhetischen wie im politischen<br />
Raum. Es ist weniger Experiment als vielmehr<br />
kulturelle und kulturhistorische Recherche nach verdrängten<br />
wie verdrängenden Denkmustern im Blick auf<br />
die Gegenwart. Historische Dimensionen berücksichtigt<br />
Rudolf Herz dabei als ein psychologisch wirksames Potential,<br />
dessen Spuren gesellschaftlich akut bleiben.<br />
„Ich brauche das freie Spiel. Und die Kraft, die in der<br />
Negation steckt. Kunst kann eine Widerspruchsinstanz<br />
sein. Man darf sie nur nicht mit einer angeblich a priori<br />
– schon widerständigen Praxis verwechseln. Das war<br />
ein fundamentaler Irrtum der Kulturrevolutionäre. Mir<br />
geht es um radikale Kritik, nicht um Verschönerungsvorschläge.“<br />
36 Der Impuls zur künstlerischen Arbeit gründet<br />
in einem kritischen Verhältnis zur Realität. Als Bildhauer<br />
umkreist er die Spezifik des Ortes, als Kulturwissenschaftler<br />
den Blick auf die mediatisierte Realität, sei es<br />
durch Fotografie oder auf der Schnittstelle durch nahezu<br />
archäologisch gegründete Bestandsaufnahmen. So<br />
analysiert er in dem künstlerischen Forschungsprojekt<br />
9