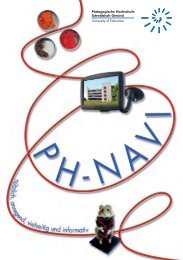Beiträge zur Gesundheitspsychologie - Pädagogische Hochschule ...
Beiträge zur Gesundheitspsychologie - Pädagogische Hochschule ...
Beiträge zur Gesundheitspsychologie - Pädagogische Hochschule ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
ISBN 978-3-925555-35-0<br />
Gmünder Hochschulreihe Nr. 29<br />
Heike Eschenbeck<br />
Uwe Heim-Dreger<br />
Carl-Walter Kohlmann (Hrsg.)<br />
<strong>Beiträge</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
8. Kongress für <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
der Fachgruppe <strong>Gesundheitspsychologie</strong> der<br />
Deutschen Gesellschaft für Psychologie<br />
Schwäbisch Gmünd<br />
17. – 19. September 2007
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
Heike Eschenbeck<br />
Uwe Heim-Dreger<br />
Carl-Walter Kohlmann<br />
(Herausgeber)<br />
<strong>Beiträge</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
8. Kongress für <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
der Fachgruppe <strong>Gesundheitspsychologie</strong> der<br />
Deutschen Gesellschaft für Psychologie<br />
Schwäbisch Gmünd<br />
17. – 19. September 2007<br />
Schwäbisch Gmünd 2007
Gmünder Hochschulreihe Band 29<br />
Herausgegeben vom Rektorat<br />
der <strong>Pädagogische</strong>n <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
Schwäbisch Gmünd 2007 ISBN 978-3-925555-35-0
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort ..............................................................................................................7<br />
Programmkomitee ............................................................................................8<br />
Positionsreferate<br />
Warum Abnehmen so schwer fällt: Ein Zielkonfliktmodell<br />
der kognitiven Regulation des Essverhaltens<br />
(W. Stroebe) ..............................................................................................9<br />
Lifestyle Changes and the Prevention of Coronary Heart<br />
Disease (G. Weidner) ..............................................................................10<br />
Gesundheitsförderung in der Schule (M. Jerusalem) ...............................11<br />
Philosophischer Gastbeitrag<br />
Körperzentrierte Lebensgestaltung (F. J. Wetz) ......................................13<br />
Symposien<br />
Persönlichkeit und Gesundheit (H. W. Krohne) .......................................15<br />
Soziale Unterstützung (A.-R. Laireiter & T. Klauer) .................................21<br />
Theorie des geplanten Verhaltens und Erweiterungen<br />
(B. Dohnke & M. Sieverding) ...................................................................27<br />
Adipositas im Kindes- und Jugendalter (C.-W. Kohlmann) ......................31<br />
Subjektives Wohlbefinden in der <strong>Gesundheitspsychologie</strong>:<br />
Erhebungsmethoden und Anwendungsbeispiele (M. Kanning) ...............35<br />
Psychokardiologie – Soziale Unterstützung, psychisches<br />
Wohlbefinden und die Relevanz von Geschlechtsunterschieden<br />
(H. Spaderna) ..........................................................................................39<br />
Podiumsdiskussion<br />
Professionalisierung in der Gesundheitsförderung (R. Hornung) ............43<br />
Forschungsreferate .......................................................................................45<br />
Autoren .........................................................................................................147
Vorwort<br />
<strong>Gesundheitspsychologie</strong> befasst sich mit menschlichem Erleben und Verhalten<br />
als Faktoren für die Erreichung und Aufrechterhaltung von Gesundheit. Auf der<br />
Basis psychologischer Theorien des Gesundheitsverhaltens werden Interventionen<br />
<strong>zur</strong> Gesundheitsförderung entwickelt, evaluiert und in der Praxis umgesetzt.<br />
Gesundheitsförderung und Prävention haben in Deutschland allerdings<br />
einen noch viel zu geringen Stellenwert, um den individuellen und gesellschaftlichen<br />
Herausforderungen, z. B. der dramatischen Entwicklung von Übergewicht,<br />
begegnen zu können. Zwar ist der protektive Wert von verschiedenen<br />
gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen wie körperlicher Aktivität, ausgewogener<br />
Ernährung, Nichtrauchen, Kondombenutzung, Sonnenschutz, Verkehrssicherheit,<br />
Drogenvermeidung und Stressbewältigung belegt, allerdings<br />
wird noch immer zu wenig in Gesundheitsförderung und Prävention investiert,<br />
obwohl gesundheitspsychologische Kenntnisse zu den individuellen und<br />
sozialen Voraussetzungen <strong>zur</strong> Initiierung, Planung, Durchführung und Aufrechterhaltung<br />
von Gesundheitsverhalten vorliegen.<br />
Die Fachgruppe <strong>Gesundheitspsychologie</strong> innerhalb der Deutschen Gesellschaft<br />
für Psychologie organisiert im Abstand von zwei Jahren Kongresse,<br />
um Fortschritte in Theorie und Anwendung vorzustellen und zu diskutieren. Auf<br />
dem diesjährigen Kongress, der vom 17. bis 19. September 2007 an der<br />
<strong>Pädagogische</strong>n <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd stattfindet, besteht das<br />
Programm aus drei eingeladenen Positionsreferaten, einem philosophischen<br />
Gastbeitrag, mehreren Symposien und einer Serie von Einzelvorträgen und<br />
Postern. Die insgesamt ca. 130 wissenschaftlichen <strong>Beiträge</strong>, deren Auswahl mit<br />
dankenswerter Unterstützung des Programmkomitees erfolgte, werden ergänzt<br />
um eine interdisziplinär besetzte Podiumsdiskussion <strong>zur</strong> Qualitätssicherung in<br />
der Gesundheitsförderung. Der vorliegende Band dokumentiert die wissenschaftlichen<br />
<strong>Beiträge</strong>.<br />
Für die großzügige Unterstützung bei der Durchführung des Kongresses<br />
danken wir dem Rektorat der <strong>Pädagogische</strong>n <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd,<br />
der Gmünder ErsatzKasse GEK und der Deutschen Forschungsgemeinschaft.<br />
Wir bedanken uns bei Tobias Haas, Cornelia Schmitt und Maria Wunderl für<br />
ihre Hilfe bei der Erstellung des Abstractbands.<br />
Unser besonderer Dank gilt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des<br />
„8. Kongresses für <strong>Gesundheitspsychologie</strong>“, die mit ihren <strong>Beiträge</strong>n die Zusammenstellung<br />
eines attraktiven Programms ermöglicht haben.<br />
Schwäbisch Gmünd, September 2007<br />
Heike Eschenbeck, Uwe Heim-Dreger und Carl-Walter Kohlmann<br />
7
Programmkomitee<br />
Dr. Heike Eschenbeck, <strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
Prof. Dr. Toni Faltermaier, Universität Flensburg<br />
Prof. Dr. Gert Kaluza, GKM-Institut Marburg<br />
Prof. Dr. Carl-Walter Kohlmann, <strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
Prof. Dr. Arnold Lohaus, Universität Bielefeld<br />
Prof. Dr. Britta Renner, Jacobs University Bremen<br />
Prof. Dr. Wolfgang Schlicht, Universität Stuttgart<br />
Juniorprofessor Dr. Andreas Schwerdtfeger, Universität Mainz<br />
Prof. Dr. Monika Sieverding, Universität Heidelberg<br />
Prof. Dr. Harald C. Traue, Universität Ulm<br />
Prof. Dr. Hannelore Weber, Universität Greifswald<br />
8
Positionsreferate<br />
Warum Abnehmen so schwer fällt: Ein Zielkonfliktmodell<br />
der kognitiven Regulation des Essverhaltens<br />
Wolfgang Stroebe<br />
Universität Utrecht<br />
w.stroebe@fss.uu.nl<br />
Seit 1980 erfahren praktisch alle industrialisierten Länder (und auch viele Entwicklungsländer)<br />
einen dramatischen Anstieg von Übergewicht und Adipositas.<br />
Da Adipositas nicht nur mit gesundheitlichen Schäden sondern auch mit<br />
negativen sozialen Konsequenzen verbunden ist, steigt in diesen Ländern der<br />
Anteil der Bevölkerung, der chronisch bemüht ist, Gewicht zu verlieren. Obwohl<br />
diesen Abnahmeversuchen häufig Erfolg beschieden ist, ist der Erfolg meist<br />
kurzfristig. Nach vier bis fünf Jahren haben die meisten Übergewichtigen das<br />
verlorene Gewicht wieder <strong>zur</strong>ück gewonnen. Damit erhebt sich die Frage,<br />
warum manchen Menschen das Abnehmen so schwer fällt.<br />
Im meinem Vortrag werde ich erst auf das Grenzmodell des Essverhaltens<br />
eingehen, das den „gezügelten Esser“ als chronisch aber erfolglos mit Abnahmeversuchen<br />
befassten Menschentyp identifiziert hat. Gezügelte Esser sind<br />
kontrollierte Esser, die ihre Kalorienaufnahme an einer Diätgrenze orientieren.<br />
Diese Kontrolle benötigt kognitive Kapazität und ist damit äußerst störanfällig<br />
(z. B. bei starken Emotionen). Nach einer Kritik des Grenzmodells werde ich<br />
unser Zielkonfliktmodell vorstellen, das davon ausgeht, dass sich gezügelte<br />
Esser in einem Konflikt zwischen zwei widersprüchlichen Zielen befinden, nämlich<br />
Essgenuss und Gewichtskontrolle. Sie bemühen sich, das Gewichtskontrollziel<br />
dadurch abzuschirmen, dass sie Gedanken an gutes Essen vermeiden.<br />
Ich werde ein Forschungsprogramm vorstellen, das mit Methoden der<br />
sozialen Kognitionsforschung aufweist, warum diesen Bemühungen in einer<br />
Umwelt voll von Reizen, die gutes Essen signalisieren, häufig kein Erfolg beschieden<br />
ist.<br />
Literatur:<br />
Papies, E., Stroebe, W., & Aarts, H. (in press). Pleasure in the mind: Food imagery of restrained<br />
and unrestrained eaters. Journal of Experimental Social Psychology.<br />
Stroebe, W. (2000). Social psychology and health. Buckingham: Open University Press.<br />
Stroebe, W. (2003). Psychologische Steuerung des Essverhaltens. In F. Peterman & V. Pudel<br />
(Hrsg.), Übergewicht und Adipositas (S. 87-104). Göttingen: Hogrefe.<br />
Stroebe, W., Mensink, W., Aarts, H., Schut, H. & Kruglanski, A. (in press). Why dieters fail: Testing<br />
the goal conflict model of eating. Journal of Experimental Social Psychology.<br />
Keywords:<br />
Adipositas, Gezügelte Esser, Zielkonflikt<br />
9
Lifestyle Changes and the Prevention of Coronary<br />
Heart Disease<br />
Gerdi Weidner<br />
Preventive Medicine Research Institute, Sausalito CA<br />
gweidner@yahoo.com<br />
This presentation focuses on results from a research program investigating the<br />
effects of an intensive lifestyle intervention on cardiovascular outcomes. We<br />
report findings from 2 completed randomized phase III clinical trials and 2<br />
health-insurance sponsored multi-site demonstration projects (phase IV; one<br />
completed, one on-going). The intervention aims to improve diet (low fat, plantbased),<br />
exercise, and stress management. To date, more than 2000 cardiac<br />
patients differing in disease severity have participated in the intervention, with<br />
follow-ups ranging from 3 months to 5 years. Outcomes include medical risk<br />
factors (lipid profiles, blood pressure, exercise capacity, weight, cardiac events)<br />
and psychosocial variables (depression, hostility, quality of life). Results from<br />
the 2 phase III clinical trials demonstrated the effectiveness of the intervention.<br />
Specifically, intervention participants were able to change their lifestyle, evidencing<br />
significant improvements in left ventricular ejection fraction (LVEF),<br />
standard coronary risk factors, and psychosocial status, as well as significant<br />
reductions in angina, coronary artery stenosis, and cardiac events when compared<br />
to controls. These results prompted several nationwide health insurance<br />
providers to cover the intervention as an alternative to invasive treatment of<br />
coronary heart disease (CHD), resulting in 2 multi-site phase IV demonstration<br />
projects: the Multicenter Lifestyle Demonstration Project (MLDP; 1993-1997),<br />
and the Multisite Cardiac Lifestyle Intervention Program (MCLIP; 1998ongoing).<br />
Analyses of data from these projects show that regardless of gender<br />
and disease severity (e.g., CHD ± diabetes, low vs. high LVEF; CHD patients<br />
vs. those with ≥3 CHD risk factors), patients were able to follow the recommended<br />
lifestyle and evidenced improvement in standard coronary risk factors<br />
and quality of life similar to that observed in the intervention arms of the earlier<br />
phase III randomized clinical trials. The results from this program of research<br />
show that evidence-based low-cost behavioral interventions can be successfully<br />
adopted by health insurance plans. Considering the economic burden of CHD in<br />
terms of symptom management, increased risk of cardiovascular events, and<br />
lost productivity, these findings take on added significance.<br />
10
Gesundheitsförderung in der Schule<br />
Matthias Jerusalem<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
jerusalem@rz.hu-berlin.de<br />
Gesundheitsförderung in Kindheit und Jugend ist besonders wichtig, da sich<br />
risikoreiche Verhaltens- und Lebensstile (z. B. Fehlernährung, Bewegungsmangel,<br />
Rauchen, Alkoholkonsum) früh entwickeln und stabilisieren und später<br />
nur noch sehr schwer zu ändern sind. Gesundheitsförderung in diesem Alter<br />
findet überwiegend in der Schule statt, da hier fast alle Kinder und Jugendlichen<br />
erreichbar und gruppenbezogene Maßnahmen mit Evaluation möglich sind.<br />
Zudem hat das schulische Umfeld einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung<br />
der Persönlichkeit und die Ausbildung sozialer Fertigkeiten, die<br />
wiederum in einem komplexen Beziehungsgefüge zu gesundheitsrelevanten<br />
Verhaltensweisen stehen.<br />
Dieser Beitrag informiert über traditionell risikobezogene Maßnahmen <strong>zur</strong><br />
Gesundheitserziehung sowie neuere, entwicklungsorientierte Ansätze einer<br />
Gesundheitsförderung durch Ressourcenstärkung sowie deren Wirksamkeit. Im<br />
Laufe der Geschichte psychologischer Gesundheitsförderung in der Schule hat<br />
sich insgesamt eine Strategie der Risikoprophylaxe durch Entwicklung von<br />
Ressourcen durchgesetzt. Aus schulischer Sicht wird Gesundheitsförderung<br />
meist als wichtig, aber mit zusätzlichem Aufwand verbunden erlebt, da sie <strong>zur</strong><br />
Bewältigung des Bildungsauftrags wenig beiträgt. Neuere Ansätze verdeutlichen<br />
deshalb insbesondere gemeinsame Ziele und Aufgaben von schulischer<br />
Bildung und Gesundheitsförderung. Daraus ergeben sich integrative Maßnahmen<br />
einer übergreifenden schulischen Entwicklungsförderung, die zugleich<br />
für Gesundheit, Lernen und Sozialverhalten förderlich sind.<br />
Der Beitrag schließt mit einem Ausblick auf noch offene Fragen und<br />
Forschungsaufgaben.<br />
Keywords:<br />
Gesundheitsförderung, Schule, Entwicklungsförderung<br />
11
Philosophischer Gastbeitrag<br />
Körperzentrierte Lebensgestaltung<br />
Franz Josef Wetz<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
fjwetz@t-online.de<br />
Ein gesteigertes Körperbewusstsein gehört zu den charakteristischen Merkmalen<br />
unserer Zeit. Dafür zeichnen verantwortlich der Bedeutungsverlust der<br />
schweren Körperarbeit, der Zuwachs an wohlfahrtsstaatlichen Einrichtungen,<br />
vermehrte Freizeit und gesellschaftliche Disziplinierungen, die im Gegenzug<br />
körperbezogene Daseinspraktiken hervorrufen. Zeitgenössische Formen reiner<br />
Körperlichkeit sind Gesundheitswahn, Körperkult, Sportversessenheit, Abenteuerlust<br />
und Sexsucht. Bei diesen Enklaven reiner Körperlichkeit geht es<br />
vordergründig mal um Vitalität, Schönheit, Prestige, Jugendlichkeit, mal um<br />
erfolgreiches Kräftemessen, Wettbewerb, Bewegungsdrang, mal um entspanntes<br />
Wohlbefinden, angespannte Erregung oder prickelnden Kick. Eine<br />
weiter gehende Erklärung dieser Phänomene erfordert eine Aufhebung der für<br />
die abendländische Denktradition charakteristischen Natur-Kultur-Antinomie:<br />
Aus sozio- und evolutionsbiologischer Sicht stehen hinter den allgemeinen<br />
Zielen der heutigen Körperkultur die kulturell überformten Mechanismen der<br />
natürlichen und sexuellen Selektion, das heißt die ursprünglichen Lebensinteressen<br />
der Selbsterhaltung und Fortpflanzung, deren überschüssigen Antriebskräfte<br />
der entlastete Mensch in den Dienst körperlicher Selbsterfüllung<br />
nimmt.<br />
Keywords:<br />
Körperkultur, Soziobiologie<br />
13
Symposium 1: Persönlichkeit und Gesundheit<br />
(Organisation: H. W. Krohne)<br />
Warum sie laufen: Motive, Persönlichkeitsmerkmale,<br />
Bewältigung und Selbstdarstellung von Langstreckenläufern<br />
und -läuferinnen<br />
Anja Geßner, Karl-Heinz Renner & Lucie Kratka<br />
Otto-Friedrich-Universität Bamberg/ Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie<br />
anja.gessner@ppp.uni-bamberg.de<br />
Fragestellung: Zahlreiche Studien belegen die positiven Effekte von Ausdauersportarten,<br />
z. B. Langstreckenlauf, auf physisches und psychisches Wohlbefinden.<br />
Dagegen liegen nur wenige Untersuchungen <strong>zur</strong> Frage vor, mit<br />
welchen Bedingungen die Entscheidung, einen Ausdauersport zu beginnen und<br />
regelmäßig auszuüben, einhergehen. Ziel des Beitrags ist es, aus persönlichkeits-<br />
und sportpsychologischer Perspektive Bedingungen zu identifizieren,<br />
die mit regelmäßigem Laufen assoziiert sind. Vor diesem Hintergrund werden<br />
folgende Fragen untersucht:<br />
(1) Welche Motive und Emotionen bedingen regelmäßiges Lauftraining?<br />
(2) Wie bewältigen die LäuferInnen mögliche Laufhindernisse/Belastungen<br />
während des Trainings bzw. während Wettkämpfen?<br />
(3) Welcher Zusammenhang besteht zwischen Persönlichkeitsmerkmalen<br />
(Big Five und Selbstdarstellungsvariablen) und Laufen?<br />
Methode: In einer Online-Fragebogenstudie, an der etwa 300 Langstreckenläufer<br />
teilgenommen haben, wurden die Dimensionen des Fünf-<br />
Faktorenmodells der Persönlichkeit, laufbezogene Motive und Emotionen erfasst.<br />
Erhoben wurden auch Bedingungen wie Zeit-Management und die Bewältigung<br />
von motivationalen Einbrüchen und Belastungen beim Lauftraining.<br />
Zudem wurden (trainingsbezogene) Selbstdarstellungsskalen vorgelegt, um den<br />
bisher vernachlässigten Aspekt der Eindruckslenkung beim Laufen zu explorieren.<br />
Ergebnisse: Motive für regelmäßiges Laufen variieren mit dem Alter, dem<br />
Geschlecht und dem Leistungsstand. Unter den Big-Five-Dimensionen erweist<br />
sich die Gewissenhaftigkeit als entscheidender Faktor: Gewissenhaftigkeit ist<br />
nach Kontrolle von Alter und Geschlecht u. a. assoziiert mit der Trainingsfrequenz<br />
pro Woche, positiven Emotionen beim Laufen und der Planung von<br />
festen Laufzeiten. Selbstdarstellung im Sinne des Motivs, gegenüber anderen<br />
als sportlich und fit zu erscheinen, korreliert u. a mit der Trainingsdauer pro<br />
Trainingseinheit, dem Motiv nach Verbesserung der äußeren Erscheinung<br />
durch Laufen und Laufen aus Leistungsstreben.<br />
Keywords:<br />
Laufen, Persönlichkeit, Bewältigung<br />
15
Persönliche Ziele als Motivatoren und Regulatoren<br />
sportlich aktiven Verhaltens<br />
Heinz W. Krohne & Dagmar L. Thiex<br />
Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Psychologisches Institut<br />
hkrohne@uni-mainz.de<br />
Die Untersuchung befasst sich mit persönlichen Zielen als möglichen Determinanten<br />
regelmäßiger sportlicher Betätigung. Diese persönlichen Ziele<br />
unterscheiden sich zum einen nach Inhalten, zum anderen nach kognitiven,<br />
affektiven und verhaltensmäßigen Merkmalen der Zielrepräsentation.<br />
Verglichen wurden die wichtigsten Ziele von Personen, die regelmäßig,<br />
unregelmäßig oder nie sportlich aktiv sind. Auf der Basis des transtheoretischen<br />
Modells der Verhaltensänderung von Prochaska und DiClemente wurden 470<br />
Teilnehmer einer der fünf in dem Modell unterschiedenen Stufen der Verhaltensänderung<br />
zugeordnet.<br />
Es ließen sich faktorenanalytisch sechs Dimensionen sportrelevanter Ziele<br />
unterscheiden: Wettbewerb, psychologische Ziele, Gesundheitsförderung,<br />
körperbezogene Ziele, Geselligkeit sowie Bewältigung von Gesundheitsproblemen.<br />
Während körperbezogene Ziele und Gesundheitsförderung für Personen<br />
aller Stufen relevant waren, berichteten Personen in der Stufe der Aufrechterhaltung<br />
mehr Inhalte aus den Bereichen Wettbewerb sowie soziale und<br />
psychologische Ziele. Im Gegensatz dazu war das Ziel, auf Grund von Gesundheitsproblemen<br />
sportlich aktiver zu werden, dominant bei Personen, die bislang<br />
nie oder höchstens unregelmäßig sportlich aktiv waren. Hinsichtlich der Zielrepräsentation<br />
zeigte sich, dass regelmäßig Aktive ihr Handeln zielgerichteter<br />
planten und mehr positive sowie weniger negative Affekte in Bezug auf ihr<br />
durch Sport zu erreichendes Ziel äußerten, während Personen der frühen<br />
Stufen der Verhaltensänderung in stärkerem Ausmaß Konflikte zwischen ihren<br />
persönlichen Zielen erlebten.<br />
Diese Befunde demonstrieren, dass die Aufnahme und Aufrechterhaltung<br />
eines sportlich aktiven, gesundheitsförderlichen Verhaltens in starkem Maße<br />
durch persönliche Ziele determiniert werden.<br />
Keywords:<br />
Persönliche Ziele, sportliche Aktivität, Gesundheitsförderung<br />
16
Stressbewältigung in der Prämedikationsvisite: Interindividuelle<br />
Unterschiede in subjektiven, behavioralen<br />
und physiologischen Reaktionen vor einer Operation<br />
Andreas Schwerdtfeger 1 , Lena Scheel 1 , Barbara Schnell 1 &<br />
Arno Depta 2<br />
1<br />
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz / Psychologisches Institut<br />
2<br />
Johannes Gutenberg-Universtität, Mainz / Klinik für Anästhesiologie<br />
aschwerd@uni-mainz.de<br />
Fragestellung: Medizinische Eingriffe unter Vollnarkose oder Lokalanästhesie<br />
stellen einen nicht unerheblichen Stressor für Patienten dar, der sich auch<br />
negativ auf die perioperative Anpassung (Schmerzerleben, Komplikationen,<br />
Güte der postoperativen Erholung, Länge des Klinikaufenthalts) auswirken<br />
kann. Vor diesem Hintergrund kommt der Angst- und Stressbewältigungsforschung<br />
eine zentrale Rolle zu. In dieser Studie wurde das Anästhesiegespräch<br />
(Prämedikationsvisite) hinsichtlich Angst- und Stressreaktionen untersucht.<br />
Methode: 44 Patienten nahmen an der Studie teil. Erfasst wurden Angstbewältigungsdispositionen,<br />
Operationsangst sowie subjektive und physiologische<br />
Stressreaktionen (Cortisol) vor und nach dem Gespräch. Weiterhin<br />
wurden verschiedene Verhaltensindikatoren der Angst von zwei unabhängigen<br />
Beobachtern erfasst.<br />
Ergebnisse: Generell zeigte sich eine Abnahme der Angst nach dem Gespräch,<br />
wobei vermeidende Bewältigung tendenziell mit geringerer Angst und<br />
vigilante Bewältigung tendenziell mit höherer Angst verbunden war. Darüber<br />
hinaus korrelierte vermeidende Bewältigung negativ mit der Dauer des Anästhesiegesprächs<br />
und mit körperfokussierten Handbewegungen während des<br />
Gesprächs. Vigilante Bewältiger erhielten tendenziell häufiger eine Beruhigungsmedikation<br />
vor der OP. Die Auswertung der Cortisoldaten liegt noch<br />
nicht vor; die Ergebnisse werden aber auf der Tagung berichtet.<br />
Diskussion: Obgleich die Prämedikationsvisite auf die meisten Patienten<br />
beruhigend und Angst reduzierend zu wirken scheint, deuten die Daten auf<br />
interindividuelle Unterschiede in der Verarbeitung des Gesprächs hin. Eine<br />
detailliertere Analyse der Daten lässt vermuten, dass Assoziationen von der<br />
Operationsvorerfahrung, der Narkoseart und der zu Grunde liegenden Erkrankung<br />
moduliert werden. In wie weit die interindividuellen Unterschiede in<br />
der Bewältigung des operativen Eingriffs Einfluss auf Parameter des postoperativen<br />
Genesungsverlaufs haben, sollten weitere Untersuchungen klären.<br />
Keywords:<br />
Angstbewältigung, Operationsangst, Prämedikationsvisite<br />
17
„Warten auf ein neues Herz“: Kognitive Vermeidung<br />
und Belastungen bei Herztransplantationskandidaten<br />
Heike Spaderna 1 , Daniela Zahn 1 , Heinz W. Krohne 1 &<br />
Gerdi Weidner 2<br />
1<br />
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz / Psychologisches Institut<br />
2<br />
Preventive Medicine Research Institute, Sausalito, CA, USA<br />
spaderna@uni-mainz.de<br />
Fragestellung: Bei Herzinsuffizienzpatienten und Patienten auf der Warteliste<br />
für eine Herztransplantation (HTX) scheinen Müdigkeit, Angst, Depressivität<br />
und Schmerzen mit vermeidenden Bewältigungsstrategien (z. B. Verbergen von<br />
Gefühlen) einherzugehen. Unklar ist, ob spezifische dispositionelle Copingstile,<br />
wie kognitive Vermeidung (KOV, Abwenden der Aufmerksamkeit von Bedrohung)<br />
und Vigilanz (VIG, Hinwendung <strong>zur</strong> Bedrohung) mit emotionaler Belastung<br />
verbunden sind.<br />
Methode: Von April 2005 bis Januar 2007 bearbeiteten im Rahmen der<br />
Studie „Warten auf ein neues Herz“ 244 Männer und 57 Frauen (53.1±11.1<br />
Jahre) aus 17 HTX-Zentren 2 physisch bedrohliche Situationen des Angstbewältigungsinventars<br />
<strong>zur</strong> Bestimmung von KOV und VIG. Erfasst wurden zudem<br />
50 HTX-bezogene Belastungen, sowie Angst und Depressivität (HADS).<br />
Als objektive Marker des Gesundheitszustands dienten stationärer Klinikaufenthalt<br />
(ja/nein) und der Heart Failure Survival Score (HFSS). Die<br />
medizinischen Daten hierfür lieferte Eurotransplant.<br />
Ergebnisse: Frauen und Männer unterschieden sich nicht in KOV und VIG.<br />
Allerdings war nur bei Frauen höhere KOV mit stärkerer Belastung durch Atemnot,<br />
Schwäche und HTX-bezogene psychische Stressoren verbunden. Bei<br />
Männern dagegen war VIG positiv mit stärkerer Belastung durch Schmerzen,<br />
medizinische Untersuchungen, HTX-bezogene psychische Stressoren, Angst<br />
und Depressivität assoziiert. Mit dem HFSS ergaben sich keine Zusammenhänge.<br />
Kontrolliert für Alter und stationären Aufenthalt prädizierten sowohl VIG<br />
(für Männer und Frauen) als auch die Interaktion von KOV mit Geschlecht den<br />
Gesamtscore subjektiver Belastungen (beide p
Warum verhalten wir uns (nicht) gesund?<br />
Heike Wolf & Frank M. Spinath<br />
Universität des Saarlandes/Psychologie<br />
heike.wolf@mx.uni-saarland.de<br />
Fragestellung: Gesundheitsbewusstes Verhalten (wie z. B. Sport, Ernährung,<br />
Schlaf, Tabakkonsum) leistet einen bedeutsamen Beitrag zu Gesundheit und<br />
Wohlbefinden. Trotz des gut dokumentierten Nutzens betätigt sich die Mehrheit<br />
der Menschen in den westlichen Industrienationen beispielsweise nicht regelmäßig<br />
sportlich (z. B. Crespo et al., 1996) und verhält sich auch in anderen<br />
Lebensbereichen weniger gesundheitsbewusst als vorteilhaft wäre. Warum<br />
aber unterscheiden sich Personen in Lebensstil und Gesundheitsverhalten?<br />
Methode: Im Rahmen der Zwillingsstudie zu Persönlichkeit und Wohlbefinden<br />
(Twin PaW; Twin Study on Personality and Well-being, Spinath &<br />
Wolf, 2006) wurde das Gesundheitsverhalten von 342 ein- und zweieiigen<br />
Zwillingspaaren mittels Fragebogenverfahren detailliert erfasst. Zusätzlich<br />
wurden Merkmale der Umwelt, welche Einfluss auf Unterschiede im Gesundheitsverhalten<br />
nehmen könnten, erhoben.<br />
Mittels uni- und multivariater verhaltensgenetischer Analysen wurde die<br />
relative Bedeutung von genetischen und Umweltfaktoren sowie das Zusammenspiel<br />
von genetischen und Umwelteinflüssen untersucht.<br />
Ergebnisse: Individuelle Unterschiede im Gesundheitsverhalten (Sport,<br />
Rauchen, Ernährung) lassen sich durch genetische Einflüsse und Einflüsse der<br />
spezifischen Umwelt (d. h. Umwelteffekte, welche von Mitgliedern einer Familie<br />
nicht geteilt werden) erklären. Ferner zeigte sich, dass spezifische Erfahrungen<br />
den Einfluss von Genen und Umwelt auf gesundheitsbewusstes Verhalten<br />
moderieren können.<br />
Literatur:<br />
Crespo, C. J., Keteyian, S. J., Heath, G. W. & Sempos, C. T. (1996). Leisure time physical<br />
activity among US adults: Results from the Third National Health and Nutrition<br />
Examination Survey. Archives of Internal Medicine, 156, 93-98.<br />
Spinath, F.M. & Wolf, H. (2006). CoSMoS & TwinPaW: Initial report on two new German twin<br />
studies. Twin Research, 9, 787-790.<br />
Keywords:<br />
Gesundheitsverhalten, Verhaltensgenetik, individuelle Differenzen<br />
19
Symposium 2: Soziale Unterstützung<br />
(Organisation: A.-R. Laireiter & T. Klauer)<br />
Bewältigungsverhalten und soziale Unterstützung<br />
Katja Antoniw 1 , Andrea Borghardt 2 & Hannelore Weber 1<br />
1 Universität Greifswald<br />
2 Universität Giessen<br />
antoniw@uni-greifswald.de<br />
Fragestellung: Im Kontext gesundheitsbedrohlicher Stressoren führten eine<br />
aktive Bewältigung sowie deren ausgewogen positive Darstellung zu einer<br />
höheren Bereitschaft zu sozialer Unterstützung und positiveren emotionalen<br />
Reaktionen auf der Geberseite als passive oder depressive Bewältigungsmuster.<br />
Ziel dieser Untersuchung war es zu überprüfen, inwieweit vorliegende<br />
Befunde zum Einfluss des Bewältigungsverhaltens und der Art der Beziehung<br />
zwischen Unterstützungsgeber und Empfänger auf die Unterstützungsbereitschaft<br />
auf einen alltäglichen, leistungsbezogenen Stressor übertragen werden<br />
können.<br />
Methode: In einem 3 (perfekte, ausgewogene, ungünstige Bewältigung) x 2<br />
(Freundin, Bekannte) between-subjects Design wurde N = 132 Teilnehmerinnen<br />
ein schriftliches Szenario (Vorbereitung auf eine Prüfung) vorgelegt und ihre<br />
Unterstützungsbereitschaft sowie ihre emotionalen Reaktionen auf das beschriebene<br />
Verhalten der jeweiligen Zielperson erfasst.<br />
Ergebnisse: Zielpersonen mit ausgewogenem und Zielpersonen mit ungünstigem<br />
Bewältigungsverhalten lösten unabhängig von der Art der sozialen<br />
Beziehung eine höhere Bereitschaft zu sozialer Unterstützung aus als Zielpersonen<br />
mit perfektem Bewältigungsverhalten. Zielpersonen mit ungünstiger<br />
Bewältigung lösten das stärkste, Zielpersonen mit perfekter Bewältigung dagegen<br />
das geringste Mitleid aus. Mitleid erwies sich als stärkster Prädiktor <strong>zur</strong><br />
Vorhersage der Unterstützungsbereitschaft.<br />
Literatur:<br />
Helweg-Larsen, M., Sadeghian, P. & Webb, M.S. (2002). The stigma of being pessimistically<br />
biased. Journal of Social and Clinical Psychology, 21, 92-107.<br />
Silver, R.C., Wortman, C.B. & Crofton, C. (1990). The role of coping in support provision: The<br />
self-presentational dilemma of victims of life crises. In B.R. Sarason, I.G. Sarason & G.R.<br />
Pierce (Eds.), Social support: An interactional view (pp. 397-426). Oxford: Wiley.<br />
Weber, H. (2003). Breaking the rules: Personal and social responses to coping norm-violations.<br />
Anxiety, Stress and Coping, 16, 133-153.<br />
Keywords:<br />
soziale Unterstützung, Stressbewältigung, emotionale Reaktionen<br />
21
Interpersonelle Emotionsregulation im Alltag: Soziale<br />
Unterstützung und affektive Zustände bei Paaren<br />
Andrea B. Horn 1 , Peter Wilhelm 1 , Dominique Schoebius 2 , Louella<br />
Molina 1 , Stephan Rieder 1 & Meinrad Perrez 1<br />
1 Universität Fribourg, Schweiz<br />
2 UCLA, USA<br />
andrea.horn@unifr.ch<br />
Emotionsregulation weist bedeutsame Zusammenhänge mit physischer und<br />
psychischer Gesundheit auf. Bei der Untersuchung dieser Zusammenhänge<br />
wurden bisher weitgehend die interpersonellen Aspekte der Emotionsregulation<br />
vernachlässigt. In dieser Studie sollen berichtete affektive Zustände im Alltag<br />
mit sozialer Unterstützung in Bezug gestellt werden und somit der Beitrag von<br />
Unterstützungsverhalten zu der Regulation von Affekt im Alltag beleuchtet<br />
werden.<br />
In einer computerbasierten Tagebuchstudie wurden 68 Paare über eine<br />
Woche drei Mal am Tag bezüglich ihres aktuellen Affekts und empfangener und<br />
mobilisierter nicht-direktiver emotionaler Unterstützung sowie instrumenteller<br />
Unterstützung (Haushaltsarbeit, Kindererziehung) befragt. Außerdem wurde die<br />
Paarzufriedenheit von beiden Partnern erhoben.<br />
Nicht-direktives emotionales Unterstützungsverhalten zeigt einen<br />
stärkeren Effekt auf den täglichen Affekt als erhaltene alltägliche instrumentelle<br />
soziale Unterstützung für Haushalt und Kindeserziehung durch den Partner<br />
über die 21 Erhebungszeitpunkte hinweg, allerdings nur bei den weiblichen<br />
Studienteilnehmern. Bei Männern zeigen sich keine signifikanten Effekte<br />
empfangenen Unterstützungverhaltens. Bei beiden Geschlechtern lassen sich<br />
Zusammenhänge zwischen emotionaler sozialer Unterstützung und Paarzufriedenheit<br />
sowie hohe Korrelationen zwischen erhaltener und verfügbar gemachter<br />
nicht-direktiver emotionaler Unterstützung beobachten.<br />
Die Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass Affekt im Alltag von<br />
Paaren mit sozialer Unterstützung in der Partnerschaft assoziiert ist, wobei in<br />
dieser Stichprobe signifikante Geschlechtsunterschiede zu beobachten waren.<br />
Empfangen scheint ähnlich wie das Mobilisieren von emotionaler sozialer<br />
Unterstützung in der Partnerschaft <strong>zur</strong> Positivierung des Affekts beizutragen.<br />
Keywords:<br />
Emotionsregulation, soziale Unterstützung, Tagebuchstudie<br />
22
Geschlechtseffekte auf Unterstützungsintentionen:<br />
Reichweite und Moderatoren<br />
Thomas Klauer 1 & Sigrun-Heide Filipp 2<br />
1 Medizinische Fakultät der Universität Rostock, Klinik und Poliklinik für Psychosomatik<br />
und Psychotherapeutische Medizin<br />
2 Universität Trier, Fachbereich I - Psychologie<br />
thomas.klauer@med.uni-rostock.de<br />
Fragestellung: Während Befunde zu sozialer Unterstützung in realen Belastungssituationen<br />
konsistent Geschlechtsunterschiede in erhaltener und geleisteter<br />
sozialer Unterstützung nahelegen, finden sich kaum Hinweise auf entsprechende<br />
Unterschiede in der Unterstützungsbereitschaft für hypothetische<br />
Belastungssituationen (intendierte Unterstützung). In vorliegendem Beitrag wird<br />
die relative Bedeutsamkeit der Geschlechtsvariablen im Vergleich zu anderen<br />
Bedingungen intendierter Unterstützung geprüft.<br />
Methode. Untersucht werden Daten zu Geschlechtseffekten aus sechs<br />
Replikationsstudien eines Vignettenexperiments, in denen jeweils die von<br />
Schwarzer und Weiner (1990) entwickelte Unterstützungsskala verwendet<br />
wurde (N = 472).<br />
Ergebnisse: Auf globaler Ebene zeigt sich zunächst ein deutlicher Unterschied<br />
im Sinne einer höheren Unterstützungsbereitschaft weiblicher Versuchspersonen,<br />
der nicht durch die beiden in der Attributionstheorie des Hilfehandelns<br />
postulierten Mediatoren Mitleid und Ärger vermittelt wird. Allerdings<br />
zogen in den Vignetten beschriebene männliche Akteure deutlich höheren<br />
Ärger auf sich als weibliche. Weitere Befunde verweisen auf Interaktionen<br />
zwischen beiden Geschlechtsvariablen untereinander sowie mit Merkmalen der<br />
in den Vignetten dargestellten Belastungssituationen.<br />
Neben der Frage der Generalisierbarkeit der Befunde werden abschließend<br />
Implikationen für Modelle der Verfügbarkeit sozialer Unterstützung<br />
diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Schwarzer, R. & Weiner, B. (1990). Die Wirkung von Kontrollierbarkeit und Bewältigungsverhalten<br />
auf Emotionen und soziale Unterstützung. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 21,<br />
118-125.<br />
Keywords:<br />
Social Support Networks, Coping Behaviors, Gender Differences<br />
23
Effekte mobilisierter und erhaltener Unterstützung<br />
auf die Selbstwirksamkeitserwartungen der Unterstützungsgeber<br />
und Empfänger<br />
Nina Knoll 1 , Silke Burkert 1 , Urte Scholz 2 & Oliver Gralla 1<br />
1 Charité-Universitätsmedizin Berlin<br />
2 Universität Zürich<br />
nina.knoll@charite.de<br />
Fragestellung: Die Forschung <strong>zur</strong> sozialen Unterstützung betont traditionell<br />
deren protektiven Wert in Stresssituationen. Aus einer proaktiven, handlungsorientierten<br />
Perspektive werden sozialer Unterstützung jedoch zusätzliche<br />
Funktionen zugeschrieben. Unterstützungsgeber werden hier als Vorbilder und<br />
Ratgeber definiert, die die adaptiven Fähigkeiten und somit die Selbstwirksamkeitserwartungen<br />
des Unterstützten stärken (Enabling Hypothese). In dieser<br />
Studie wurden verschiedene Aspekte sozialer Unterstützung als Korrelate der<br />
Veränderung der Selbstwirksamkeit bei Prostatektomie-Patienten und deren<br />
Partnerinnen über ein Jahr perioperativ untersucht.<br />
Methode: Zweiundsiebzig Patienten (N = 61.2 Jahre, S = 6.03) und deren<br />
Partnerinnen (M = 58.1 Jahre, S = 7.49) wurden prä- und ein Jahr postoperativ<br />
befragt. Beider Partner Selbstwirksamkeitserwartungen und erhaltene partnerschaftliche<br />
Unterstützung sowie die durch den Patienten mobilisierte Unterstützung<br />
wurden zu beiden Messzeitpunkten erfasst. Beeinträchtigung durch<br />
Harninkontinenz und sexuelle Dysfunktionen der Patienten sowie Partnerschaftszufriedenheit<br />
wurden als zusätzliche Kovariaten berücksichtigt.<br />
Ergebnisse: Die von den Patienten berichtete erhaltene Unterstützung war<br />
querschnittlich, jedoch nicht längsschnittlich mit der Selbstwirksamkeit der<br />
Patienten assoziiert. Während die von den Partnerinnen berichtete erhaltene<br />
partnerschaftliche Unterstützung nicht mit deren eigener Selbstwirksamkeit<br />
korrelierte, sagte die vom Patienten berichtete mobilisierte Unterstützung<br />
sowohl das Niveau als auch die Veränderungen der Selbstwirksamkeit der<br />
Partnerinnen positiv vorher.<br />
Diskussion: Die Annahme einer Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartungen<br />
durch den Erhalt von Unterstützung (Enabling Hypothese) wurde<br />
durch die Ergebnisse nicht gestützt. Hingegen deuten die Befunde darauf hin,<br />
dass potenzielle Unterstützungsgeber hinsichtlich ihrer Selbstwirksamkeitserwartungen<br />
davon profitieren könnten, um Hilfe gebeten zu werden.<br />
Keywords:<br />
soziale Unterstützung, Paare, Prostatektomie<br />
24
Belastungsbewältigung im Alltag:<br />
Die Bedeutung sozialer Unterstützung<br />
Anton-Rupert Laireiter & Margit Hamminger<br />
Universität Salzburg/Fachbereich Psychologie<br />
anton.laireiter@sbg.ac.at<br />
Fragestellung: Alltagsbelastungen sind wichtige Determinanten psychischer und<br />
somatischer Gesundheit; sie beeinflussen auf vielfältige Weise das subjektive<br />
Wohlbefinden und die Lebensqualität. Verschiedene Arbeiten weisen auch auf<br />
die Bedeutung dieser Erfahrungen für die Ätiologie psychischer und organischer<br />
Störungen hin. Es ist daher wichtig, die Regulation und Bewältigung derartiger<br />
Ereignisse zu untersuchen.<br />
Methode: In dem Beitrag wird über eine Studie berichtet, in der Alltagsbelastungen<br />
mittels eines vom Autor entwickelten Tagebuches <strong>zur</strong> Bewältigung<br />
von Alltagsbelastungen (TBB) über einen Zeitraum von 20 bis 25 Tagen erhoben<br />
wurden. Neben stressrelevanten Einschätzungen und Belastungsemotionen<br />
hatten die Probanden (N = 62; 1.250 Episoden) auch über das eingesetzte<br />
Bewältigungsverhalten und die erhaltene Unterstützung zu berichten.<br />
Ergebnisse: In der Beobachtungszeit wurden Belastungen in größerer<br />
Intensität vor allem in sozialen Beziehungen, dem Arbeits- und dem Freizeitbereich<br />
berichtet. Zur Bewältigung wurde primär kognitives und aktives<br />
Problemlöseverhalten eingesetzt, gefolgt von palliativen und defensiven<br />
Strategien. In knapp einem Drittel der Episoden wurde Soziale Unterstützung in<br />
Anspruch genommen, sowohl psychologische wie auch instrumentelle, die im<br />
Schnitt als sehr hilfreich und effektiv beurteilt wurde. Weiterführende Analysen<br />
zeigen, dass aktives und kognitives Bewältigungsverhalten und insbesondere<br />
der Erhalt instrumenteller Unterstützung mit verschiedenen Outcome-Variablen<br />
der Belastungsepisoden positiv korrelieren, was die Hypothese bestätigt, dass<br />
bestimmte Bewältigungs- und Unterstützungsformen für die Bewältigung von<br />
Alltagsereignissen von besonderer Bedeutung sind.<br />
Keywords:<br />
Alltagsbelastungen, Bewältigung, Soziale Unterstützung<br />
25
Optimismus und die Bereitschaft zu sozialer<br />
Unterstützung aus der Geberperspektive<br />
Manja Vollmann 1 , Britta Renner 2 , Katrin Matiba 1 & Hannelore<br />
Weber 1<br />
1 Universität Greifswald<br />
2 Jacobs University Bremen<br />
vollmann@uni-greifswald.de<br />
Fragestellung: Optimismus gilt als bedeutender Prädiktor für die physische und<br />
psychische Gesundheit insbesondere bei der Konfrontation mit stresshaften<br />
Situationen. Als potenzieller Mediator dieses Zusammenhangs wird die soziale<br />
Unterstützung diskutiert. Dabei wird angenommen, dass Optimisten im Vergleich<br />
zu Pessimisten mehr soziale Unterstützung <strong>zur</strong> Verfügung gestellt wird.<br />
In drei Studien wurde diese Annahme geprüft und die sozialen Reaktionen auf<br />
Optimisten, Pessimisten und Realisten untersucht.<br />
Methode: Den Probanden (N = 240, N = 120, N = 168) wurden Audioaufnahmen<br />
bzw. Vignetten von Gesprächen präsentiert, in denen ein Target<br />
optimistisches, pessimistisches bzw. realistisches Bewältigungsverhalten in<br />
einer Stresssituation zeigt. Im Anschluss wurden per Fragebogen a) die Bewertung<br />
des Verhaltens und der Persönlichkeit des Targets, b) die Sympathie<br />
gegenüber dem Target, sowie c) die Bereitschaft zu sozialer Unterstützung erfasst.<br />
Ergebnisse: Optimistische und realistische Targets lösten sehr ähnliche<br />
soziale Reaktionen aus. In Bezug auf das Verhalten, die Persönlichkeit sowie<br />
die Sympathie wurden optimistische und realistische Targets im Vergleich zu<br />
pessimistischen Targets grundsätzlich positiver bewertet. Allerdings zeigten<br />
sich keine Unterschiede hinsichtlich der Bereitschaft zu sozialer Unterstützung.<br />
Die deutlich positivere Bewertung von Optimisten und Realisten geht also nicht<br />
mit einer höheren Unterstützungsbereitschaft einher.<br />
Fazit: Der Zusammenhang zwischen Optimismus und Gesundheit wird<br />
möglicherweise nicht nur über die vom sozialen Umfeld <strong>zur</strong> Verfügung gestellte<br />
Unterstützung, sondern auch durch den Ausdruck sozialer Akzeptanz vermittelt.<br />
Literatur:<br />
Vollmann, M., Renner, B. & Weber, H. (in press). Optimism and social support: The providers'<br />
perspective. Journal of Positive Psychology.<br />
Keywords:<br />
Optimismus, soziale Unterstützung, Geberperspektive<br />
26
Symposium 3: Theorie des geplanten Verhaltens und<br />
Erweiterungen (Organisation: B. Dohnke & M. Sieverding)<br />
Prototype-Distancing in der Theorie des geplanten<br />
Verhaltens: Vorhersage der Rauchstopp-Intention<br />
Birte Dohnke 1 , Edith Weiß-Gerlach 2 & Claudia D. Spies 2<br />
1<br />
Charité - Zentrum für Geschlechterforschung in der Medizin<br />
2<br />
Charité - Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin<br />
birte.dohnke@charite.de<br />
Fragestellung: Die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) wurde gewählt, um<br />
soziale Faktoren für die Rauchstopp-Intention zu untersuchen (vgl. Rivis &<br />
Sheeran, 2003). Denn soziale Einflüsse sind hier bekanntermaßen bedeutsam:<br />
Einerseits fördert sozialer Druck mit dem Rauchen aufhören zu sollen eine<br />
Reduktion des Rauchverhaltens. Andererseits fördert die psychologische<br />
Distanzierung vom typischen Raucher (d. h. Raucher-Prototypen) den Aufhörprozess.<br />
Da Rauchen traditionell als männliches Verhalten galt und Frauen<br />
häufig stärkeren sozialen Druck wahrnehmen, jedoch langfristig weniger davon<br />
profitieren als Männer, wurden Geschlechterrolleneigenschaften <strong>zur</strong> Beschreibung<br />
des Raucher-Prototyps gewählt und geschlechtergetrennte Analysen<br />
durchgeführt.<br />
Methode: An der Studie nahmen 298 erwachsene Rauchende (48 %<br />
Frauen) teil. Erfasst wurden Einstellungen, wahrgenommene Verhaltenskontrolle<br />
und subjektive Normen in Bezug auf einen Rauchstopp. Die Beschreibung<br />
des Raucher-Prototyps erfolgte anhand maskuliner und femininer<br />
Eigenschaften (PAQ). Die Ähnlichkeit wurde über die Diskrepanz zu den<br />
eigenen Eigenschaftsprofilen bestimmt.<br />
Ergebnisse: Zunächst sagten die TPB-Variablen die Rauchstopp-Intention<br />
vorher. Höhere subjektive Normen waren allerdings nur bei Frauen mit einer<br />
stärkeren Intention verbunden. Darüber hinaus trugen die beiden Prototypen-<br />
Variablen <strong>zur</strong> Vorhersage bei. Eine maskuline Prototypen-Beschreibung und<br />
eigene Unähnlichkeit hing jedoch nur mit der Intention von Frauen zusammen,<br />
eine feminine Prototypen-Beschreibung und eigene Unähnlichkeit nur mit der<br />
Intention von Männern.<br />
Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Rolle sozialen Drucks sowie<br />
psychologischer Distanzierungsprozesse für die Rauchstopp-Motivation von<br />
Frauen und Männern diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Rivis, A. & Sheeran, P. (2003). Social influences and the theory of planned behaviour: Evidence<br />
for a direct relationship between prototypes and young people's exercise behaviour.<br />
Psychology & Health, 18, 567-583.<br />
Keywords:<br />
Theorie des geplanten Verhaltens, Prototype Distancing, Rauchen<br />
27
Die Theory of Planned Behavior und HIV-Schutzverhalten<br />
von Männern:<br />
Anwendung und Erweiterung des Modells<br />
Daniel Gredig, Sibylle Nideröst & Anne Parpan-Blaser<br />
<strong>Hochschule</strong> für Soziale Arbeit, FH Nordwestschweiz<br />
daniel.gredig@fhnw.ch<br />
Fragestellung: Die Theory of Planned Behavior ist im Zusammenhang mit HIV-<br />
Schutzverhalten oft geprüft worden. Systematische Reviews zeigen auf, dass<br />
die im Modell berücksichtigten Variablen signifikante Prädiktoren von HIV-<br />
Schutzverhalten darstellen. Sie lassen aber auch erkennen, dass sich die Erklärungskraft<br />
des Modells als limitiert erweist und bislang noch nicht auf das<br />
HIV-Schutzverhalten von heterosexuellen Männern in westlichen Gesellschaften<br />
angewandt wurde.<br />
Die hier vorgestellte Untersuchung prüfte deshalb, ob sich die TPB als Erklärungsmodell<br />
für den Kondomgebrauch von 25- bis 65 jährigen heterosexuellen<br />
Männern aus der deutschsprachigen Schweiz bewährt. Ferner prüfte<br />
sie, ob sich die Erklärungskraft der TPB durch den Einbezug der Variable der<br />
somatischen Kultur erhöhen lässt.<br />
Methode: Im Abstand von 6 Monaten wurden zwei Wellen von CATI mit<br />
982 Männern geführt, deren Telefonnummern in einem Zufallsalgorithmus aus<br />
dem elektronischen Telefonbuch gezogen wurden. Die statistische Prüfung umfasste<br />
bivariate Korrelationsanalysen, multiple Regressionsanalysen, hierarchische<br />
logistische Regressionsanalysen und eine Kovarianzanalyse.<br />
Ergebnisse: Es zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der<br />
Intention und dem Kondomgebrauch beim letzten Erstkontakt. Die wahrgenommene<br />
Verhaltenskontrolle und die Einstellung zum Kondomgebrauch<br />
erweisen sich als signifikante Prädiktoren der Intention. Die subjektive Norm ist<br />
kein signifikanter Prädiktor. Die Erklärungskraft des Modells beträgt 36 %.<br />
Wird das Modell um die Variable „somatische Kultur“ ergänzt, erweisen<br />
sich wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Einstellung und somatische Kultur<br />
als signifikante Prädiktoren der Intention. Die Erklärungskraft des Modells erhöht<br />
sich auf 45 %.<br />
Keywords:<br />
TPB-Modell, HIV/AIDS, Somatische Kultur<br />
28
TPB- und Prototypvariablen in Zusammenhang mit der<br />
Teilnahme an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen<br />
Monika Sieverding, Uwe Matterne & Liborio Ciccarello<br />
Universität Heidelberg, Psychologisches Institut<br />
monika.sieverding@psychologie.uni-heidelberg.de<br />
Fragestellung: Im Rahmen des Forschungsprojektes „Psychologische Determinanten<br />
der (Nicht-) Inanspruchnahme von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen<br />
(KFU) bei Männern“ gehen wir der Frage nach, welche Rolle die<br />
klassischen Variablen der Theory of Planned Behaviour (TPB) sowie soziale<br />
Einflüsse für die Motivation und Inanspruchnahme von KFUen spielen.<br />
Methode: Drei Gruppen von Männern wurden befragt: regelmäßige KFU-<br />
Teilnehmer, unregelmäßige Teilnehmer, sowie Männer, die bisher noch nie an<br />
einer KFU teilgenommen haben (insgesamt n = 2500, mit einem Durchschnittsalter<br />
von 56 Jahren). Wir erfassten die klassischen TPB-Variablen Einstellungen,<br />
subjektive Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle, darüber<br />
hinaus die deskriptive Norm sowie die Wahrnehmung und Beurteilung des<br />
typischen Mannes, der regelmäßig an einer KFU teilnimmt. Weiterhin wurde die<br />
Intention, im Lauf der nächsten 12 Monate eine KFU machen zu lassen, erhoben.<br />
Nach 12 Monaten wurden die Männer, die bisher noch nie eine KFU<br />
hatten durchführen lassen, die aber angegeben hatten, dass sie darüber nachdenken<br />
oder die feste Absicht dazu haben, noch einmal befragt.<br />
Ergebnisse: Die drei Gruppen unterscheiden sich deutlich in allen psychologischen<br />
Variablen. Über die klassischen TPB-Variablen hinaus kann die<br />
Wahrnehmung des Teilnehmer-Prototypen die erklärte Varianz in der Intention<br />
signifikant erhöhen. Letzteres gilt vor allem für die Männer, die bisher noch bei<br />
keiner KFU waren. Im Follow-Up zeigte sich, dass von 770 (ehemaligen) Nichtteilnehmern<br />
im Lauf der 12 Monate 120 Männer (= 16 %) erstmalig zu einer<br />
KFU gegangen waren. Trotz der Länge des Zeitintervalls zwischen der Erfassung<br />
von Intention und Verhalten, welche in der Regel mit nur noch sehr<br />
geringen Zusammenhängen zwischen Intention und Verhalten einhergeht,<br />
können die Untersuchungsvariablen dazu beitragen, die erstmalige Teilnahme<br />
vorherzusagen.<br />
Keywords:<br />
Theory of Planned Behaviour, Prototyp, Krebsfrüherkennung<br />
29
Theory of Planned Behavior und Prototype Willingness<br />
<strong>zur</strong> Vorhersage des Alkoholkonsums junger Männer<br />
Friederike Zimmermann & Monika Sieverding<br />
Universität Heidelberg, Psychologisches Institut<br />
friederike.zimmermann@psychologie.uni-heidelberg.de<br />
Fragestellung: In unserem Beitrag geht es um die Erklärung des Alkoholkonsums<br />
junger Männer mittels Erweiterungen der Theory of Planned Behavior<br />
(TPB). Zusätzliche potenzielle Prädiktoren wurden vor allem aus dem Prototype-Willingness<br />
Modell (Gibbons, Gerrard, Blanton & Russell, 1998) abgeleitet.<br />
Methode: Junge Männer (vorwiegend Studenten), die beabsichtigten,<br />
einen geselligen Abend zu verbringen, wurden an Freitag- bzw. Samstagnachmittagen<br />
per Fragebogen zu ihren Einstellungen zum Trinken von mehreren<br />
(> 3) Gläsern Alkohol im Verlauf eines geselligen Abends befragt. Neben den<br />
klassischen TPB-Variablen (Einstellungen, subjektive Norm, wahrgenommene<br />
Verhaltenskontrolle bzw. Selbstwirksamkeitserwartungen und Intention) wurden<br />
dabei als zusätzliche Variablen berücksichtigt: Willingness (als zweitem Pfad<br />
neben dem über die Intention vermittelten Weg zum Verhalten), Prototypvariablen<br />
sowohl des Actors als auch des Abstainers sowie die deskriptive<br />
Norm. Zur konservativen Schätzung der aufgeklärten Varianz wurde das<br />
frühere Verhalten einbezogen. Die Ermittlung des Alkoholkonsums an dem<br />
Abend der Befragung wurde am nächsten Wochentag telefonisch vorgenommen.<br />
Es liegen Verhaltensdaten von n = 100 Männern vor.<br />
Ergebnisse: Der selbst berichtete Alkoholkonsum von Männern lässt sich<br />
durch die TPB-Variablen vorhersagen, wobei die Berücksichtigung der zusätzlichen<br />
Variablen die Varianzaufklärung deutlich erhöhen kann. Soziale Einflüsse,<br />
repräsentiert über die subjektive und deskriptive Norm sowie die Wahrnehmung<br />
und Beurteilung von Actor- und Abstainer-Prototypen spielen für den<br />
Alkoholkonsum junger Männer offensichtlich eine entscheidende Rolle.<br />
Keywords:<br />
Theory of Planned Behavior, Prototype Willingness, Alkoholkonsum<br />
30
Symposium 4: Adipositas im Kindes- und Jugendalter<br />
(Organisation: C.-W. Kohlmann, Diskutant: C. Vögele)<br />
Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen mit<br />
Adipositas: Analysen auf der Basis von ärztlichen<br />
Diagnosen<br />
Carl-Walter Kohlmann 1 , Heike Eschenbeck 1 , Stefan Dudey 2 &<br />
Martin Schürholz 2<br />
1<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd, Institut für Humanwissenschaften,<br />
Psychologie<br />
2<br />
Gmünder ErsatzKasse GEK<br />
carl-walter.kohlmann@ph-gmuend.de<br />
Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter stellen ein zunehmendes<br />
gesundheitliches Problem dar. So sind Übergewicht und Adipositas<br />
mit gravierenden medizinischen Problemen sowie negativen Auswirkungen auf<br />
die Lebensqualität und das Befinden verbunden. Im Unterschied zu der Mehrzahl<br />
der Studien zu Adipositas und Lebensqualität, die überwiegend auf ausgewählten<br />
klinischen Stichproben und Selbstberichten basieren, wurden in der<br />
vorliegenden Studie Adipositas und Lebensqualität in einer bevölkerungsbezogenen<br />
Stichprobe von bei einer Ersatzkasse versicherten Kindern und<br />
Jugendlichen (N = 156.948, Alter: 6-14 Jahre) auf der Basis von ICD-10-<br />
Arztdiagnosen operationalisiert. Es wird erwartet, dass das Vorliegen einer ICD-<br />
10-Adipositasdiagnose mit erhöhten Odds Ratios für psychische Störungen als<br />
Indikatoren für Lebensqualität einhergeht. Die Ergebnisse zeigen, dass im Vergleich<br />
zu Kindern und Jugendlichen ohne Adipositasdiagnose die Odds bei<br />
Kindern und Jugendlichen mit Adipositasdiagnose generell erhöht sind.<br />
Während die Beeinträchtigung durch externale Störungen unabhängig vom<br />
Lebensalter ausfällt, steigt sie für internale Störungen (insbesondere Angststörungen)<br />
mit der Pubertät deutlich an. Generell sind Mädchen mit Adipositas<br />
stärker als Jungen mit Adipositas durch externale und internale Störungen belastet.<br />
Keywords:<br />
Adipositas, Geschlecht, Alter<br />
31
Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter:<br />
Die Rolle familiärer Faktoren<br />
Sina Nitzko & Inge Seiffge-Krenke<br />
Johannes Gutenberg-Universität Mainz/Psychologisches Institut<br />
nitzko@uni-mainz.de<br />
Fragestellung: Angesichts der stetig steigenden Prävalenzraten von Übergewicht<br />
und Adipositas im Kindes- und Jugendalter ist die Kenntnis der<br />
Faktoren, welche deren Herausbildung begünstigen, von immenser Bedeutung.<br />
Basierend auf der Annahme einer multifaktoriellen Adipositasgenese werden<br />
sowohl genetische und biologische als auch psychosoziale Faktoren als bedeutungsvoll<br />
erachtet (Warschburger, Petermann & Fromme, 2005). Zu letzteren<br />
zählen die familiären Aspekte, deren Rolle in der Entwicklung von Übergewicht<br />
und Adipositas im Kindes- und Jugendalter in der vorliegenden Studie<br />
näher beleuchtet werden soll. Von besonderem Interesse war die Untersuchung<br />
der Zusammenhänge zwischen verschiedenen familienpsychologischen<br />
Aspekten und dem Ess- und Bewegungsverhalten von Heranwachsenden mit<br />
Übergewicht und Adipositas. Ziele der Studie waren darüber hinaus die Klärung<br />
der moderierenden Rolle des psychischen Wohlbefindens sowie die Identifikation<br />
von Geschlechtsunterschieden in Bezug auf die erfassten familiären<br />
Faktoren.<br />
Methode: 121 übergewichtige und adipöse Schülerinnen und Schüler (10-<br />
16 Jahre) wurden mit Hilfe standardisierter Messinstrumente zu verschiedenen<br />
familienpsychologischen Aspekten (Familienklima, elterliches Erziehungsverhalten)<br />
sowie zu ihrem Essverhalten, Bewegungsverhalten und psychischen<br />
Wohlbefinden befragt.<br />
Ergebnisse: Bezüglich der familiären Konfliktneigung und der kindperzipierten<br />
mütterlichen Unterstützung konnten Zusammenhänge mit dem<br />
Essverhalten identifiziert werden. Generell gab es in Familien mit adipösen<br />
Töchtern mehr Konflikte. Hohe familiäre Konfliktneigung stand des Weiteren in<br />
Beziehung zu den elterlichen Esszwängen. Ein pfadanalytisches Modell diente<br />
der empirischen Prüfung der Gesamtheit der postulierten Zusammenhänge<br />
zwischen familiären Variablen, dem psychischen Wohlbefinden, dem Body-<br />
Mass-Index sowie dem Ess- und Bewegungsverhalten der übergewichtigen und<br />
adipösen Heranwachsenden.<br />
Keywords:<br />
Übergewicht, Adipositas, Jugendalter<br />
32
Prävention kindlicher Adipositas – Entwicklung eines<br />
indizierten Präventionsangebots<br />
Petra Warschburger, Katja Kröller & Dörthe Jahnke<br />
Universität Potsdam<br />
warschb@uni-potsdam.de<br />
Fragestellung: In Deutschland sind bereits 2-3 % der 3- bis 6-jährigen Kinder<br />
adipös. Besonders gefährdet sind v.a. Kinder übergewichtiger Eltern und solche<br />
aus sozial benachteiligten Familien (geringes Einkommen; geringer Bildungsstand).<br />
Erste Studien zeigen, dass diese Risikogruppen durch Präventionsangebote<br />
nur schwer erreicht werden können. Ziel der Studie war es, einerseits<br />
die Beweggründe für eine fehlende Inanspruchnahme von Präventionsangeboten<br />
und andererseits auch die „Wünsche“ an ein solches Angebot zu<br />
erheben, um darauf aufbauend ein indiziertes Präventionsangebot zu entwickeln.<br />
Methode: Durchführung von 41 qualitativen Interviews; darauf aufbauend<br />
standardisierte Fragebogenerhebung (N = 168 und N = 231) <strong>zur</strong> Erhebung von<br />
Risikowahrnehmung, Selbstwirksamkeits- und Handlungsergebniserwartungen.<br />
Ergebnisse: Im Interview äußerten 62 % der Mütter ein solches Angebot<br />
für unwichtig zu halten. Weiterhin nannten sie v.a. Zeit- und Geldmangel sowie<br />
geringes Durchhaltevermögen als Hinderungsgründe. Im 2. Schritt wurden u. a.<br />
die Selbstwirksamkeits- (SW) und Handlungsergebniserwartungen (HE) der<br />
Mütter erfragt. Während sich die Mütter in ihren HE bezogen auf Alter,<br />
Geschlecht und Gewicht des Kindes, ihr eigenes Gewicht sowie bezogen auf<br />
verschiedene soziodemografische Variablen nicht unterschieden, wiesen Mütter<br />
mit einem geringen Bildungshintergrund geringere Selbstwirksamkeitsüberzeugungen<br />
auf (negative Erfahrungen; Aufwand; eigene Belastung). Die<br />
Risikowahrnehmung war nur gering ausgeprägt. Die psychosozialen Folgen von<br />
Adipositas werden selten gesehen. Zurzeit wird das Präventionsangebot mit<br />
einer vor geschalteten Motivierungsphase in einer Pilotstudie getestet; Vorgehen<br />
und erste Ergebnisse werden vorgestellt.<br />
Keywords:<br />
Adipositas, Prävention, Vorschulalter<br />
33
Symposium 5: Subjektives Wohlbefinden in der<br />
<strong>Gesundheitspsychologie</strong>: Erhebungsmethoden und<br />
Anwendungsbeispiele (Organisation: M. Kanning)<br />
Wohlbefinden in Deutschland – Ergebnisse einer<br />
repräsentativen Befragung mit dem FEW-16<br />
Elmar Brähler, Michael Geyer & Cornelia Albani<br />
Universität Leipzig<br />
elmar.braehler@medizin.uni-leipzig.de<br />
Der „Fragebogen <strong>zur</strong> Erfassung des körperlichen Wohlbefindens“ (FEW-16,<br />
Kolip und Schmidt) wurde in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe (573<br />
Befragte in Ostdeutschland und 1900 in Westdeutschland) eingesetzt. In der<br />
untersuchten nicht-klinischen Stichprobe scheint das mit dem FEW-16<br />
operationalisierte Konstrukt „körperliches Wohlbefinden“ eindimensional zu<br />
sein. Frauen und Befragte mit zunehmendem Alter gaben niedrigere Werte für<br />
„körperliches Wohlbefinden“ an. Zusammenhänge zwischen „körperlichem<br />
Wohlbefinden“ und dem Körperbild, erfasst mit dem „Fragebogen zum Körperbild“<br />
(FKB-20), der Lebensqualität („EURO-HIS-QOL“) und Fragen nach der<br />
Besorgtheit um die finanzielle Situation, die Familie und den Gesundheitszustand<br />
liefern Hinweise auf die Validität des Instrumentes.<br />
Keywords:<br />
körperliches Wohlbefinden, Körperbild, Repräsentativbefragung<br />
35
Ambulantes Monitoring als viel versprechendes Verfahren<br />
für die <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
Ulrich Ebner-Priemer<br />
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim<br />
ulrich.ebner-priemer@zi-mannheim.de<br />
Subjektives Wohlbefinden als eine der Zielvariablen der <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
wird zumeist über Fragebogenverfahren erfasst. Dies ist nicht unproblematisch.<br />
Wie aus der Gedächtnisforschung bekannt, ist der Abruf von<br />
Informationen ein aktiver Rekonstruktionsprozess, der die Erinnerung an vergangene<br />
Erfahrungen beeinflusst. Dieser als retrospektiver Verzerrungseffekt<br />
bezeichnete Prozess ist für alle Forschungsbereiche bedeutsam, die retrospektiv<br />
subjektive Daten erheben, speziell jedoch für die <strong>Gesundheitspsychologie</strong>,<br />
da diese Verzerrung sich in Gesunden und Kranken unterschiedlich<br />
manifestiert. Neben anderen, sind vor allem zwei systematische Verzerrungseffekte<br />
nachgewiesen: Der affective valence effect zeigt, dass positives Material<br />
prinzipiell besser erinnert wird, wohingegen der mood congruent memory effect<br />
zeigt, dass der Abruf emotionaler Inhalte von der gegenwärtigen Stimmungslage<br />
abhängig ist. Ambulantes Monitoring versucht, diese Verzerrungseffekte zu<br />
vermeiden. Dazu werden Selbstberichte, Verhaltensweisen oder physiologische<br />
Messwerte mit computerunterstützten Methoden erfasst, d. h. während die<br />
Untersuchten ihrem normalen Tageslauf nachgehen. Methodenvorteile sind<br />
hierbei die Erfassung in Echtzeit ohne retrospektive Verzerrungen im normalen<br />
Alltag der Probanden, die Möglichkeit <strong>zur</strong> multimodalen Operationalisierung von<br />
Gesundheit (psychologische und physiologische Vorgänge), sowie die Erfassung<br />
von Prozessen und die Kontextabhängigkeit von Wohlbefinden und<br />
Gesundheit. Am Beispiel einer Patientengruppe (Borderline-Persönlichkeitsstörung)<br />
werden an eigenen Untersuchungen exemplarisch folgende Aspekte<br />
aufgezeigt: Qualitativ unterschiedliche retrospektive Verzerrung bei Patienten<br />
im Vergleich zu Gesunden, multimodales Assessment und psychophysiologische<br />
Zusammenhänge von Stress und Wohlbefinden sowie deren intraindividuellen<br />
Prozesse und Kontextabhängigkeit.<br />
Keywords:<br />
Ambulantes Monitoring, Alltag, subjektives Wohlbefinden<br />
36
Beeinflussbarkeit des subjektiven Wohlbefindens:<br />
Fühlen sich Sportler wohler?<br />
Martina Kanning<br />
Universität Stuttgart, Institut für Sportwissenschaft<br />
martina.kanning@sport.uni-stuttgart.de<br />
Körperliche Aktivitäten können sich positiv auf das subjektive Wohlbefinden<br />
(SWB) auswirken. Zudem wird diskutiert, dass eine Person ihr SWB positiv beeinflussen<br />
kann, indem sie sich persönlich relevante Ziele setzt und diese verfolgt.<br />
Anhand einer Längsschnittuntersuchung soll untersucht werden, ob der<br />
Effekt von körperlicher Aktivität auf das SWB durch das Ausmaß beeinflusst<br />
wird, inwieweit eine Person selbst bestimmt (autonom) ihre körperliche Aktivität<br />
auswählt.<br />
16 Einzelpersonen, die nach ihrem Lebensstil (Hochkultur-, Spannungs-<br />
und Trivialschema), ihrem Wohnort (städtisches vs. ländliches Wohnumfeld),<br />
ihrer formalen Bildung und nach demografischen Faktoren ausgewählt wurden,<br />
nahmen an der Längsschnittuntersuchung teil. Die 16 Probanden wurden ein-<br />
bis dreimal täglich über 10 Wochen zu ihrem aktuellen Befinden (MDBF)<br />
während und nach einer individuell ausgewählten Tätigkeit befragt. Außerdem<br />
wurde erfasst, in welchem Ausmaß, die Pbn die jeweilige Tätigkeit selbst bestimmt/autonom<br />
durchführten (vgl. intrinsisch vs. extrinsisch motiviert). Die<br />
Daten werden mit Hilfe einer bivariaten Zeitreihenanalyse (ARIMA) ausgewertet.<br />
Von 8 Personen kann eine komplette Zeitreihe über den 10-wöchigen<br />
Untersuchungszeitraum erstellt werden. Beispielhaft werden die Ergebnisse<br />
anhand einzelner ausgewählter Zeitreihen dargestellt. Das Ausmaß an Autonomie<br />
der jeweils ausgewählten Tätigkeiten zeigt einen white-noise Prozess<br />
und somit keine internen Abhängigkeitsstrukturen. Das momentane Befinden<br />
weist einen autoregressiven Prozess erster Ordnung auf (ARIMA (1,0,0). Bei<br />
einer bivariaten Betrachtung der beiden Variablen erweist sich das Ausmaß an<br />
Autonomie als Prädiktor für das momentane Wohlbefinden.<br />
Keywords:<br />
Subjektives Wohlbefinden, körperliche Aktivität, Zeitreihenanalyse<br />
37
Affective well-being in elderly people: A new computerbased<br />
ambulatory assessment approach in daily life<br />
Michael Reicherts & Christian Maggiori<br />
University of Fribourg/Switzerland<br />
michael.reicherts@unifr.ch<br />
Emotions, affective experiences and well-being are considered as important<br />
indicators both for physical and psychological health or disorders. Affective patterns<br />
are candidates for life span changes Thompson (1988), and in the last<br />
decade more attention has been paid to the developmental course of emotion<br />
from adulthood into old age (e.g., Carstensen & Charles, 2003 Lawton, 2001).<br />
However, a number of questions on emotional experience and its links with<br />
general quality of life (QoL), subjective health and loneliness, for example, remain<br />
open.<br />
The aim of this study is to investigate emotional/affective states of youngolds<br />
(60-75 years old) using a new computer-based monitoring approach<br />
(“Learning Affect Monitor” – LAM; Reicherts, Salamin, Maggiori & Pauls, 2005)<br />
and the link with QoL’s dimensions and affective well-being. The LAM represents<br />
an ambulatory self-monitoring system for daily assessment of affective<br />
experiences, which combines a quantitative approach based on three basic dimensions<br />
(valence, activation and intensity) with a more qualitative approach<br />
according to basic emotions (a list of 30 descriptors of emotions). Physical wellbeing,<br />
the actual activity and social context are also recorded through this timesampling<br />
approach.<br />
The study presents data of N = 72 young-olds, recorded using the LAM<br />
during seven consecutive days, with 6 recordings per day. Participants also answered<br />
a number of self-report questionnaires, e.g., on QoL, social integration<br />
and loneliness, personality, alexithymia, emotional openness or depression,<br />
assessed at the pre- and post-monitoring session. Reliability measures indicate<br />
high reliability and user acceptance in the elderly users. We also compared<br />
young-olds with adults to assess possible age differences in affective life.<br />
Based on 2650 records, the parameters of the Learning Affect Monitor indicate<br />
a well-preserved daily affective experience in young-olds: their affective<br />
experiences are rather similar to those of adult subjects (control sample). However,<br />
older people evaluated their affective daily life as being more positive than<br />
adults. Results show also associations between affective valence and physical<br />
symptoms, with loneliness, isolation, family relations or perceived autonomy.<br />
Positive affective experiences in everyday life are positively correlated with psychological<br />
and global quality of life, subjective health and satisfaction with life.<br />
Implications of daily life, computer-based, monitoring data, and their use as<br />
well-being indicators will be discussed.<br />
Keywords:<br />
Young olds, ambulatory assessment, QoL<br />
38
Symposium 6: Psychokardiologie – Soziale Unterstützung,<br />
psychisches Wohlbefinden und die Relevanz<br />
von Geschlechtsunterschieden<br />
(Organisation: H. Spaderna, Diskutantin: G. Weidner)<br />
Zwei Facetten sozialer Einflüsse auf die Herzgruppenteilnahme:<br />
Soziale Unterstützung und soziale Unterminierung<br />
Birte Dohnke 1 , Sabine Plonait 2 , Brigitte Hartges 2 & Natascha Hess 2<br />
1<br />
Charité / Zentrum für Geschlechterforschung in der Medizin<br />
2<br />
Rehazentrum Rankestraße<br />
birte.dohnke@charite.de<br />
Fragestellung: Soziale Einflüsse wie soziale Unterstützung spielen eine wichtige<br />
Rolle für die Aufnahme und Aufrechterhaltung von Gesundheitsverhalten. Dies<br />
trifft jedoch für Frauen und Männer nicht unbedingt in gleichem Maße zu: So<br />
profitieren Männer häufig stärker von sozialer Unterstützung. Frauen hingegen<br />
scheinen eher durch andere, negative soziale Einflüsse beeinflusst zu sein. Die<br />
vorliegende Studie berücksichtigt diese zweite Facette sozialer Einflüsse über<br />
das Konstrukt soziale Unterminierung, d. h. untergrabendes Verhalten i.S. von<br />
Hindern am oder Erschweren von Gesundheitsverhalten. Untersucht wird die<br />
geschlechtsspezifische Bedeutung von sozialer Unterstützung und sozialer<br />
Unterminierung für die Herzgruppenteilnahme.<br />
Methode: Es wurden 108 Teilnehmende einmalig befragt. Die 34 Frauen<br />
waren mit 60 Jahren durchschnittlich fünf Jahre jünger als die 74 Männer.<br />
Weder die Verteilung der Teilnahmeindikation noch die Teilnahmedauer<br />
(M = 3.0, SD = 1.6) unterschieden sich zwischen den Geschlechtern. Erfasst<br />
wurden HAPA-Variablen sowie soziale Unterstützung und soziale Unterminierung<br />
jeweils durch PartnerIn und Umfeld. Als abhängige Variablen dienten<br />
Einschätzungen der Teilnahmeintention, -gewohnheit und Fehltermine.<br />
Ergebnisse: Keine der unabhängigen und abhängigen Variablen unterschieden<br />
sich zwischen den Geschlechtern. Beide Geschlechter berichteten<br />
mehr soziale Unterstützung als soziale Unterminierung. Nur die soziale Unterminierung<br />
trug jedoch <strong>zur</strong> Vorhersage der drei abhängigen Variablen bei. Wie<br />
erwartet, moderierte das Geschlecht die Vorhersagen: Geringe soziale Unterminierung<br />
durch die Partnerin war nur bei Männern mit weniger Fehlterminen<br />
verbunden. Geringe soziale Unterminierung durch das Umfeld hingegen stärkte<br />
nur bei Frauen sowohl die Teilnahmeintention als auch die Gewohnheitsbildung.<br />
Diskussion: Die Rolle der beiden sozialen Einflussfaktoren wird unter Berücksichtigung<br />
der Faktoren Quelle, Stadium der Verhaltensänderung und<br />
Geschlecht diskutiert.<br />
Keywords:<br />
soziale Unterstützung, soziale Unterminierung, körperliche Aktivität<br />
39
Psychosoziale Risikofaktoren für den Verlauf nach<br />
einer Bypass-Operation: Ein Geschlechtervergleich<br />
Friederike Kendel 1 , Elke Lehmkuhl 2 & Vera Regitz-Zagrosek 2<br />
1<br />
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Institut für Medizinische Psychologie<br />
2<br />
Deutsches Herzzentrum Berlin<br />
friederike.kendel@charite.de<br />
Fragestellung: Seit einigen Jahren ist bekannt, dass Frauen nach einer Bypass-<br />
Operation (CABG) eine wesentlich geringere subjektive Lebensqualität als<br />
Männer angeben. Mit diesem Befund korrespondiert eine um das 2-3fach<br />
höhere Mortalitätsrate. Dieser Geschlechterunterschied wurde durch die Adjustierung<br />
mit bekannten medizinischen Risikofaktoren bislang nur teilweise<br />
aufgeklärt. Ziel der Studie war deshalb die Erforschung von psychosozialen<br />
Risikofaktoren und perioperativen Belastungen auf die subjektive Lebensqualität<br />
und Mortalität nach CABG.<br />
Methode: 579 konsekutive Patienten (21 % Frauen), die sich einer<br />
koronaren Bypass-Operation unterzogen, nahmen an einer prospektiven<br />
Längsschnittstudie mit drei Messzeitpunkten (Baseline, zwei Monate und 1 Jahr<br />
nach CABG) teil, die derzeit am Deutschen Herzzentrum Berlin durchgeführt<br />
wird. Mittels Fragebogen wurden psychosoziale Variablen erhoben, ergänzt<br />
durch dokumentierte klinische Parameter. Ergebnisse: Frauen waren durchschnittlich<br />
5 Jahre älter (M = 69,5) als Männer und wiesen ein ungünstigeres<br />
Risikofaktorenprofil (Euroscore, p
„Warten auf ein neues Herz“: Erste Befunde zu wahrgenommener<br />
sozialer Unterstützung und Gesundheitsverhalten<br />
bei Herztransplantationskandidaten<br />
Heike Spaderna 1 , Daniela Zahn 1 , Theresa Rebelein 1 , Heinz Walter<br />
Krohne 1 & Gerdi Weidner 2<br />
1<br />
Johannes Gutenberg-Universität Mainz<br />
2<br />
Preventive Medicine Research Institute, Sausalito, CA, USA<br />
spaderna@uni-mainz.de<br />
Fragestellung: Ausreichende soziale Unterstützung (SU) gilt als wichtige<br />
Voraussetzung für Patienten, die für eine Herztransplantation angemeldet<br />
werden. Im Rahmen der Studie „Warten auf ein neues Herz“ wird die Relevanz<br />
unterschiedlicher Arten von wahrgenommener SU für Ernährung, Trinkmenge<br />
und körperliche Aktivität bei neu gelisteten Patienten untersucht.<br />
Methode: Von April 2005 bis Januar 2007 bearbeiteten 244 Männer und<br />
57 Frauen (53.1±11.1 Jahre) aus 17 Kliniken unter anderem Fragebogen zu<br />
drei Arten SU (1. generelle emotionale SU; 2. SU für gesunde Ernährung, 3.SU<br />
für körperliche Aktivität), zu Depressivität sowie zu vier Aspekten des Gesundheitsverhaltens<br />
(Häufigkeit des Verzehrs salzhaltiger Lebensmittel und ungünstiger<br />
Fettsäuren, tägliche Trinkmenge, körperliche Aktivitäten). Objektive<br />
Marker der Krankheitsschwere lieferte Eurotransplant.<br />
Ergebnisse: Verheiratete erzielten in allen drei Arten von SU höhere Werte<br />
als Unverheiratete. Geschlechtsunterschiede fanden sich diesbezüglich nur für<br />
emotionale SU. Hier erzielten Frauen höhere Werte und nur bei ihnen war<br />
emotionale SU positiv mit der Krankheitsschwere assoziiert. Bivariat war bei<br />
Frauen höhere emotionale SU mit ungünstiger Ernährung verbunden (mehr<br />
Salz, ungünstige Fettsäuren und größere Trinkmenge), bei Männern dagegen<br />
mit weniger Salzkonsum. Erste Analysen zum Zusammenhang von SU mit Ernährung<br />
und Trinkmenge unter Kontrolle von Alter, Krankheitsschwere, Body-<br />
Mass-Index und Depressivität stützten diese Befunde (signifikante Interaktionen<br />
Geschlecht × emotionale SU). Unabhängig vom Geschlecht war dagegen<br />
körperliche Aktivität negativ mit emotionaler SU und tendenziell positiv mit SU<br />
für körperliche Aktivität verbunden. Verschiedene Arten von SU scheinen somit<br />
je nach Gesundheitsverhalten unterschiedlich relevant. Die Rolle des<br />
Geschlechts und möglicher vermittelnder Variablen werden diskutiert.<br />
Keywords:<br />
Soziale Unterstützung, Gesundheitsverhalten, Herztransplantation<br />
41
„Warten auf ein neues Herz“: Psychosoziale Variablen<br />
bei Herztransplantationskandidaten (HTX) in Abhängigkeit<br />
von der Diagnose<br />
Daniela Zahn 1 , Heike Spaderna 1 , Jacqueline Smits 2 , Heinz Walter<br />
Krohne 1 & Gerdi Weidner 3<br />
1<br />
Johannes Gutenberg Universität Mainz<br />
2<br />
Eurotransplant International Foundation, Leiden, NL<br />
3<br />
Preventive Medicine Research Institute Sausalito, CA, USA<br />
zahnd@uni-mainz.de<br />
Fragestellung: Bislang ist wenig untersucht, ob sich Kandidaten für eine Herztransplantation<br />
verschiedener Grunderkrankungen in psychosozialen Merkmalen<br />
unterscheiden. Erste Studien deuten höhere Depressivitätswerte bei<br />
Patienten mit ischämischer Kardiomyopathie (IKMP) im Vergleich zu Patienten<br />
mit idiopathischer dilatativer Kardiomyopathie (DKMP) an [Zipfel et al. (2002).<br />
Psychosomatic Medicine, 64, 740-747]. Im Rahmen der multizentrischen Studie<br />
soll überprüft werden, ob sich IKMP-Patienten hinsichtlich Depressivität, Angst,<br />
Ärger und sozialer Unterstützung von DKMP-Patienten unterscheiden.<br />
Methode: 148 DKMP (18 % Frauen) und 115 IKMP-Patienten (13 %<br />
Frauen) bearbeiteten kurz nach Aufnahme auf die HTX-Warteliste einen Fragebogen,<br />
der u. a. subjektiven Gesundheitszustand, Angst und Depressivität<br />
(HADS), soziale Unterstützung und Integration (ESSI) sowie Trait-Ärger und<br />
Ärgerausdruck (STAXI) erfasste. Die medizinischen Daten (z. B. LVEF,<br />
VO2max) lieferte Eurotransplant.<br />
Ergebnisse: IKMP-Patienten waren älter und eher verheiratet als DKMP-<br />
Patienten (alle p < .001). In der Krankheitsschwere unterschieden sich die<br />
Gruppen nicht. IKMP-Patienten berichteten häufiger Angstwerte oberhalb des<br />
Cutoffs für klinisch relevante Symptome, eine geringere Netzwerkgröße, mehr<br />
Anger-In (alle p < .05) sowie tendenziell mehr Depressivität und Ärger als<br />
DKMP-Patienten. Drei 2 (Geschlecht) x 2 (Diagnose) ANOVAs für Angst,<br />
Anger-In und Netzwerkgröße ergaben nach Kontrolle von Alter und Familienstand<br />
nur jeweils Interaktionen von Geschlecht und Diagnose für Angst<br />
(p < .05) und Anger-In (p = .06). IKMP-Frauen berichteten weniger Angst bzw.<br />
Anger-In als DKMP-Frauen, IKMP-Männer erzielten höhere Angst- und Anger-<br />
In-Werte als DKMP-Männer.<br />
Fazit. IKMP-Patienten sind zwar insgesamt stärker emotional belastet als<br />
DKMP-Patienten, dabei scheinen jedoch besonders IKMP-Männer mehr<br />
negative Emotionen zu berichten. Inwiefern diese Subgruppe eine schlechtere<br />
Prognose aufweist, werden zukünftige Analysen zeigen.<br />
Keywords:<br />
ischämische Kardiomyopathie, psychosoziale Variablen, Herztransplantation<br />
42
Podiumsdiskussion<br />
Professionalisierung in der Gesundheitgsförderung<br />
(Leitung: R. Hornung)<br />
In einer interdisziplinär besetzten Expertenrunde diskutiert Rainer Hornung<br />
(Universität Zürich, Sozial- und <strong>Gesundheitspsychologie</strong>) Fragen <strong>zur</strong> Professionalisierung<br />
in der Gesundheitsförderung mit Alexa Franke (Universität<br />
Dortmund, Rehabilitationswissenschaften), Gerd Glaeske (Universität Bremen,<br />
Zentrum für Sozialpolitik), Jochen Haisch (Universität Ulm, Allgemeinmedizin),<br />
Gert Kaluza (GKM-Institut Marburg) und Thomas Schürholz (Gmünder<br />
ErsatzKasse GEK, Medizinisches Versorgungsmanagement).<br />
43
Forschungsreferate<br />
Kognitive Gesundheitsförderung bei Älteren durch<br />
Bewegung – Forschungsstand und Forschungsperspektiven<br />
Henning Allmer<br />
Deutsche Sporthochschule Köln<br />
allmer@dshs-koeln.de<br />
Fragestellungen: Für den altersabhängigen Verlauf der kognitiven Leistungsfähigkeit<br />
ist kennzeichnend, dass mit zunehmendem Alter die Leistungen ganz<br />
unterschiedlicher kognitiver Parameter (wie Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und<br />
Denkleistungen) abnehmen. Vor diesem Hintergrund werden zwei Fragestellungen<br />
behandelt: Welche Bedingungen führen zu Veränderungen der<br />
kognitiven Leistungsfähigkeit? Welche Wirkungen haben Interventionsansätze<br />
<strong>zur</strong> Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit?<br />
Methode: Auf der Grundlage einer Literaturanalyse, im Sinne eines<br />
„narrative review“, und den Ergebnissen eigener Forschungsarbeiten ist beabsichtigt,<br />
den Forschungsstand zu beiden Fragestellungen zu reflektieren und<br />
Perspektiven für künftige Forschungsarbeiten deutlich zu machen.<br />
Ergebnisse: In Anlehnung an die MacArthur-Studie (1995) werden die Verringerungen<br />
der kognitiven Leistungsfähigkeit nicht nur mit biologischen Abbauprozessen<br />
erklärt, sondern – entsprechend der `use it or loose it`-Hypothese –<br />
auf das Ausmaß der kognitiven Aktivität und Bewegungsaktivität <strong>zur</strong>ückgeführt.<br />
Die Literaturanalyse <strong>zur</strong> Wirksamkeit kognitiver Interventionen zeigt, dass die<br />
Programme signifikante Verbesserungen der kognitiven Leistungsfähigkeit –<br />
insbesondere der Gedächtnisleistungen – bewirken. Angesichts der widersprüchlichen<br />
Befunde zum Zusammenhang zwischen Bewegungsaktivität und<br />
kognitiver Leistungsfähigkeit wird neueren Forschungsarbeiten folgend die<br />
„selektive kognitive Verbesserungshypothese“ (vgl. Kramer et al., 1999) vertreten<br />
und die Schlussfolgerung gezogen, dass Bewegungsaktivitäten neurophysiologische<br />
Veränderungen hervorrufen, die sich in Verbesserungen spezifischer<br />
kognitiver Leistungsfähigkeiten niederschlagen.<br />
Literatur:<br />
Albert, M.S., Jones, K. & Savage, C.R. (1995). Predictors of cognitive change in older persons:<br />
MacArthur studies of successful aging. Psychology and Aging, 10, 578-589.<br />
Kramer, A.F. et al. (1999). Ageing, fitness and neurocognitive function. Nature, 400, 418-419.<br />
Keywords:<br />
kognitive Leistungsfähigkeit, Bewegungsprävention, Ältere<br />
45
Abhängigkeit der Wahrnehmung schulischer gesundheitsfördernder<br />
Qualitätsmerkmale vom berufsbezogenen<br />
Verhaltens- und Erlebensstil gegenüber<br />
beruflichen Anforderungen<br />
Christine Altenstein, Ulrich Wiesmann & Hans-Joachim Hannich<br />
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Medizinische Psychologie<br />
christine.altenstein@uni-greifswald.de<br />
Fragestellung: Ausgehend von vier verschiedenen arbeitsbezogenen Verhaltens-<br />
und Erlebensmustern konnte Schaarschmidt (2004) nachweisen, dass<br />
Angehörige gesundheitsfördernder Muster (G und S) signifikant mehr Entlastungsfaktoren<br />
in ihrem Umfeld wahrnehmen als Angehörige der Risikomuster<br />
(A und B). In einer eigenen Pilotstudie an 553 Lehrern ergaben sich aus der<br />
Einschätzung von 66 schulischen Qualitätsmerkmalen folgende vier<br />
Dimensionen, die von den Befragten als wichtig und somit potenziell entlastend<br />
für ihre Gesunderhaltung eingeschätzt wurden: Kooperation im Arbeitsumfeld,<br />
Professionalisierung im Umgang mit beruflichen Belastungen, Unterstützung bei<br />
beruflichen Belastungen und Organisation des Schulbetriebes. Ziel der vorliegenden<br />
Untersuchung ist es, Unterschiede zwischen den einzelnen Verhaltens-<br />
und Erlebensmustern hinsichtlich ihrer Wahrnehmung des Vorhandenseins<br />
schulischer gesundheitsfördernder Qualitätsmerkmale zu identifizieren.<br />
Methode: An der vorliegenden Untersuchung nahmen 452 Lehrer/innen<br />
teil. Mit Hilfe des AVEM (Schaarschmidt & Fischer, 2002) und eines im Projekt<br />
„Netzwerk Lehrergesundheit Mecklenburg-Vorpommern“ entwickelten Survey-<br />
Feedback-Instruments wurde die Fragestellung mittels einfaktorieller Varianzanalysen<br />
und t-Tests untersucht.<br />
Ergebnisse: In der Wahrnehmung des Vorhandenseins entlastender<br />
schulischer Merkmale ergaben sich nicht nur die erwarteten Unterschiede<br />
zwischen den gesundheitsfördernden Verhaltensmustern und den Risikomustern,<br />
sondern ebenfalls Unterschiede zwischen den Mustern selbst. So<br />
nehmen Angehörige des Muster G mehr entlastende Merkmale an der Schule<br />
wahr als Angehörige des Muster S und Angehörige des Muster A mehr als bei<br />
Muster B.<br />
Literatur:<br />
Schaarschmidt, U, (2004). Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse<br />
eines veränderungsbedürftigen Zustandes. Weinheim: Beltz.<br />
Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2002). AVEM – Arbeitsbezogenes Verhaltens- und<br />
Erlebensmuster. Frankfurt/M.: Swets & Zeitlinger.<br />
Keywords:<br />
Lehrergesundheit, Wahrnehmung, Qualitätsmerkmale<br />
46
Merkmale lehrergesundheitserhaltender Schulen aus<br />
Sicht der Lehrer<br />
Christine Altenstein, Ulrich Wiesmann & Hans-Joachim Hannich<br />
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Medizinische Psychologie<br />
christine.altenstein@uni-greifswald.de<br />
Fragestellung: Die Gesundheitssituation der Lehrer ist alarmierend. Angehörige<br />
dieser Berufsgruppe zählen <strong>zur</strong> Risikogruppe für die Entwicklung eines Erschöpfungssyndroms<br />
(Burnout), einer Depression oder einer psychosomatischen<br />
Erkrankung (vgl. Hillert & Schmitz, 2004). Die Ursachen sind auf<br />
der Ebene des einzelnen Lehrers, der Schul- sowie der Systemebene zu finden.<br />
Präventionsansätze fokussieren zumeist auf einzelne Belastungsfaktoren,<br />
übergreifende präventive Maßnahmen sind selten. Im Sinne einer Erfolg versprechenden<br />
ressourcenorientierten und partizipativen Organisationsentwicklung<br />
ist es zunächst wichtig zu erfahren, welche Merkmale des Systems<br />
Schule Lehrer als Experten ihrer Arbeitsumwelt wichtig für den Erhalt der<br />
Lehrergesundheit erachten. Zudem stellt sich die Frage, welche Dimensionen<br />
der Einschätzung der Merkmale als wichtig zugrunde liegen.<br />
Methode: In einer Pilotstudie schätzten 553 Lehrer/innen die Wichtigkeit<br />
von 112 schulspezifischen Merkmalen für ihre Gesunderhaltung anhand einer<br />
fünfstufigen Ratingskala ein. Die Items wurden durch die Sichtung der Literatur<br />
<strong>zur</strong> Lehrergesundheit sowie durch die Befragung einer Fokusgruppe generiert.<br />
Mit den 66 am wichtigsten erachteten Merkmalen (M > 4) wurde eine Hauptkomponentenanalyse<br />
(PCA) mit Varimaxrotation durchgeführt (Extraktionskriterium<br />
Eigenwerte > 2).<br />
Ergebnisse: Die Items, die von den Lehrern als äußerst wichtig erachtet<br />
werden, umfassen eher globale Merkmale, wohingegen es sich bei den am<br />
wenigsten wichtig eingeschätzten Items um konkrete, aus Sicht der Belastungsforschung<br />
gesundheitsfördernde entlastende Handlungsoptionen handelt. Die<br />
Faktorenanalyse ergab eine Lösung mit vier Faktoren: Kooperation im Arbeitsumfeld,<br />
Professionalisierung im Umgang mit beruflichen Belastungen, Unterstützung<br />
bei beruflichen Belastungen und Organisation des Schulbetriebes.<br />
Literatur:<br />
Hillert, A. & Schmitz, E. (2004). Psychosomatische Erkrankungen bei Lehrerinnen und Lehrern.<br />
Stuttgart: Schattauer.<br />
Keywords:<br />
Lehrergesundheit, Schule<br />
47
Soziale Unterstützung in Partnerschaften: der Einfluss<br />
von Geben und Nehmen auf die Partnerschaftszufriedenheit<br />
Katja Antoniw & Manja Vollmann<br />
Universität Greifswald<br />
antoniw@uni-greifswald.de<br />
Fragestellung: Soziale Unterstützung gilt auch im Kontext von Paarbeziehungen<br />
als wichtiger Prädiktor für Gesundheit, Wohlbefinden und Zufriedenheit mit der<br />
Partnerschaft. Ziel der vorliegenden Studie war, die bislang vorrangig untersuchte<br />
Perspektive des Unterstützungsempfängers um die Perspektive des<br />
Unterstützungsgebers sowie um die gegenseitigen Austauschprozesse bezüglich<br />
der sozialen Unterstützung zu ergänzen. Dabei sollte vor allem untersucht<br />
werden, (a) inwieweit erhaltene und gegebene Unterstützung die Partnerschaftszufriedenheit<br />
vorhersagen und (b) welchen Vorhersagebeitrag die<br />
Übereinstimmung der Partner bezüglich der erhaltenen und gegebenen Unterstützung<br />
für die Partnerschaftszufriedenheit leistet.<br />
Methode: An dieser Studie nahmen 111 heterosexuelle Paare (N = 222)<br />
teil. Per Fragebogen wurde retrospektiv die vom Partner erhaltene Unterstützung,<br />
die dem Partner gegebene Unterstützung sowie die Zufriedenheit mit<br />
der Partnerschaft erhoben. Dabei wurde zwischen der emotionalen, instrumentellen<br />
und informationellen Unterstützung differenziert.<br />
Ergebnisse: Die eigene Zufriedenheit mit der Partnerschaft stand in einem<br />
positiven Zusammenhang sowohl mit dem Erhalt als auch mit der Gabe<br />
emotionaler Unterstützung. Weiterhin war die eigene Zufriedenheit umso höher,<br />
je mehr emotionale Unterstützung der Partner <strong>zur</strong> Verfügung stellte. Eine<br />
höhere Übereinstimmung zwischen der selbst erhaltenen und der vom Partner<br />
gegebenen Unterstützung trug ebenso wenig <strong>zur</strong> Vorhersage der Partnerschaftszufriedenheit<br />
bei wie eine höhere Übereinstimmung in der vom Partner<br />
erhaltenen und der dem Partner <strong>zur</strong>ückgegebenen Unterstützung (Reziprozität).<br />
Literatur:<br />
Gleason et al. (2003). Daily supportive equity in close relationships. Personality and Social Psychology<br />
Bulletin, 29, 1036-1045.<br />
Väänänen, A. et al. (2005). When it is better to give than to receive: Long-term health effects of<br />
perceived reciprocity in support exchange. Journal of Personality and Social Psychology,<br />
89, 176-193.<br />
Keywords:<br />
soziale Unterstützung, Partnerschaftszufriedenheit, Reziprozität<br />
48
Hat posttraumatische Reifung nach der Diagnose<br />
lebensbedrohender Erkrankungen einen Einfluss auf<br />
die Rekonvaleszenz? Ein Review<br />
Tatjana Barskova & Gabriele Wilz<br />
Technische Universität Berlin – Fachgebiet Klinische und <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
tatjanabarsk@gmx.de<br />
Fragestellung: Unter „posttraumatischer Reifung“ (englisch: posttraumatic<br />
growth, PTG) versteht man in der wissenschaftlichen Literatur tief greifende<br />
Änderungen der Wertsysteme und Orientierungen in verschiedenen Lebensbereichen,<br />
die durch das Erleben eines erschütternden traumatisierenden Ereignisses<br />
getriggert werden können. Die Autoren des vorliegenden Beitrages<br />
führten eine Analyse publizierter empirischer Untersuchungen durch, die das<br />
Thema „Posttraumatische Reifung in den ersten Jahren nach der Diagnose<br />
einer lebensbedrohlichen Erkrankung“ betreffen. Die Analyse fokussierte insbesondere<br />
auf folgende Aspekte: Prädiktoren von PTG in den ersten Jahren<br />
nach der Diagnose, Zusammenhänge zwischen PTG und dem Prozess der Rekonvaleszenz,<br />
Beziehungen zwischen PTG und psychischer Gesundheit.<br />
Methode: Review. Eine umfassende Literaturrecherche erfolgte mit Zugriff<br />
auf drei Datenbanken – PsycINFO, PILOTS und Medline.<br />
Ergebnisse: Die Mehrheit der Studien untersuchte PTG nach der<br />
Diagnose von Krebs, Herzinfarkt, HIV, multiple Sklerosis und rheumatoide<br />
Arthritis. Für wahrgenommene Bedrohtheit, weibliches Geschlecht, den Grad<br />
der emotionalen Involvierung und die Art der kognitiven Verarbeitung ergaben<br />
sich konsistente Assoziationen <strong>zur</strong> posttraumatischen Reifung. Zwischen PTG<br />
und Indikatoren der psychischen Gesundheit zeigten sich inkonsistente Zusammenhänge,<br />
die in Abhängigkeit vom Zeitfenster im Studiendesign variierten:<br />
Ergebnisse aus längsschnittlichen Untersuchungen sprechen für eine positive<br />
Wirkung von PTG auf die psychische Gesundheit der chronisch Kranken, die<br />
allerdings erst nach einer mehrmonatigen Latenzzeit auftritt. Weiterhin lässt die<br />
Gegenüberstellung der Studienergebnisse auf einen positiven Zusammenhang<br />
zwischen PTG und den Indikatoren der physischen Gesundheit schließen.<br />
Dieser Zusammenhang scheint von Drittvariablen wie Gesundheitsverhalten,<br />
emotionale Aufgeschlossenheit und soziale Unterstützung moderiert zu sein.<br />
Keywords:<br />
Posttraumatische Reifung, Coping, Rehabilitation<br />
49
Risikofaktoren und protektive Faktoren für den Verlauf<br />
depressiver Symptome bei Patienten mit koronarer<br />
Herzkrankheit<br />
Jürgen Barth 1,2 , Martin Härter 3 & Jürgen Bengel 1<br />
1<br />
Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung für Rehabilitationspsychologie<br />
2<br />
Universität Bern, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Abteilung Gesundheitsforschung<br />
3<br />
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik Freiburg, Abteilung für<br />
Psychiatrie und Psychotherapie<br />
jbarth@ispm.unibe.ch<br />
Hintergrund: Depressive Symptome und depressive Störungen haben bei<br />
Patienten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) einen negativen Effekt auf<br />
Morbidität und Mortalität. Psychotherapeutische Interventionen haben sich hinsichtlich<br />
depressiver Symptome mittelfristig als eingeschränkt wirksam erwiesen.<br />
Die Ergebnisse der Interventionsstudie PROTeCD (Psychotherapeutic<br />
Resource-Orientated Treatment for Cardiac Patients with Depression) zeigte,<br />
dass die stationäre kardiologische Rehabilitation sehr erfolgreich depressive<br />
Symptome reduzieren kann (Effektstärken 0,8 bis 1,1). Ein additiver Effekt einer<br />
kurzzeitpsychotherapeutischen Intervention war nicht nachgewiesen worden.<br />
Die Frage der Stabilität dieser zunächst günstigen therapeutischen Effekte der<br />
stationären Rehabilitation auf den mittelfristigen und langfristigen Verlauf sowie<br />
die Analyse von Risiko- und Protektivfaktoren ist Gegenstand der vorgestellten<br />
Analyse. Methodik: KHK-Patienten mit einer depressiven Störung (N = 44) und<br />
psychisch belastete Patienten (N = 91) wurden nach 6 Monaten und nach ca.<br />
20 Monaten im Anschluss an die kardiologische Rehabilitation befragt. Die<br />
initiale wahrgenommene soziale Unterstützung sowie kritische Lebensereignisse<br />
wurden als Prädiktoren für den langfristigen Verlauf untersucht. Ergebnisse:<br />
Patienten mit einer depressiven Störung hatten zu Beginn im Mittel einen<br />
BDI-Wert von 19,78 und wiesen nach sechs Monaten weiterhin eine klinische<br />
relevante Symptomatik (M = 17,35) auf. Die Ängstlichkeit der Patienten<br />
reduzierte sich von Mprä = 12,5 nach sechs Monaten auf Mpost = 10,07. Im langfristigen<br />
Verlauf zeigte sich hinsichtlich der depressiven Symptomatik eine<br />
weitere Reduktion der depressiven Symptome (M = 15,74). Patienten mit<br />
psychischer Belastung hatten zu allen drei Messzeitpunkten durchschnittliche<br />
Werte zwischen 12 und 13 Punkten im BDI. Bei Maβen <strong>zur</strong> psychischen Belastung<br />
(HADS) zeigte sich im langfristigen Verlauf eine Symptomzunahme. Für<br />
depressive Patienten waren kritische Lebensereignisse mit negativem<br />
prognostischen Einfluss auf die Depressivität eine partnerschaftliche Trennung,<br />
finanzielle Probleme und erneute kardiologische Ereignisse. Psychisch belastete<br />
Patienten hatten vor allem bei schlechter sozialer Unterstützung und<br />
finanziellen Problemen chronifizierte depressive Symptome. Schlussfolgerung:<br />
Patienten mit einer Depression sollten vorrangig antidepressiv behandelt<br />
werden. Bei ausschlieβlicher psychischer Belastung sollten insb. Patienten mit<br />
geringer sozialer Unterstützung eine psychologische Behandlung erfahren. Das<br />
Monitoring hinsichtlich kritischer Lebensereignisse sollte als Standard in die<br />
ärztliche Anamnese integriert werden.<br />
50
Interpersonale Probleme bei Alkoholabhängigen – eine<br />
geschlechtsspezifische Analyse<br />
Christina Bauer 1 , Ahmad Khatib 2 , Dilek Sonntag 1 & Heinz C.<br />
Vollmer 2<br />
1<br />
Institut für Therapieforschung<br />
2<br />
Salus Klinik Friedrichsdorf<br />
bauer@ift.de<br />
Fragestellung: Alkoholabhängige weisen eine hohe interpersonale Problembelastung<br />
auf, die einen wesentlichen Einflussfaktor für die Aufrechterhaltung<br />
des abhängigen Trinkverhaltens darstellt. Dabei zeigen sich unterschiedliche<br />
Belastungsschwerpunkte bei Frauen und Männern. Die vorliegende Arbeit betrachtet<br />
interpersonale Problembereiche bei Alkoholabhängigen unter einer<br />
geschlechtsdifferenzierenden Perspektive.<br />
Methode: In einer Stichprobe von 297 Alkoholabhängigen (F10.2 nach<br />
ICD-10) wurde die interpersonale Problembelastung zu Beginn einer<br />
stationären Entwöhnungsbehandlung anhand des Inventars <strong>zur</strong> Erfassung<br />
interpersonaler Probleme (IIP-D, Horowitz et al., 1994) erfasst und hinsichtlich<br />
geschlechtsspezifischer Schwerpunkte analysiert.<br />
Ergebnisse: Frauen weisen im Vergleich zu Männern signifikant höhere<br />
Werte in der Selbstunsicherheit/Unterwürfigkeit, Ausnutzbarkeit/Nachgiebigkeit<br />
sowie Fürsorglichkeit/Freundlichkeit auf. Bei Männern zeigen sich signifikant<br />
höhere Werte auf der Skala Streitsucht/Konkurrenz.<br />
Diskussion: Abhängige Patientinnen haben stärkere Probleme als männliche<br />
Patienten mit zu gering ausgeprägter Dominanz und zu stark ausgeprägter<br />
Fürsorglichkeit. Männliche Alkoholabhängige weisen mehr Schwierigkeiten mit<br />
übermäßiger Dominanz auf. Es ist zu erwarten, dass sich die Berücksichtigung<br />
dieser spezifischen Problembelastungen in sozialen Kompetenz- und<br />
Kommunikationstrainings mit Alkoholabhängigen auch positiv auf das Erreichen<br />
alkoholbezogener Behandlungsziele auswirkt.<br />
Literatur:<br />
Horowitz, L.M., Strauß, B. & Kordy, H. (1994). Inventar <strong>zur</strong> Erfassung interpersonaler Probleme<br />
– Deutsche Version IIP-D. Weinheim: Beltz.<br />
Keywords:<br />
Alkoholabhängigkeit, interpersonale Probleme, Geschlecht<br />
51
Review zu psychischen Schutzfaktoren Kinder und<br />
Jugendlicher<br />
Jürgen Bengel & Nina Rottmann<br />
Institut für Psychologie der Universität Freiburg, Abteilung für Rehabilitationspsychologie<br />
bengel@psychologie.uni-freiburg.de<br />
Die kritische Diskussion einer einseitig auf die Reduktion von Risikofaktoren<br />
ausgerichteten Gesundheitsvorsorge und Prävention hat die Frage nach<br />
Schutzfaktoren stimuliert. Inzwischen wird auf verschiedenen Ebenen – u. a.<br />
psychologischer und molekularbiologischer – nach Schutzfaktoren, Reparaturgenen<br />
und Puffermechanismen geforscht. Die tief greifenden Veränderungen<br />
moderner Kinderwelten verdeutlichen die Relevanz der Schutzfaktorenforschung<br />
im Kinder- und Jugendlichenbereich. Die Forschung und Weiterentwicklung<br />
vollzieht sich hier unter den Begriffen gesundheitliche Schutzfaktoren,<br />
Protektivfaktoren und Resilienzfaktoren. Eine besondere Rolle spielen<br />
dabei psychische und soziale Schutzfaktoren der Gesundheit. Das Wissen um<br />
die protektive Wirkung solcher Faktoren trägt <strong>zur</strong> Planung und Fundierung von<br />
Präventionsmaßnahmen bei.<br />
In der psychologischen Forschung werden individuelle, familiäre und<br />
soziale Protektivfaktoren unterschieden. Sie sollen Kinder und Jugendliche dazu<br />
befähigen, Strategien <strong>zur</strong> Bewältigung belastender Lebensereignisse zu<br />
entwickeln. Eine kritische Betrachtung der Forschungslandschaft weist jedoch<br />
auf spezifische Probleme der Schutzfaktorenforschung hin:<br />
1. Nicht alle dieser Faktoren sind empirisch gut belegt. Für einige liegen<br />
widersprüchliche, für andere nur wenige Befunde vor.<br />
2. Unklare Definitionen oder Konstruktüberlappungen erschweren eine<br />
präzise Bestimmung der Schutzfaktoren.<br />
3. Die Dynamik und Kontextspezifität der zugrunde liegenden komplexen<br />
Prozesse und Wirkmechanismen wurde bislang nicht ausreichend berücksichtigt.<br />
Bislang liegen keine systematischen Übersichtsarbeiten, jedoch mehrere<br />
Reviews und viele Studien vor. Die Autoren erstellen im Auftrag der Bundeszentrale<br />
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eine Expertise zu psychischen<br />
Schutzfaktoren. Ziel dieses Beitrags ist es, in einer Gesamtschau den<br />
Forschungsstand zu psychischen Schutzfaktoren zu bewerten und die<br />
forschungsmethodischen Probleme exemplarisch darzustellen.<br />
Keywords:<br />
Schutzfaktoren, Resilienz, Kinder/Jugendliche<br />
52
Akkulturation und gesundheitliche Beschwerden bei<br />
drei Migrantenstichproben in Deutschland<br />
Stephan Bongard, Augustin Kelava, Merima Sabic, Donya Aazami-<br />
Gilan & Yong-Bum Kim<br />
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Psychologie<br />
bongard@psych.uni-frankfurt.de<br />
Zahlreiche Studien belegen einen Zusammenhang von Migration und<br />
Akkulturation mit gesundheitlichen Risiken. Wir haben eine deutschsprachige<br />
Akkulturationsskala entwickelt und überprüft, in wie fern die damit erfassten<br />
Akkulturationsstrategien mit selbst berichteten Beschwerden assoziiert sind. Die<br />
Frankfurter Akkulturationsskala (FRAKK) erfasst zwei Faktoren der Akkulturation:<br />
Übernahme der „Aufnahmekultur“ und „Lösen von der Herkunftskultur“.<br />
Durch Kreuzklassifikationen lassen sich entsprechend dem Akkulturationsmodell<br />
von John W. Berry (Berry et al., 1989) vier Typen von Migranten unterscheiden:<br />
Integrierte, Assimilierte, Segregierte, und Marginalisierte. Insgesamt<br />
305 Teilnehmer/innen aus drei unterschiedlichen Kulturkreisen füllten die<br />
FRAKK und die Beschwerdenliste (BL; Zerssen, 1976) aus. Personen, die als<br />
segregierte Migranten klassifiziert wurden wiesen, die stärksten Beschwerden<br />
auf, insbesondere im kardiovaskulären und im gastro-intestinalen Organsystem.<br />
Literatur:<br />
Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M. & Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes in plural<br />
societies. Applied Psychology: An International Review, 38, 185-206.<br />
Zerssen, D. (1976). Die Beschwerden-Liste. Weinheim: Beltz.<br />
Keywords:<br />
Akkulturation, Migration, Gesundheit<br />
53
Somatoforme Störungen in der Allgemeinbevölkerung –<br />
Prävalenz und Determinanten für die Inanspruchnahme<br />
medizinischer Leistungen<br />
Elmar Brähler 1 , Winfried Rief 2 , Alexandra Martin 2 & Heide<br />
Glaesmer 1<br />
1<br />
Universität Leipzig, Selbstständige Abteilung für Medizinische Psychologie<br />
und Soziologie<br />
2<br />
Philips-Universität Marburg, Arbeitsgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie<br />
elmar.braehler@medizin.uni-leipzig.de<br />
Fragestellung: Personen mit somatoformen Störungen beanspruchen in hohem<br />
Ausmaß das Gesundheitssystem. Bisherige Untersuchungen dazu basieren<br />
primär auf Querschnittserhebungen und/oder Untersuchungen von Personen,<br />
die bereits ärztliche Hilfe aufsuchen. Demgegenüber wird mit dem vorliegenden<br />
Projekt ein bevölkerungsrepräsentativer, längsschnittlicher Ansatz gewählt. Es<br />
wird erwartet, dass nicht die körperlichen Beschwerden die Inanspruchnahme<br />
medizinischer Leistungen determinieren, sondern die psychologischen Bewertungsprozesse<br />
dieser Beschwerden. Dies bedeutet auch, dass es<br />
Menschen gibt, die trotz Vorliegen von (medizinisch nicht bedrohlichen) körperlichen<br />
Beschwerden keine medizinische Hilfe aufsuchen.<br />
Methoden: Zur Untersuchung der Determinanten des Inanspruchnahmeverhaltens<br />
wird in einer ersten Erhebungsphase im Mai/Juni 2007 bevölkerungsrepräsentativ<br />
an 2500 Personen mit dem PHQ-15-Somatisierungsscreener<br />
untersucht, ob funktionelle körperliche Beschwerden vorliegen.<br />
Als Determinanten für das Inanspruchnahmeverhalten werden Depression<br />
(PHQ-9), Angststörungen (PHQ-GAD-7), dispositioneller Optimismus,<br />
beschwerdeassoziierte Beeinträchtigung (PSI), gesundheitsbezogene Lebensqualität<br />
(Euroqol), Lebenszufriedenheit (FLZ-M), Entscheidungsschwelle für<br />
Arztbesuche sowie soziodemografische Variablen erhoben.<br />
In einer zweiten Erhebungsphase mit anschließendem 1-Jahres-Follow-up<br />
wird eine Personengruppe mit erhöhten Werten für körperliche Beschwerden<br />
(N = 300) sowie eine Vergleichsgruppe ohne Vorliegen körperlicher Beschwerden<br />
(N = 200) aus dieser Gesamtstichprobe ausgewählt und per Interviewverfahren<br />
und Fragebögen genauer untersucht.<br />
Ergebnisse: Erste Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Querschnittsuntersuchung<br />
werden vorgestellt.<br />
Keywords:<br />
somatoforme Störungen, Inanspruchnahme, Determinanten<br />
54
Zusammenhang zwischen motorischen Fähigkeiten,<br />
körperlicher Aktivität und gesundheitsbezogener<br />
Lebensqualität bei Grundschülern<br />
Susanne Brandstetter 1 , Olivia Wartha 2 , Martin Wabitsch 3 , Christof<br />
Galm 4 , Jochen Klenk 5 & Jürgen M. Steinacker 1<br />
1<br />
Universitätsklinikum Ulm, Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin<br />
2<br />
Universitätsklinikum Ulm, Transferzentrum für Neurowissenschaften und<br />
Lernen<br />
3<br />
Universitätsklinikum Ulm, Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie<br />
4<br />
Universitätsklinikum Ulm, Sektion Pädiatrische Kardiologie<br />
5<br />
Universitätsklinikum Ulm, Epidemiologie<br />
susanne.brandstetter@uniklinik-ulm.de<br />
Fragestellung: Die Bedeutung der körperlichen Aktivität und der damit verbundenen<br />
motorischen Fähigkeiten im Kindesalter ist bekannt. Aber schlagen<br />
sie sich auch in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität der Kinder nieder?<br />
Hier soll untersucht werden, wie das Ausmaß motorischer Fähigkeiten und die<br />
körperliche Aktivität mit der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Grundschülern<br />
zusammenhängen.<br />
Methode: In der Studie <strong>zur</strong> Gesundheitsförderung URMEL-ICE (Ulm<br />
Research on Metabolism, Exercise and Lifestyle Intervention in Children)<br />
wurden von 1120 Grundschulkindern der zweiten Jahrgangsstufe aus der<br />
Region Ulm Angaben zum Bewegungsverhalten in der Freizeit im Selbst- und<br />
Elternbericht und Daten <strong>zur</strong> sportmotorischen Leistungsfähigkeit erhoben. Als<br />
Messinstrument für die gesundheitsbezogene Lebensqualität wurde der KINDL-<br />
R (Ravens-Sieberer, 2003) eingesetzt. Dieser Fragebogen <strong>zur</strong> Selbstbeurteilung<br />
bildet in sechs Skalen die Bereiche Körper, Psyche, Selbstwert,<br />
Familie, Freunde und Schule ab.<br />
Ergebnisse: Neben einer genauen Beschreibung der sportmotorischen<br />
Fähigkeiten, der körperlichen Aktivität und der Lebensqualität der Kinder ermöglichen<br />
die Daten Aussagen darüber, inwiefern sich Kinder unterschiedlicher<br />
sportmotorischer Fähigkeiten sowie mit bewegungsreichem und -armem Freizeitverhalten<br />
hinsichtlich ihrer gesundheitsbezogenen Lebensqualität unterscheiden.<br />
Literatur:<br />
Ravens-Sieberer U. (2003). Der Kindl-R Fragebogen <strong>zur</strong> Erfassung der gesundheitsbezogenen<br />
Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen - Revidierte Form. In J. Schumacher , A.<br />
Klaiberg A, & E. Brähler (Hrsg.), Diagnostische Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefinden,<br />
S. 184-188. Göttingen: Hogrefe.<br />
Keywords:<br />
körperliche Aktivität, Lebensqualität, Kinder<br />
55
Burnout bei Ärzten und Soldaten – ein Beitrag <strong>zur</strong><br />
Generalisierbarkeit der Burnout-Theorie<br />
Maxi Braun 1 , Lucia Jerg-Bretzke 1 , Petra Beschoner 2 , Carlos<br />
Schoenfeldt-Lecuona 2 , Vladimir Hrabal 1 & Harald C. Traue 1<br />
1 Universität Ulm, Abteilung <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
2 Universität Ulm, Abteilung Psychiatrie III<br />
maxi.braun@uni-ulm.de<br />
Fragestellung/Einleitung: Maslachs Konzept des Burnout-Syndroms, ursprünglich<br />
für helfende Berufe konzipiert, wird inzwischen auch auf Personen angewendet,<br />
die in Dienst leistenden Organisationen im weitesten Sinne tätig<br />
sind. In unserer Arbeit verglichen wir erstmals die Ausprägung und die<br />
Symptomatik von Burnout bei Ärzten und Soldaten.<br />
Methode: Das Maslach Burnout Inventar (MBI) wurde an die unterschiedlichen<br />
Arbeitsbedingungen der Ärzte und Soldaten angepasst und an n = 921<br />
Ärzten und n = 409 Soldaten erhoben und ausgewertet. Die Auswertung wurde<br />
an 20 vergleichbaren Items des jeweils unterschiedlichen Inventars durchgeführt,<br />
zwei Fragen wurden ausgeschlossen. Berechnet wurden die von<br />
Maslach vorgegebenen Subskalen „Emotionale Erschöpfung“ (EE), „Depersonalisation“<br />
(DP) und „Subjektive Leistungsverringerung“ (SE).<br />
Ergebnisse: In einem ersten Schritt wurden die beiden Stichproben in den<br />
drei Dimensionen des MBI anhand von T-Tests verglichen. Ärzte zeigten hochsignifikant<br />
höhere Werte für EE und SE. In Bezug auf DP unterschieden sich<br />
die Stichproben nicht signifikant. In einem weiteren Schritt wurde die<br />
Korrelationsanalyse der MBI – Skalen in beiden Stichproben durchgeführt.<br />
Diskussion: Ärzte sind erschöpfter als die Soldaten, haben aber weniger<br />
das subjektive Gefühl der reduzierten Leistungsfähigkeit. Die Depersonalisation<br />
ist bei Ärzten gleich hoch wie bei den Soldaten, geht aber signifikant häufiger<br />
mit Emotionaler Erschöpfung einher. Die drei Burnout-Komponenten sind bei<br />
den Ärzten konsistenter als bei den Soldaten. Dabei stellt die emotionale Erschöpfung<br />
die Hauptkomponente dar. Aus den vorgestellten Ergebnissen kann<br />
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass das Burnout- Konzept nach<br />
Maslach zwar auf andere Berufsgruppen auch anwendbar ist, für Berufe im<br />
sozialen Bereich erscheint es jedoch geeigneter.<br />
Keywords:<br />
burnout, physicians, soldiers<br />
56
Dyadischer Austausch bei Paaren mit Demenz<br />
Melanie Braun 1 , Urte Scholz 1 , Rainer Hornung 1 , Melanie Wight 2 &<br />
Mike Martin 2<br />
1 Universität Zürich, Fachgruppe Sozial- und <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
2 Universität Zürich, Fachgruppe Gerontopsychologie<br />
melanie.braun@psychologie.unizh.ch<br />
Fragestellung: Die steigende Prävalenz demenzieller Erkrankungen führt dazu,<br />
dass immer mehr Paare mit der Pflege eines an Demenz leidenden Partners<br />
konfrontiert sind. Obwohl die Demenzforschung ein breites Wissen über die<br />
Belastung von Pflegepersonen <strong>zur</strong> Verfügung stellt, ist wenig über den Einfluss<br />
einer Demenzerkrankung, bzw. der Pflege des Partners auf die Paarbeziehung<br />
und den dyadischen Austausch bekannt.<br />
Sozialpsychologische Studien zeigen, dass wahrgenommene Gerechtigkeit<br />
(Equity-Theorie; Walster et al., 1978) und ein ausgeglichener sozialer Austausch<br />
Prädiktoren von Beziehungszufriedenheit sind (z. B. Hatfield et al.,<br />
1985). Im Falle eines dementen Partners ist anzunehmen, dass diese Gerechtigkeit<br />
und der dyadische Austausch verändert oder gestört wird.<br />
In dieser Studie geht es um die Untersuchung der Entwicklung des<br />
dyadischen Austauschs und der wahrgenommenen Gerechtigkeit in der Paarbeziehung<br />
bei 40 Paaren (N = 80), die von einer Demenzerkrankung des Ehemannes<br />
betroffen sind. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Zusammenhänge<br />
zwischen dem dyadischen Austausch und dem individuellen Wohlbefinden,<br />
bzw. der Beziehungszufriedenheit. Zur Erfassung der dyadischen<br />
Perspektive ist die Sichtweise des dementen Partners wichtiger Bestandteil der<br />
Untersuchung.<br />
Methodik: Um die Entwicklung und die prädiktive Validität möglicher Einflussfaktoren<br />
zu evaluieren, finden 3 Messzeitpunkte innerhalb eines Zeitraums<br />
von 12 Monaten statt. Zu jedem Messzeitpunkt wird neben einer Testbatterie<br />
<strong>zur</strong> Kontrolle potenzieller Risiko- und Schutzfaktoren (z. B. Coping, Depression),<br />
eine Videoaufnahme einer Kommunikationssituation des Paares<br />
durchgeführt.<br />
Erwartete Erkenntnisse: Wir erwarten wichtige Erkenntnisse über den Zusammenhang<br />
des Wohlbefindens des Paares mit Veränderungen im<br />
dyadischen Austausch beider Partner. Die Ergebnisse sollen eine Grundlage für<br />
spätere paarbezogene Interventionen <strong>zur</strong> Förderung der adaptiven Kapazitäten<br />
darstellen.<br />
Keywords:<br />
dementia caregiving, caregiver stress, dyadic relationships<br />
57
Sexualität Jugendlicher und junger Erwachsener – eine<br />
Mixed-Methods-Studie<br />
Eva Brunner, Brigitte Jenull-Schiefer, Claudia Brunner & Olivia Kada<br />
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt<br />
eva.brunner@uni-klu.ac.at<br />
Fragestellung: In der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen lässt<br />
sich eine erhöhte Prävalenz sexuell übertragbarer Erkrankungen erkennen<br />
(Centers for Disease Control and Prevention, 2006). Eine umfassende Betrachtung<br />
des Sexualverhaltens bildet die Grundlage, um diesem Trend entgegenwirken<br />
zu können (Vögele, 2006). Das Projekt „Lust or trust“ widmet sich<br />
daher einer ganzheitlichen Untersuchung sexuellen Verhaltens von heterosexuellen<br />
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.<br />
Methode: Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein multimethodales<br />
Herangehen gewählt. Neben ExpertInneninterviews (n = 7) <strong>zur</strong> Exploration der<br />
sexualpräventiven Landschaft in Österreich wurden mittels Fragebögen Motive<br />
für und gegen den Kondomgebrauch (N = 175), Emotionen beim ersten und<br />
letzten Geschlechtsverkehr (N = 144) sowie relevante gesundheitspsychologische<br />
Variablen wie Kondomintention, Kondomselbstwirksamkeitserwartung,<br />
Risikowahrnehmung (N = 1089) erhoben. In Interviewstudien beschäftigten wir<br />
uns mit dem Kommunikationsverhalten bei „Casual Sex“ (n = 30) und den<br />
Emotionen von Mädchen beim ersten Mal (n = 32).<br />
Ergebnisse: Den ersten Geschlechtsverkehr erleben die StudienteilnehmerInnen<br />
mit durchschnittlich 15.75 Jahren (SD = 2.85). Der Kondomgebrauch<br />
sinkt vom ersten zum letzten Mal von 80 % auf 47 %. Frauen entscheiden<br />
sich aufgrund des Bestehens einer Partnerschaft und dem damit verbundenen<br />
Vertrauen eher gegen ein Kondom als Männer. Männer verwenden<br />
im Allgemeinen häufiger Kondome als Frauen und konsumieren häufiger<br />
Alkohol vor dem Geschlechtsverkehr. Sexualprävention muss diesen<br />
geschlechtsspezifischen Unterschieden Rechnung tragen.<br />
Literatur:<br />
Centers for Disease Control and Prevention (2006). Sexually transmitted disease surveillance,<br />
2005. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services.<br />
Vögele, C. (2006). Sexualverhalten. In A. Lohaus, M. Jerusalem & Klein-Heßling, J. (Hrsg.),<br />
Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter (S. 221-247). Göttingen: Hogrefe.<br />
Keywords:<br />
Sexuelles Risikoverhalten, Kondomgebrauch, Jugend<br />
58
Gesundheitsförderung von Unimenschen für<br />
Unimenschen! Ein innovatives Lehr- und Lernkonzept<br />
im Fach <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
Eva Brunner, Olivia Kada & Brigitte Jenull-Schiefer<br />
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt<br />
eva.brunner@uni-klu.ac.at<br />
Hintergrund: Partizipation gilt nicht nur in der Gesundheitsförderung als<br />
Schlüssel zum Erfolg (Hurrelmann, 2003), sondern wird auch im Kontext universitärer<br />
Lehre als Strategie <strong>zur</strong> Verbesserung der studentischen Motivation<br />
und des Lernerfolgs diskutiert (Rück, 2005). Nachdem an Österreichischen<br />
<strong>Hochschule</strong>n noch kaum Gesundheitsförderung stattfindet (Brunner, 2007),<br />
wurde im Zuge eines gesundheitspsychologischen Seminars der 1. Gesundheitstag<br />
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt vorbereitet und veranstaltet.<br />
Umsetzung: Dreißig Studierende arbeiteten an der Gestaltung von<br />
Infopoints zu Themen wie rückenschonendes Arbeiten und Studieren, gesunde<br />
Ernährung und Bewegung an der Universität. Aufgaben waren dabei die Beschaffung<br />
von Informationsmaterialien sowie die Erstellung wissenschaftlicher<br />
Poster. Themen wie Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit für gesundheitsförderliche<br />
Maßnahmen wurden ebenso behandelt. Das studentische Feedback<br />
(n = 18) bestätigt mit der Gesamtnote 1.2 den Erfolg der Lehrveranstaltung. Gefallen<br />
fanden vor allem das selbstständige (n = 6) und praktische (n = 5)<br />
Arbeiten im Team (n = 3) und das Vorgehen der Lehrperson (n = 4).<br />
Fazit: Die Studierenden sammelten erste praktische Erfahrungen in der<br />
Gesundheitsförderung. Bestätigung fand das Lehrkonzept durch die<br />
Prämierung mit dem Gesundheitspreis der Stadt Klagenfurt und dem Preis der<br />
Kärntner Ärztekammer. Im Sinne partizipativer Ansätze in Gesundheitsförderung<br />
und Lehre findet die Veranstaltung im Sommersemester 2007 <strong>zur</strong><br />
Gestaltung des 2. Gesundheitstages an der Universität erneut statt.<br />
Literatur:<br />
Brunner, E. (2007). Gesundheitsförderung von Unimenschen für Unimenschen: 1. Gesundheitstag<br />
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Prävention, 1, 28-30.<br />
Hurrelmann, K. (2003). Gesundheitssoziologie. Weinheim: Juventa.<br />
Rück, N. (2005). Motiviert lernen an der <strong>Hochschule</strong>. Das Hochschulwesen, 1, 34-38.<br />
Keywords:<br />
Gesundheitsfördernde <strong>Hochschule</strong>, innovative Lehre, Partizipation<br />
59
Conservation of Resources: Gewinn- und Verlustspiralen<br />
von HIV-positiven schwulen Männern<br />
Petra Buchwald 1 , Martin Reith 2 , Robert Baumann 3 & Tobias Ringeisen<br />
4<br />
1 Heinrich-Heine Universität Düsseldorf<br />
2 HIV-Schwerpunktpraxis Düsseldorf<br />
3 HIV-Schwerpunktpraxis Neuss<br />
4 Bergische Universität Wuppertal<br />
buchwald@phil-fak.uni-duesseldorf.de<br />
Trotz aller Fortschritte im Bereich der Erforschung von HIV-Infektionen sind<br />
nach 20 Jahren Präventionsarbeit Männer, die Sex mit Männern (MSM) haben,<br />
weiterhin die größte Betroffenengruppe mit ansteigenden Infektionsraten. Die<br />
gesundheitspsychologischen Aspekte von HIV/AIDS bei MSM beziehen sich auf<br />
Stress, Ängste und Depressionen verbunden mit einem eklatanten Verlust an<br />
Ressourcen (Buchwald & Perez, 2006). Der Zugang zu neuen Ressourcen ist<br />
MSM aufgrund der Stigmatisierung wegen ihrer sexuellen Orientierung und<br />
ihres HIV-Status erschwert. Basierend auf der Conservation of Resources-<br />
Theorie (COR; Hobfoll, 1998), die Stress als eine Funktion von Ressourcenverlusten<br />
und -gewinnen konzeptualisiert, wurden 24 HIV+ MSM interviewt. Die<br />
zugrunde liegenden Forschungsfragen lauteten: Welche Ressourcenverluste<br />
und Ressourcengewinne erleben diese Gruppe? Sind Ressourcenverluste miteinander<br />
verbunden? Sind Verluste mit Gewinnen assoziiert? Haben<br />
Ressourcengewinne immer positive Auswirkungen? Welche Aspekte tragen <strong>zur</strong><br />
Beschleunigung bzw. Verlangsamung der Ressourcenzyklen bei und wo kann<br />
eine ressourcen-orientierte Gesundheitsförderung ansetzen? Tiefeninterviews<br />
und eine folgende Inhaltsanalyse zeigten, dass HIV + MSM multiple Ressourcenverluste<br />
erlebten, aber Social Support hinzugewinnen konnten. Verschiedene<br />
Arten von Ressourcen standen miteinander in Beziehung und Veränderungen<br />
in einer Gruppe von Ressourcen ging mit der Verfügbarkeit von<br />
Ressourcen anderer Art einher. Mögliche Ansatzpunkte einer ressourcenorientierten<br />
Gesundheitsförderung und die besondere Rolle von Social Support<br />
werden im Rahmen der COR Theorie diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Buchwald, P. & Perez, S. (2006). Coping, personality and sexual behavior of HIV+ men who<br />
have sex with men. In P. Buchwald (Ed.), Stress and anxiety – Application to health, work<br />
place, community, and education (pp. 2-35). Newcastle: Cambridge Scholars Press.<br />
Hobfoll, S.E. (1998). Stress, culture and community. Plenum Press: New York.<br />
Keywords:<br />
Stress, Social Support, HIV<br />
60
Aspekte der Wirksamkeit von Coaching, Gesundheitszirkel<br />
und Supervision <strong>zur</strong> Reduktion berufsbezogener<br />
Belastungen von Mitarbeitern eines Landeskriminalamtes<br />
Katharina Chwallek, Burkhard Gusy, Dieter Kleiber & Anna<br />
Auckenthaler<br />
Freie Universität Berlin/Institut für Prävention und psychosoziale Gesundheitsforschung<br />
katharina@ipg-berlin.de<br />
Fragestellung: Im Rahmen eines Projekts zum Gesundheitsmanagement beim<br />
Landeskriminalamt Berlin wurden für MitarbeiterInnen aus besonders belasteten<br />
Bereichen drei Interventionsvarianten (Coaching, Gesundheitszirkel<br />
und Supervision) mit einem Zeitumfang von jeweils 10-12 eineinhalbstündigen<br />
Sitzungen bereitgestellt. Ziel der Studie war die Gewinnung von Informationen<br />
<strong>zur</strong> gesundheitsbezogenen Wirksamkeit der Interventionen.<br />
Methoden: Die (differenzielle) Wirksamkeit der Interventionen wurde im<br />
Rahmen einer Interventionsstudie mit Kontrollgruppendesign mittels einer Prä-<br />
Postbefragung untersucht. Auf der Basis von qualitativen Interviews, die <strong>zur</strong><br />
Felderkundung mit fünf MitarbeiterInnen durchgeführt wurden, wurde ein<br />
standardisierter Fragebogen <strong>zur</strong> subjektiven Arbeitsanalyse entwickelt. Mit<br />
diesem wurden Anforderungen der Arbeitstätigkeit, organisatorische Ressourcen,<br />
Einfluss- und Entwicklungsmöglichkeiten, soziale Beziehungen sowie<br />
Aspekte der Führungsqualität und Gesundheit bei MitarbeiterInnen der teilnehmenden<br />
Kommissariate erhoben. An der Prä-Befragung beteiligten sich<br />
N = 53 Angestellte, an der Postbefragung nahmen N = 40 Personen teil.<br />
Ergebnisse: Durch die Intervention verbesserten sich Aspekte der<br />
subjektiven Gesundheit der Teilnehmer (reduzierte emotionale Erschöpfung).<br />
Die Interventionsteilnehmer berichteten darüber hinaus in der Postbefragung<br />
über verbesserte arbeitsorganisatorische Bedingungen. So stiegen die Verbundenheit<br />
mit dem Arbeitsplatz, die wahrgenommene Aufgabenvielfalt, der<br />
Tätigkeitsspielraum und die soziale Unterstützung durch Vorgesetzte.<br />
Hinsichtlich der differenziellen Wirksamkeit der Interventionen zeigten sich zusätzlich<br />
zu den oben genannten Aspekten weitere Ergebnisse, wie zum Beispiel<br />
die Verbesserung der wahrgenommenen Führungsqualität beim Coaching.<br />
Keywords:<br />
intervention effectiveness evaluation, health management, police officers<br />
61
BMI von Kindern mit einer Aufmerksamkeits-<br />
Hyperaktivitätsstörung (ADHS)<br />
Holger Domsch 1 , Thomas Müller 2 , Gordon Wingert 3 & Dieter<br />
Krowatschek 3<br />
1<br />
Universität Bielefeld / Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie<br />
2<br />
University of Alberta / Division of Nephrology<br />
3<br />
Schulpsychologischer Dienst Marburg-Biedenkopf<br />
holger.domsch@uni-bielefeld.de<br />
Fragestellung: Etwa 2-5 % aller Kinder leiden unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung<br />
(ADHS). Zu der Symptomatik gehört neben einer<br />
geringeren Konzentrationsleistung und einer höheren Impulsivität auch eine<br />
vermehrte motorische Unruhe. Als Folge der Hyperaktivität ließe sich erwarten,<br />
dass Kinder mit einer ADHS ein durchschnittlich niedrigeres Körpergewicht als<br />
ihre Altersgruppe haben. Diese Hypothese wird zudem durch die Beobachtung<br />
unterstützt, dass ADHS-Kinder nicht nur in Phasen motorischer Aktivität<br />
sondern auch im Ruhezustand einen höheren Energieverbrauch zeigen (Müller<br />
et al., eingereicht). Im Widerspruch dazu stehen dagegen Ergebnisse einer<br />
Studie von Holtkamp et al. (2004). Die Forschergruppe untersuchte eine<br />
klinische Stichprobe von 97 ADHS-Kindern und konnte ein geringeres Körpergewicht<br />
nicht bestätigt. In dieser Studie zeigte sich sogar, dass mehr ADHS-<br />
Kinder in die Gruppe der Übergewichtigen fielen, als dies aufgrund von<br />
deutschen Normwerten zu erwarten wäre. In der Studie wurden jedoch sowohl<br />
stationär als auch ambulant behandelte Kinder untersucht, wobei eine getrennte<br />
Auswertung der Daten nicht berichtet wurde. In der vorliegenden Untersuchung<br />
sollten die Ergebnisse von Holtkamp et al. an einer Gruppe von ausschließlich<br />
ambulant behandelten ADHS-Kindern repliziert werden. Zudem wurde eine<br />
Gruppe von ADHS-Kindern gewählt, die an einem niedrigschwelligen Therapieangebot<br />
(Schulpsychologischer Dienst) teilnahmen.<br />
Methode: Die Stichprobe setzte sich aus 30 Jungen zusammen, die an<br />
einem Verhaltenstraining teilnahmen. Größe und Gewicht wurden erfasst und<br />
daraus der Body-Mass-Index berechnet. Als Vergleichsstichprobe diente die<br />
deutsche Referenzstichprobe von Kromeyer-Hausschild et al. (2001).<br />
Ergebnisse: Übereinstimmend mit vorherigen Ergebnissen wichen die hier<br />
untersuchten ADHS-Kinder nicht von der deutschen Referenzstichprobe ab.<br />
Der BMI lag damit in einem normalen Bereich. Unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten<br />
werden diskutiert.<br />
Keywords:<br />
Body-Mass-Index, ADHS, Ernährungsverhalten<br />
62
Zur Bedeutung der Reziprozität sozialer Unterstützungsprozesse<br />
bei Prostatektomiepatienten und<br />
deren Partnern<br />
Anne Dunkel 1 , Silke Burkert 1 , Nina Knoll 1 & Oliver Gralla 2<br />
1<br />
Institut für medizinische Psychologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin<br />
2<br />
Klinik für Urologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin<br />
AnneDunkel@gmx.de<br />
Fragestellung: In der Unterstützungsliteratur wird die Reziprozität als ein<br />
wichtiger moderierender Faktor der Wirksamkeit sozialer Unterstützungsprozesse<br />
diskutiert.<br />
Ziel dieser Studie war es daher, die Zusammenhänge zwischen geleisteter<br />
und erhaltener Unterstützung zu beschreiben sowie deren Auswirkungen auf<br />
das Wohlbefinden zu untersuchen. In Anlehnung an Equitystudien von Kuiijer<br />
und Kollegen (2001) wurde davon ausgegangen, dass im allgemeinen ein ausgeglichenes<br />
Maß von erhaltener und geleisteter Unterstützung förderlich ist,<br />
während in Extremsituationen die Reziprozität sozialer Unterstützungsprozesse<br />
keinerlei Rolle spielen sollte.<br />
Methode: Hierzu wurde eine Stichprobe von 101 Prostatektomiepatienten<br />
und 76 Partnerinnen längsschnittlich (2 Tage vor der Prostatektomie sowie 3<br />
bzw. 14 Tage nach dieser) untersucht.<br />
Ergebnisse: Bei der deskriptiven Beschreibung der Unterstützungsprozesse<br />
galt es dreierlei Betrachtungsweisen zu unterscheiden: die Übereinstimmung<br />
hinsichtlich unterstützenden Verhaltens, die wahrgenommene Reziprozität<br />
sowie die tatsächliche Reziprozität. Hier konnten neben beträchtlichen<br />
Schwankungen zwischen Patienten- und Partnerperspektive auch interessante<br />
längsschnittliche Veränderungen aufgefunden werden.<br />
Bezüglich der Auswirkungen auf das Wohlbefinden zeigten regressionsanalytische<br />
Verfahren, dass reziproke Unterstützungsprozesse vor der Prostatektomie<br />
bei den Patienten mit geringeren Depressivitätswerten sowie gesteigertem<br />
Affekt nach der Operation assoziiert sind. Auch bei den Partnerinnen<br />
gingen präoperative reziproke Unterstützungsprozesse mit einer Abnahme des<br />
negativen Affekts einher.<br />
Direkt nach der Operation, also in einer Extremsituation, spielte das Verhältnis<br />
von geleisteter und erhaltener Unterstützung hingegen weder bei<br />
Prostatektomiepatienten noch bei den Partnerinnen eine Rolle.<br />
Diese Befunde weisen auf die Notwendigkeit hin, soziale Unterstützung<br />
als bidirektionales prozessuales Phänomen zu konzeptualisieren.<br />
Keywords:<br />
soziale Unterstützung, Reziprozität<br />
63
Lebensqualitätsdiagnostik als zusätzliche relevante<br />
Informationsquelle für die Behandlung von<br />
Patientinnen mit Brustkrebs<br />
Christoph Ehret 1 , Monika Klinkhammer-Schalke 1 , Brunhilde<br />
Steinger 1 , Michael Koller 2 , Ferdinand Hofstädter 1 & Wilfried Lorenz 1<br />
1 Tumorzentrum Regensburg e.V.<br />
2 Zentrum für Klinische Studien Regensburg<br />
christoph.ehret@klinik.uni-regensburg.de<br />
Fragestellung: Lebensqualität (LQ) wird häufig bei Krebspatienten gemessen<br />
ohne zu therapeutischen Konsequenzen zu führen. Damit LQ-Diagnostik die<br />
Behandlungsgrundlage des Arztes sinnvoll erweitert, muss sie relevante zusätzliche<br />
Informationen liefern, die aus anderen Quellen (Gesundheitszustand,<br />
demografische Faktoren) nicht gewonnen werden können.<br />
Methode: Ein System <strong>zur</strong> LQ-Diagnostik wurde in 32 Praxen und 6<br />
Kliniken im Raum des Tumorzentrums Regensburg mit Hilfe von Vor-Ort-<br />
Besuchen, der Einbindung von Meinungsbildnern und durch interaktive Qualitätszirkel<br />
implementiert. LQ wurde bei 170 Patientinnen mit Brustkrebs in der<br />
Zeit von 12/2002 bis 06/2004 mittels EORTC-Fragebögen (C30+BR23) gemessen.<br />
Vom Arzt wurde der Gesundheitsstatus (Operationsverfahren, -<br />
zeitpunkt, Schwere der Tumorerkrankung), demografische Angaben (Alter,<br />
Familienstand) sowie seine Einschätzung der Globalen LQ der Patientin erfasst.<br />
Ergebnisse: In einer Regressionsanalyse konnte kein Einfluss<br />
medizinischer oder demografischer Parameter auf die Globale LQ (Patientenselbsteinschätzung)<br />
nachgewiesen werden. Ausschließlich selbst berichtete<br />
Angaben <strong>zur</strong> LQ in spezifischen Dimensionen (Körperbild, Emotion, Familienleben<br />
& Unternehmungen) wiesen signifikante Zusammenhänge auf (je p
Diagnostik von Stressbewältigung bei Kindern und<br />
Jugendlichen mit dem SSKJ 3-8: Erweiterungen<br />
Heike Eschenbeck 1 , Carl-Walter Kohlmann 1 & Norbert Hermanns 2<br />
1<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd, Institut für Humanwissenschaften,<br />
Psychologie<br />
2<br />
Diabetes-Zentrum Bad Mergentheim<br />
In dem Vortrag wird über Erweiterungen im Bereich der Diagnostik von Stressbewältigung<br />
mit dem Fragebogen <strong>zur</strong> Erhebung von Stress und Stressbewältigung<br />
im Kindes- und Jugendalter (SSKJ 3-8, Lohaus et al., 2006) berichtet.<br />
In einer ersten Studie (Eschenbeck et al., 2007) wurden Strategien der<br />
Bewältigung und Blutzuckereinstellung bei 53 Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes<br />
mellitus (Alter 12-17 Jahre) untersucht. Die erkrankten Jugendlichen bearbeiteten<br />
eine diabetesspezifisch erweiterte Version des SSKJ 3-8, wobei<br />
krankheitsspezifische Stresssituationen (z. B. „schlechte HbA1c-Werte“) als<br />
auch krankheitsunspezifische Alltagsstressoren (z. B. „Streit mit Freund/in“) berücksichtigt<br />
wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Diabetessituationen nicht<br />
per se belastender erlebt wurden als die Alltagsstressoren. Mädchen berichteten<br />
häufiger über Suche nach sozialer Unterstützung sowie problemorientierte<br />
Bewältigung, Jungen dagegen über vermeidende Bewältigung. Eine<br />
diabetesbezogene vermeidende Bewältigung war bei Mädchen mit ungünstigeren<br />
mittleren Blutzuckerwerten der letzten drei Monate (HbA1c)<br />
assoziiert. In einer zweiten Studie wurden die fünf Skalen des SSKJ 3-8 <strong>zur</strong><br />
Erhebung des Bewältigungsverhaltens (Suche nach sozialer Unterstützung,<br />
problemorientierte Bewältigung, vermeidende Bewältigung, palliative sowie<br />
ärgerbezogene Emotionsregulation) um die beiden Subskalen Mediennutzung<br />
und impulsgesteuertes Essverhalten erweitert. Befragt wurden insgesamt ca.<br />
1.000 adipöse und nicht-adipöse Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14<br />
Jahren. Psychometrische Kennwerte sowie Assoziationen mit Körpergewichtsstatus<br />
und Variablen des Gesundheitsverhaltens werden vorgestellt. Die Ergebnisse<br />
beider Studien werden im Hinblick auf diagnostische sowie gesundheitspsychologische<br />
Implikationen diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Eschenbeck, H., Kohlmann, C.-W., Deiß, S., Hübner, I. & Hermanns, N. (2007). Stress, Stressbewältigung<br />
und Blutzuckereinstellung bei Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus: Zur<br />
Bedeutung erkrankungsspezifischer Diagnostik. Zeitschrift für <strong>Gesundheitspsychologie</strong>,<br />
15, 119-126.<br />
Lohaus, A., Eschenbeck, H., Kohlmann, C.-W. & Klein-Heßling, J. (2006). Fragebogen <strong>zur</strong> Erhebung<br />
von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter (SSKJ 3-8). Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
65
Qualitative Methoden in der <strong>Gesundheitspsychologie</strong>:<br />
Fragen, Qualitätskriterien, Trends<br />
Toni Faltermaier<br />
Universität Flensburg, Institut für Psychologie<br />
faltermaier@uni-flensburg.de<br />
Der methodische Mainstream in der <strong>Gesundheitspsychologie</strong> war und ist immer<br />
noch die quantitative Methodologie. Dennoch haben qualitative Studien in der<br />
<strong>Gesundheitspsychologie</strong> durchaus eine Tradition, in neuerer Zeit scheinen sie<br />
sogar auch international eine wachsende Bedeutung zu bekommen. Ein Blick in<br />
andere Disziplinen der Gesundheitswissenschaften (Medizinsoziologie, Medizinanthropologie)<br />
zeigt, dass dort qualitative Methoden längst ein selbstverständlicher<br />
Teil der empirischen Forschung sind. Die Zunahme qualitativer<br />
Forschung in der <strong>Gesundheitspsychologie</strong> lässt jedoch immer wieder kritische<br />
Fragen nach ihrem Erkenntnispotenzial und nach den Kriterien <strong>zur</strong> Beurteilung<br />
ihrer wissenschaftlichen Qualität entstehen.<br />
Der Beitrag möchte eine systematische Übersicht über den aktuellen<br />
Stand qualitativer Forschung in der <strong>Gesundheitspsychologie</strong> geben. Er wird<br />
erstens auf die Fragestellungen eingehen, die sich für eine qualitative Untersuchung<br />
besonders eignen; er wird zweitens die Qualität von qualitativen<br />
Studien thematisieren und Kriterien zu ihrer Beurteilung vorschlagen; und er<br />
wird drittens aktuelle Trends der qualitativen Forschung in der <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
skizzieren und Anforderung an die methodische Weiterentwicklung<br />
formulieren.<br />
Literatur:<br />
Faltermaier, T. (1997). Why public health research needs qualitative approaches. European<br />
Journal of Public Health, 7, 357-363.<br />
Meyrick, J. (2006). What is good qualitative research? Journal of Health Psychology, 11, 799-<br />
808.<br />
Murray, M. & Chamberlain, K. (Eds.) (1999). Qualitative health psychology. Theories and methods.<br />
London: Sage.<br />
Keywords:<br />
Qualitative Forschung, Qualitätskriterien<br />
66
Ist religiöses Bewältigungsverhalten in schweren<br />
Lebenskrisen eine Ressource für Personal Growth?<br />
Esther Fehlberg, Caroline Fix, Kristina Hees & Dirk Lehr<br />
Philipps-Universität Marburg<br />
dirk.lehr@med.uni-marburg.de<br />
Fragestellung: Mit zeitlichem Abstand zum Eintritt von schweren Lebenskrisen<br />
entdecken manche Betroffene positive Aspekte der Krise. Nach Maercker und<br />
Langner (2001) kann sich Personal Growth (PG) in fünf Bereichen zeigen: vertiefte<br />
Beziehung zu anderen, Entdeckung neuer Lebensmöglichkeiten, Gewinn<br />
an persönlicher Stärke, Wertschätzung des Lebens sowie religiöse Veränderungen.<br />
Ziel der Untersuchung war es, die Bedeutung von religiösem Bewältigungsverhalten<br />
in Lebenskrisen hinsichtlich des Personal Growth zu<br />
prüfen.<br />
Methode: Stichproben: N = 306 Personen, die einem Life-Event ausgesetzt<br />
waren; N = 73 chronisch somatisch erkrankte Personen. Instrumente:<br />
Inventar <strong>zur</strong> „Posttraumatischen Persönlichen Reifung“ sowie eine von den<br />
Autoren entwickelte deutsche Adaptation des RCOPE (Pargament et al., 1998,<br />
2000). Der RCOPE erlaubt eine multidimensionale Diagnostik von Religious<br />
Coping. Dabei sollen funktionale und dysfunktionale Aspekte von religiösem<br />
Bewältigungsverhalten erfasst werden.<br />
Ergebnisse: Faktorenanalytisch zeigte sich der RCOPE im interkulturellen<br />
Vergleich weitgehend stabil. Die 7 RCOPE-Skalen (z. B. aktives Vertrauen in<br />
Gott, Unzufriedenheit mit Gott, Suche nach sozial-spiritueller Unterstützung<br />
sowie zwei Querschnittsskalen positive / negative religiöse Bewältigung)<br />
zeigten zufriedenstellende bis sehr gute Reliabilitäten (Alpha = .71- .95). Fast<br />
alle RCOPE-Skalen wiesen substanzielle, positive Zusammenhänge mit den<br />
fünf Dimensionen des PG nach Life-Event auf (mittleres r = .28). Die multiplen<br />
Korrelationen lagen zwischen R = .15 für „vertiefte Beziehungen“ und R = .54<br />
für „religiöse Veränderungen“.<br />
In Bezug auf chronisch erkrankte Personen waren die Assoziationen zu<br />
den Facetten des PG durchschnittlich stärker ausgeprägt (mittleres r = .41). In<br />
beiden Studien wurden für positives Coping mittlere bis hohe Assoziationen mit<br />
Personal Growth beobachtet (.32
Erste Ergebnisse <strong>zur</strong> Integration gesundheitspsychologischer<br />
Paradigmen in das adaptierte „Gruppentraining<br />
gesundheitsförderlicher Selbstsicherheit“<br />
Ina Fietz-Schwarzrock, Ilona Seifer, Elke Hackmann & Norbert<br />
Krischke<br />
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg<br />
ina@iiiiiii.org<br />
Fragestellung: Wie wirkt sich das adaptierte „Gruppentraining gesundheitsförderlicher<br />
Selbstsicherheit“ (GGS) von Fietz-Schwarzrock und Seifer<br />
(unveröff.), welches aus der Integration des kognitiv-verhaltenstherapeutischen<br />
„Gruppentrainings sozialer Kompetenzen“ (GSK) von Hinsch und Pfingsten<br />
(2002) und dem sozial-kognitiven „Health Action Process Approach“ (HAPA)<br />
von Schwarzer (2004) entstanden ist, in Bezug auf die Umsetzung und Aufrechterhaltung<br />
selbstsicherer Verhaltensweisen im Alltag aus?<br />
Methode: Das GGS wurde als Studie mit einem Messwiederholungsdesign<br />
(Beginn des Trainings, Ende und 3-Monats-Katamnese) in vier Durchgängen<br />
(N = 31) im Rahmen der Hochschulambulanz für Lehre und Forschung<br />
der Universität Oldenburg durchgeführt. Neben einer Einführungsveranstaltung<br />
umfasst das GGS acht weitere Sitzungen und ein Aufrechterhaltungstreffen.<br />
Elemente der Modifikation sind eine vertiefte Psychoedukation mit entsprechenden<br />
Übungen für die Bereiche <strong>Gesundheitspsychologie</strong>, Ressourcen,<br />
Entspannung, Angst, Selbstverbalisation und Rückfallprophylaxe.<br />
Ergebnisse: Die bisher erhobenen klinisch und gesundheitspsychologisch<br />
relevanten Daten für selbstsicheres Verhalten sprechen in der Tendenz für eine<br />
gesteigerte Selbstwirksamkeitserwartung (SWE), welche eine zentrale<br />
Komponente des HAPA-Modells darstellt. Die SWE ist eine grundlegende<br />
Ressource <strong>zur</strong> Erhöhung des subjektiven Wohlbefindens. Gezeigt wird, dass<br />
eine hohe SWE darüber hinaus die Voraussetzung für eine klare Zielsetzung,<br />
Planung und Umsetzung selbstsicheren und somit gesundheitsförderlichen<br />
Verhaltens ist. Dargestellt wird weiterhin, welchen Einfluss eine umfassende<br />
Psychoedukation und Rückfallprophylaxe für die dauerhafte Aufrechterhaltung<br />
der neuen Verhaltensweisen hat. Ausblickend soll durch weitere Daten belegt<br />
werden, welchen Stellenwert das Aufrechterhaltungstreffen für die Festigung<br />
der erlernten Selbstsicherheit hat und weiterhin wird diskutiert, inwieweit langfristig<br />
gesehen daraus Gewohnheiten absehbar sind.<br />
Keywords:<br />
<strong>Gesundheitspsychologie</strong>, HAPA, Selbstsicherheitstraining<br />
68
Stressprävention per Internet: Evaluation eines Online-<br />
Trainings für Jugendliche<br />
Mirko Fridrici & Arnold Lohaus<br />
Universität Bielefeld<br />
mirko.fridrici@uni-bielefeld.de<br />
Jugendliche sind eine besonders anspruchsvolle Zielgruppe, wenn es um die<br />
Implementierung präventiver Trainingsprogramme geht: Der Bedarf an Maßnahmen<br />
<strong>zur</strong> Förderung des Bewältigungspotenzials im Umgang mit Stress und<br />
Problemen ist in der Adoleszenz zwar groß, doch häufig besteht das Problem,<br />
dass die Jugendlichen selbst nur ein geringes Interesse an entsprechenden<br />
Präventionsprogrammen haben. Der Einsatz des Internets als mittlerweile weit<br />
verbreitetes und immer noch attraktives Medium bietet hier jedoch die Möglichkeit,<br />
gesundheitsrelevante Themen zielgruppengerecht zu vermitteln. Im Vortrag<br />
werden die Ergebnisse einer aktuellen Trainingsstudie berichtet, in der eine<br />
neu entwickelte Online-Variante des Stresspräventionsprogramms „SNAKE –<br />
Stress Nicht Als Katastrophe Erleben“ mit der klassischen Trainingsversion im<br />
Hinblick auf ihre Wirksamkeit sowie ihre Akzeptanz durch die teilnehmenden<br />
Jugendlichen verglichen wurde. 23 Schulklassen der Stufen acht und neun<br />
bildeten die Trainingsstichprobe, während die Schülerinnen und Schüler<br />
weiterer 10 Schulklassen zusätzlich als Kontrollgruppe untersucht wurden. Je<br />
eine Woche vor und nach der Intervention wurden in allen Untersuchungsgruppen<br />
Wissensfragen zu Stress und Stressbewältigung sowie Fragen <strong>zur</strong><br />
wahrgenommenen Stressvulnerabilität, zum Stressbewältigungsverhalten sowie<br />
<strong>zur</strong> Stresssymptomatik gestellt. Eine Follow-Up-Erhebung fand zwei Monate<br />
nach Trainingsende statt. Die Trainingsgruppen wurden darüber hinaus <strong>zur</strong><br />
Bewertung der jeweiligen Programmform befragt.<br />
Keywords:<br />
Stressprävention, Jugendliche, Internet<br />
69
Anforderungsbewältigung im aktuellen gesellschaftlichen<br />
Wandlungsprozess – eine gesundheitspsychologische<br />
multizentrische Studie<br />
Angelika Gärtner, Harry Schröder & Konrad Reschke<br />
Universität Leipzig, Institut für Psychologie II<br />
gaerta@web.de<br />
Aktuelle gesellschaftliche Veränderungen in den modernen Industrieländern<br />
haben substanzielle Auswirkungen auf alle Lebensbereiche von Menschen,<br />
damit auch auf ihren Belastetheitsgrad und ihren Gesundheitsstatus. In einem<br />
deutsch-polnischen Kooperationsprojekt zwischen der Universität Leipzig und<br />
der Adam Mickiewicz Universität Poznan wurde auf Basis eines Anforderungs-<br />
Bewältigungs-Paradigmas eine gesundheitspsychologische Untersuchung <strong>zur</strong><br />
Analyse von Anforderungen, selbstregulatorischen Basiskompetenzen sowie<br />
Lebensqualitätsmerkmalen im Kontext makrosozialer Umbrüche durchgeführt.<br />
Schwerpunkt der empirischen Datenerfassung bildete eine binationale<br />
Fragebogenerhebung, in deren Ergebnis ein Datenpool von insgesamt 1555<br />
Respondenten vorliegt. Gemäß dem Triangulationsansatz wurden ergänzend<br />
Einzelinterviews durchgeführt. Mittels deskriptiver, inferenzstatistischer und<br />
multivariater Prozeduren erfolgten vergleichende Analysen unterschiedlicher<br />
Personengruppen, wobei ein Fokus auf der Gegenüberstellung der Nationalitäten<br />
lag.<br />
Polnische Befragte berichten mehr beruflichen Handlungsdruck, zugleich<br />
aber auch größere Handlungsspielräume und berufsbezogene Ressourcen als<br />
deutsche Studienteilnehmer. Deutsche Probanden sind lebenszufriedener und<br />
etwas weniger stressbelastet. Anforderungscharakteristika können unter den<br />
Dimensionen Kontrollierbarkeit und Anforderungsintensität subsumiert werden;<br />
die Separierung personenbezogener Anforderungstypen ist möglich. Erlebte<br />
Kontrolle stellt sich als entscheidend für ein hohes Maß an Lebensqualität und<br />
einen geringen Belastetheitsstatus heraus. Sense of Coherence, Seelische<br />
Gesundheit, Selbstwertgefühl, Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung sowie<br />
Proactive Coping stellen sich als bedeutsamste Mediatoren für Prozesse der<br />
Anforderungsbewältigung dar. Durch Strukturmodellierung konnten die erhaltenen<br />
Befunde in ihren Hauptaussagen bestätigt werden.<br />
Keywords:<br />
Makrosoziale Transition, <strong>Gesundheitspsychologie</strong>, Anforderungs-Bewältigungs-Paradigma<br />
70
Lebensstilintegrierte sportliche Aktivität – Wirkungsanalyse<br />
der theoriegeleiteten Intervention MoVo-LISA in<br />
der orthopädischen Rehabilitation<br />
Wiebke Göhner, Caroline Mahler, Harald Seelig & Reinhard Fuchs<br />
Universität Freiburg, Institut für Sport und Sportwissenschaft<br />
wiebke.goehner@sport.uni-freiburg.de<br />
Patienten in der stationären Rehabilitation sind meist hoch motiviert, die<br />
während der Reha-Maßnahme praktizierte körperliche Aktivität in ihren Lebensstil<br />
zu integrieren. Wie Fuchs (2006) im MoVo-Modell beschreibt, scheint jedoch<br />
die Aufrechterhaltung von regelmäßiger körperlicher Aktivität an mangelnden<br />
volitionalen Kompetenzen der Patienten zu scheitern. Die theoriegeleitete Intervention<br />
MoVo-LISA hat zum Ziel, Patienten für die Zeit nach der Rehabilitation<br />
so vorzubereiten, dass es ihnen gelingt, regelmäßige körperliche Aktivität<br />
dauerhaft in ihren Alltag zu integrieren. Zusätzlich zum Standard-<br />
Rehaprogramm wurden in drei Gruppensitzungen während des stationären<br />
Aufenthalts volitionale Kompetenzen <strong>zur</strong> Spezifizierung aktivitätsrelevanter<br />
Pläne und <strong>zur</strong> Identifizierung und Überwindung potenzieller Barrieren vermittelt.<br />
Fortgeführt wurden diese Maßnahmen in der Zeit nach der Rehabilitation durch<br />
die Anfertigung eines Aktivitätsprotokolls, die Zusendung von Remindern und<br />
einen kurzen telefonischen Kontakt.<br />
Die Wirkung der Intervention wurde im Rahmen einer längsschnittlichen<br />
Kontrollgruppenstudie mit drei Messzeitpunkten überprüft. Hierzu wurden<br />
Fragebogendaten zwei Wochen vor (t1) und am Ende (t2) des Klinikaufenthaltes<br />
sowie drei und sechs Monate (t3; t4) nach der Entlassung erhoben.<br />
Die Daten der Interventionsgruppe (n = 154) wurden mit denen einer Kontrollgruppe<br />
(n = 330), die ein Standard-Rehaprogramm durchlief, varianzanalytisch<br />
verglichen.<br />
In den Ergebnissen zeigen sich sowohl für das Kriterium Sport- und Bewegungsverhalten<br />
wie auch bei den psychologischen Moderatoren /Mediatoren<br />
Selbstwirksamkeit, Konsequenzerwartungen, Intentionsstärke und Planungstiefe<br />
signifikante Interaktionseffekte (Gruppe x MZP). Die Unterschiede deuten<br />
darauf hin, dass Teilnehmer der MoVo-LISA Intervention im Hinblick auf die<br />
beschriebenen Größen profitierten und es ihnen eher als bei einem reinen<br />
Standard-Rehaprogramm gelingt, körperliche Aktivität in den Alltag zu<br />
integrieren.<br />
Keywords:<br />
Rehabilitation, Motivation, Volition<br />
71
„Wenn im Kopf etwas nicht so richtig ist“ – Wissen,<br />
Konzepte und Einstellungen von Kindern über<br />
psychische Auffälligkeiten am Beispiel der Störung des<br />
Sozialverhaltens<br />
Angela Gosch<br />
Fachhochschule München, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften<br />
gosch@fhm.edu<br />
Fragestellung: Angesichts steigender Prävalenzzahlen von psychischen Auffälligkeiten<br />
im Kindes- und Jugendalter (vgl. Bella-Studie der Kinder- und<br />
Jugendgesundheitsstudie des RKI, Ravens-Sieberer et al., 2006), sind zunehmend<br />
auch Kinder und Jugendliche ohne derartige Auffälligkeiten in der<br />
Schule oder in der Freizeit (z. B. Sportverein) mitbetroffen. Welches Wissen<br />
Kinder über psychische Auffälligkeiten und Problemmerkmale, über Wirkungs-<br />
Ursachen-Zusammenhänge, über Behandlungsmaßnahmen haben und über<br />
welche Einstellungen sie verfügen soll am Beispiel der Störung des Sozialverhaltens<br />
in der vorliegenden Studie untersucht werden.<br />
Methode: Zunächst wurden mittels qualitativer Interviews bei 13 Kindern<br />
und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen ihr Wissen, ihre Konzepte und<br />
ihre Einstellungen über psychische Störungen erfasst. Daran anschließend<br />
wurden in einer weiteren Studie Viert- und Sechs-Klässlern eine Fallvignette<br />
über die Störung des Sozialverhaltens präsentiert und sie beantworteten<br />
Fragen zu ihrer Einstellung, ihrem Wissen über psychische Störungen,<br />
Problemmerkmale, Wirkungs-Ursachen-Zusammenhänge, Behandlungsmaßnahmen<br />
sowie über eigene Verhaltensweisen. Zusätzlich wurde den Kindern<br />
der Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ, Goodman, 1997) vorgelegt,<br />
um psychische Auffälligkeiten zu erfassen. Weiterhin wurden Determinanten<br />
wie Geschlecht, Alter, Migrationsstatus und familiärer Wohlstand (FAS, Currie<br />
et al., 2004) in die Untersuchung einbezogen.<br />
Ergebnisse: Die Ergebnisse der Studien werden vorgestellt und die Einflüsse<br />
von psychischen Störungen sowie der o.g. Determinanten auf das kindliche<br />
Wissen, ihre Konzepte und Einstellungen diskutiert. Des Weiteren stellt<br />
sich die Frage, wie zukünftig Informations- und Aufklärungsmaterial gestaltet<br />
und derartige Informationsprojekte in Schulen implementiert werden können.<br />
Literatur:<br />
Currie, C. et al. (2004). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International<br />
report from the 2001/2002 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2004.<br />
Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of<br />
Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 38, 581-586.<br />
Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Bettge, S. & Erhart, M. (2006). Modul Psychische Gesundheit<br />
(Bella Studie). [http://www.kiggs.de/experten/ erste_ergebnisse/symposium/index.html].<br />
Keywords:<br />
kindliche Konzepte, psychische Störungen<br />
72
Förderung des Mundgesundheitsverhaltens in der<br />
zahnärztlichen Praxis – werden Auswirkungen auf<br />
psychologische Mediatoren des Gesundheitsverhaltens<br />
erzielt?<br />
Nicole Granrath, Simona Mitter & Renate Deinzer<br />
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Medizinische Psychologie<br />
nicole.granrath@uni-duesseldorf.de<br />
Fragestellung: Maßnahmen <strong>zur</strong> Förderung der Mundgesundheit erfolgen in der<br />
Regel durch zahnmedizinisches Fachpersonal (ZMF) in der Zahnarztpraxis. Die<br />
vorliegende Studie untersucht, ob es diesen Maßnahmen gelingt, psychologische<br />
Mediatoren des Gesundheitsverhaltens zu erreichen. Eine weitere<br />
Fragestellung befasst sich mit der Akzeptanz psychologischer Interventionstechniken<br />
im Rahmen von Prophylaxesitzungen.<br />
Methode: Die untersuchte Stichprobe besteht aus 33 Probanden. Diese<br />
wurden in 5 Zahnarztpraxen rekrutiert. Die randomisierte Zuordnung der Probanden<br />
zu einer Kontroll- und einer Untersuchungsgruppe erfolgte für jede<br />
Praxis gesondert. Nach 7 Tagen wurden das mundgesundheitsspezifische<br />
Wissen, die Selbstwirksamkeitserwartungen, die wahrgenommenen Vor- und<br />
Nachteile und die Stufe der Verhaltensänderung (Transtheoretisches Modell)<br />
bezüglich der Durchführung von Approximalhygiene erfasst. 20 Patienten erklärten<br />
sich nach der Intervention <strong>zur</strong> Teilnahme an einem qualitativen Interview<br />
bereit.<br />
Ergebnisse: Bezüglich der Durchführung von Approximalhygiene nahmen<br />
die Probanden der Untersuchungsgruppe, im Gegensatz zu den Kontrollen,<br />
mehr Vorteile (p = 0.001; d = 2.39) und weniger Nachteile (p = 0.04; d = 1.84)<br />
wahr, schätzten sich selbstwirksamer ein (p = 0.01; d = 1,.6) und befanden sich<br />
in höheren Stufen der Verhaltensänderung (p = 0.04). Dagegen verfügten sie<br />
über keinen höheren Wissensstand (p = 0.17; d = 0.31).<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass Maßnahmen <strong>zur</strong> Förderung des Mundgesundheitsverhaltens<br />
Mediatoren des (Mund-) Gesundheitsverhaltens beeinflussen;<br />
bezüglich der Wissensvermittlung zeigten sich jedoch auch Defizite.<br />
Die Ergebnisse der qualitativen Interviews ergaben, dass viele psychologische<br />
Interventionstechniken, wie sie bereits in anderen gesundheitswissenschaftlichen<br />
Kontexten identifiziert wurden, bei den hier befragten Probanden<br />
akzeptiert würden und als effektiv eingeschätzt wurden, um weitere Interventionserfolge<br />
zu erzielen.<br />
Keywords:<br />
Mediatoren, Mundgesundheit<br />
73
Gesundheitsförderung an Schulen in Ostwürttemberg<br />
Cornelia Groß, Stefanie Meier, Heike Eschenbeck, Tobias Haas &<br />
Carl-Walter Kohlmann<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
cornelia.gross@ph-gmuend.de<br />
Nicht zuletzt durch die Teilnahme am Europäischen Netzwerk Gesundheitsfördernder<br />
Schulen der WHO (1993) hat die Gesundheitsförderung an<br />
deutschen Schulen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Durch den<br />
aktuellen Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KIGGS; Kurth, 2006) des<br />
Robert-Koch-Instituts wird deutlich, dass gesundheitliche Probleme (z. B. Übergewicht<br />
und Adipositas) bei Kindern und Jugendlichen weit verbreitet sind. Als<br />
Ansatzpunkt für Präventionsprogramme und Informationsvermittlung zu<br />
gesundheitsrelevanten Themen ist das Setting Schule prädestiniert, da über die<br />
Schule ganze Alterskohorten einer Region erreicht werden können. Um zu erfassen,<br />
in welchem Ausmaß und zu welchen Themen gesundheitsfördernde<br />
Maßnahmen an Schulen der Region Ostwürttemberg durchgeführt werden,<br />
wurde im Rahmen des Forschungsprojekts Vernetzte Gesundheitsförderung in<br />
der Schule (VEGIS) eine Befragung der Schulen durchgeführt.<br />
Mithilfe eines strukturierten Fragebogens wurden 215 Allgemeinbildende<br />
Schulen zu bereits durchgeführten und unmittelbar geplanten Projekten im Bereich<br />
Prävention und Gesundheitsförderung befragt. Weiterhin wurden<br />
Themenwünsche für Fort- und Weiterbildungsprogramme im Bereich Gesundheitsförderung<br />
erfasst.<br />
Der Auswertung liegen die beantworteten Fragebögen von 50 % der angeschriebenen<br />
Schulen zugrunde. Sowohl durchgeführte als auch geplante<br />
Projekte sind überwiegend in den Bereichen Ernährung, Bewegung sowie Gewalt-<br />
und Suchtprävention angesiedelt. Diese Verteilung zeigt sich auch in der<br />
Nachfrage für Fort- und Weiterbildungsthemen. Neben Veranstaltungen zum<br />
Thema Ernährung und Bewegung wurden hier auch Informationen über Essstörungen<br />
und Adipositas gewünscht. Im vorliegenden Beitrag soll gezielt auf<br />
die Gesundheitsprofile in Abhängigkeit von Schultypen eingegangen werden.<br />
Literatur:<br />
Kurth, B.-M. (2006). Symposium <strong>zur</strong> Studie <strong>zur</strong> Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in<br />
Deutschland. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 49,<br />
1050-1058.<br />
Keywords:<br />
Prävention, Gesundheitsförderung, Schule<br />
74
Gesundheitspsychologische Paradigmen <strong>zur</strong> Effektivitätssteigerung<br />
eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen<br />
Gruppentrainings sozialer Kompetenzen<br />
Elke Hackmann, Ina Fietz-Schwarzrock, Ilona Seifer & Norbert R.<br />
Krischke<br />
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg<br />
elke.hackmann@gmx.de<br />
Fragestellung: Kann das Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK) von<br />
Hinsch und Pfingsten (2002) durch die Anwendung des sozial-kognitiven<br />
Prozessmodells gesundheitlichen Handelns (HAPA) von Schwarzer (2004) in<br />
seiner Effektivität bezüglich der Verhaltensmodifikation der Teilnehmer verbessert<br />
werden? Welche Aspekte des HAPA sind bereits im GSK enthalten,<br />
welche sollten in einer Weiterentwicklung des Trainings integriert werden?<br />
Methode: Das GSK wurde im Rahmen der Hochschulambulanz für Lehre<br />
und Forschung in der Universität Oldenburg durchgeführt. Nach 3 Monaten<br />
erfolgte eine Nachbefragung anhand eines Interviewleitfadens. Erfasst wurden<br />
die Ausprägungen der HAPA-Komponenten bezogen auf die 3 Situationstypen<br />
des GSK, die Entspannungsübung und Selbstverbalisation. Weitere Fragen<br />
betrafen den Umsetzungserfolg und die Rückfallprophylaxe. Die Auswertung<br />
erfolgte nach Mayring (2003).<br />
Ergebnisse: Dargestellt werden die Ergebnisse <strong>zur</strong> Ausprägung der<br />
einzelnen HAPA-Komponenten. Bei sozialen Ängsten sollte zwischen zwei<br />
Formen der Risikowahrnehmung unterschieden werden. Die Vpn sehen z. B.<br />
mangelnde Selbstsicherheit als Risiko für ihre Gesundheit an. Andererseits<br />
fürchten sie auch die Konsequenzen, die das neu gezeigte sozial kompetente<br />
Verhalten hervorruft, wie z. B. das Entstehen von Konflikten durch neue Rollenverteilungen.<br />
Weiterhin wurden mehrere während der Handlung aufgetretene<br />
Barrieren kategorisiert, wie die unerwünschte Reaktion des Partners oder Angst<br />
vor Ablehnung. Die Auswertung der Fragen <strong>zur</strong> volitionalen Phase ergab u. a.,<br />
dass nur 2/3 der Vpn Ausführungsintentionen und nur eine Vp einen<br />
detaillierten Wenn-dann-Plan ausbildeten. Alle Vpn hätten sich eine Rückfallprophylaxe<br />
gewünscht. Eine Weiterentwicklung des GSK, durch die Stärkung<br />
der motivationalen HAPA-Komponenten, sowie die Unterstützung bei der Zielbildung,<br />
Initiative und Aufrechterhaltung des sozial kompetenten Verhaltens<br />
sollte den Umsetzungserfolg in zukünftigen Trainings verbessern.<br />
Keywords:<br />
<strong>Gesundheitspsychologie</strong>, GSK, Risikowahrnehmung<br />
75
Impliziter Assoziationstest und Alkoholkonzept bei<br />
Kindern<br />
Uwe Heim-Dreger, Heike Eschenbeck & Carl-Walter Kohlmann<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
uwe.heim-dreger@ph-gmuend.de<br />
Ein wichtiger Beitrag in der sozialkognitiven Forschung der letzten Dekade war<br />
die Entwicklung von Verfahren <strong>zur</strong> Untersuchung impliziter Einstellungen,<br />
Stereotype und Selbstkonzepte. Eines dieser Verfahren, der implizite<br />
Assoziationstest (IAT, Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998) wurde angepasst,<br />
um das Alkoholkonzept von Grundschulkindern (Klasse 2 und 4,<br />
N = 67) zu untersuchen. Der IAT basiert auf einer doppelten Diskriminationsaufgabe.<br />
Beim Alkohol-IAT müssen die Teilnehmer einzelne Bilder (Erwachsene,<br />
Kinder, alkoholische sowie nichtalkoholische Getränke) einer von<br />
zwei gepaarten Zielkategorien zuordnen. Diese sind einmal kompatibel zum<br />
jeweiligen Konzept (Erwachsene + Alkohol vs. Kinder + Nichtalkohol), in einer<br />
zweiten Experimentalbedingung inkompatibel (Erwachsene + Nichtalkohol vs.<br />
Kinder + Alkohol). Unterschiede in den Reaktionszeiten bei unterschiedlichen<br />
Bedingungen werden als Indikatoren der relativen Verbindung zwischen den<br />
Konzepten interpretiert.<br />
Berichtet werden Zusammenhänge mit in Interviews explizit erfassten Einstellungen<br />
der Kinder zum Alkoholkonsum anderer und zu wahrgenommenen<br />
Normen des Alkoholkonsums sowie kritische Punkte beim Einsatz des IAT bei<br />
Kindern dieser Altersstufe.<br />
Keywords:<br />
IAT, Alkohol, Kinder<br />
76
Wer erhält mehr? Wer gibt mehr? Soziale Unterstützung<br />
in Partnerschaften<br />
Annett Heinicke, Manja Vollmann & Katja Antoniw<br />
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald<br />
annett_heinicke@yahoo.de<br />
Fragestellung: Soziale Unterstützung in Partnerschaften gilt als ein wichtiger<br />
Prädiktor sowohl für die psychische als auch für die physische Gesundheit.<br />
Obgleich in verschiedenen Studien Geschlechtsunterschiede in Bezug auf die<br />
gesundheitsförderliche Wirkung sozialer Unterstützung gefunden wurden, sind<br />
Geschlechtsunterschiede in Bezug auf Unterstützungsprozesse in Partnerschaften<br />
weniger erforscht. Deshalb war das Ziel der vorliegenden Studie,<br />
Geschlechtsunterschiede hinsichtlich erhaltener und gegebener Unterstützung<br />
sowie hinsichtlich der Reziprozität der Unterstützungsleistungen und der<br />
Übereinstimmung in den Einschätzungen zwischen den Partnern zu untersuchen.<br />
Methode: An der Studie nahmen 111 Paare (N = 222) teil. Per Fragebogen<br />
wurde die innerhalb der letzten 6 Monate vom Partner erhaltene sowie<br />
die dem Partner gegebene emotionale, instrumentelle und informationelle<br />
Unterstützung erfasst.<br />
Ergebnisse: Insgesamt berichteten Frauen im Vergleich zu Männern ihren<br />
Partnern mehr emotionale Unterstützung zu geben, während Männer im Vergleich<br />
zu Frauen angaben, ihren Partnerinnen mehr instrumentelle Unterstützung<br />
zu geben. Weiterhin berichteten die Frauen im Vergleich zu den<br />
Männern, mehr emotionale und mehr instrumentelle Unterstützung von ihren<br />
Partnern zu erhalten. In Bezug auf die Reziprozität zeigte sich insbesondere für<br />
die instrumentelle Unterstützung, dass Frauen weniger und Männer mehr<br />
Unterstützung gegeben haben als sie selbst erhielten. In Bezug auf die<br />
Übereinstimmung der Einschätzungen zwischen den Partnern ergaben sich<br />
Diskrepanzen für die emotionale Unterstützung derart, dass Frauen angaben<br />
mehr Unterstützung zu erhalten, als deren Partner berichteten zu geben und<br />
dass Männer angaben weniger Unterstützung zu erhalten als deren<br />
Partnerinnen berichteten zu geben.<br />
Literatur:<br />
Barbee, A. P. et al. (1993). Effects of gender role expectations on the social support process.<br />
Journal of Social Issues, 49, 175-190.<br />
Keywords:<br />
soziale Unterstützung, Reziprozität, Geschlechtsunterschiede<br />
77
Stufen der Veränderung und Langzeiteffekte eines<br />
stationären kognitiv-verhaltenstherapeutischen<br />
Programms bei Angsterkrankungen<br />
Petra Ivert 1 , Madlen Kraft 1 & Edgar Geissner 2<br />
1 Medizinisch-Psychosomatische Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee<br />
2 Medizinisch-Psychosomatische Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee und<br />
Department Psychologie der Universität München<br />
PIvert@schoen-kliniken.de<br />
Patienten, die an einer Angsterkrankung leiden, werden im allgemeinen in<br />
unterschiedlichen motivationalen Zuständen vorgefunden, z. B. Vermeidung<br />
des Problems, oder aber Anerkennen des Problems und Handlungsinitiierung<br />
oder gar bereits Ausdauer beim Einüben neuer angstinkompatibler Verhaltensweisen.<br />
Klinische Eindrücke demonstrieren immer wieder, dass das rein<br />
mechanische Durchlaufen (wenig persönliche Einlassung und Anstrengung)<br />
eines Therapieprogramms bei der Reduktion der Angst fehlschlagen kann.<br />
Insofern war es ein Anliegen der Studie, diese Beobachtungen systematischer<br />
zu analysieren und sie durch Daten zu stützen.<br />
Die Studie umfasste 130 Patienten, die an einer behandlungsbedürftigen<br />
Angstproblematik litten (t 0 bis t 3: Anmeldung, Aufnahme, Entlassung und 6-<br />
Montas-FU). Die Angst wurde mit anerkannten klinischen Verfahren gemessen<br />
(BAI, ACQ, MI, BSQ, SCL). Die Motivationsfaktoren wurden mit einem auf die<br />
Angstproblematik zugeschnittenen Fragebogen gemessen, (adaptiert aus dem<br />
Schmerzbereich; Maurischat) dessen theoretischer Rahmen das Prochaska-<br />
DiClemente- Modell ist. Die Behandlung bestand aus Einzel- und Gruppentherapie,<br />
gezielten kognitiven und Expositionselementen sowie intensiven<br />
Einzelübungen.<br />
Die Daten belegen überzeugend die Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit<br />
des Programms. Körpersymptome und Mobilitätseinschränkungen konnten<br />
massiv verbessert werden, die Angstkognitionen veränderten sich ebenfalls<br />
signifikant in erwünschter Richtung. Erwartungsgemäß spielten auch die<br />
Motivationsfaktoren eine wichtige Rolle. Hoch motivierte Patienten unterschieden<br />
sich deutlich von gering Motivierten. Sie vermieden weniger, gingen<br />
das Problem aktiver an und behielten ihre Expositionsübungen ausdauernder<br />
bei, wodurch sich deren Angst deutlicher verbesserte. Als besonders wichtig<br />
erwiesen sich die Motivationsfacetten „Ausdauer“ und „Erfolgserhaltung“.<br />
Erfolgreiche Angstbehandlung könnte daher noch weiter verbessert<br />
werden, wenn auf die angstbezogenen Motivationsfacetten gezielt eingegangen<br />
würde. Besonderes Augenmerk muss auf diejenigen Patienten gerichtet<br />
werden, die einen vermeidenden, misserfolgsorientierten Bewältigungsstil<br />
pflegen, leicht aufgeben oder sekundäre Vorteile wegen der Angst haben.<br />
Keywords:<br />
Stufen-der-Veränderung, Therapiemotivation, Angstbehandlung<br />
78
Stressbelastung und Stressbewältigung in der<br />
stationären Altenpflege<br />
Brigitte Jenull-Schiefer & Eva Brunner<br />
Alpen Adria Universität Klagenfurt / Institut für Psychologie<br />
brigitte.jenull-schiefer@uni-klu.ac.at<br />
Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Prognosen sprechen von einer Verdreifachung<br />
der sehr alten, über 85-jährigen Menschen bis zum Jahr 2050<br />
(Statistik Austria, 2003). Mit zunehmender Langlebigkeit erhöht sich die Anfälligkeit<br />
für körperliche und psychische Erkrankungen (Land & Yang, 2006) und<br />
das Risiko, hilfs- und pflegebedürftig zu werden, steigt. Pflegeheime übernehmen<br />
immer häufiger die Versorgung, werden aber aufgrund finanzieller und<br />
personeller Engpässe der Aufgabe, würdiges und aktives Altern zu ermöglichen,<br />
nicht immer gerecht. Das Projekt „Geri-Aktiv“ untersucht Stressoren und<br />
Ressourcen in der stationären Altenpflege. Die in zwei Bundesländern Österreichs<br />
(Wien, Kärnten) durchgeführte Fragebogenstudie (N = 1134) bestätigt<br />
bisherige Ergebnisse, dass hoher Zeitdruck und mangelnde Anerkennung die<br />
führenden Stressoren darstellen. Als wesentliche Strategien im Umgang mit<br />
Belastungen werden Sport und die soziale Unterstützung durch Familie und<br />
Freunde genannt. In Erweiterung und <strong>zur</strong> Absicherung dieser quantitativen Ergebnisse<br />
werden in einer laufenden Studie qualitative Interviews mit Pflegeheimmitarbeiterinnen<br />
(N = 25) durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet.<br />
Die Studienteilnehmerinnen berichten kritische Bewältigungsstrategien wie<br />
Rauchen, übermäßige Nahrungsaufnahme und erhöhten Medikamentenkonsum,<br />
darüber hinaus werden institutionelle Vorgaben, Zeitdruck und daraus<br />
resultierende strukturelle Gewalt thematisiert. In Anbetracht der demografischen<br />
Herausforderung und einem steigenden Bedarf an qualifizierten Pflegepersonen<br />
sollten dringend Maßnahmen für eine gezielte Gesundheitsförderung im Setting<br />
Pflegeheim geplant und umgesetzt werden.<br />
Literatur:<br />
Land, K. & Yang, Y. (2006). Morbidity, disability, and mortality. In R. Binstock & L. George, L.<br />
(Eds.), Handbook of Aging and the Social Sciences (pp. 51 -58). Amsterdam,<br />
Netherlands: Elsevier.<br />
Statistik Austria (Hrsg.). (2003). Bevölkerung Österreichs im 21. Jahrhundert. Wien: Statistik<br />
Austria.<br />
Keywords:<br />
Stress, Bewältigungsstrategien, Pflegeheime<br />
79
Erste Ergebnisse eines Gruppenprogramms <strong>zur</strong><br />
Förderung von Ressourcen für Angehörige von<br />
Demenzkranken<br />
Tanja Kalytta & Gabriele Wilz<br />
Technische Universität Berlin<br />
kalytta@gp.tu-berlin.de<br />
Fragestellung: In der vorliegenden Studie wurde die Wirksamkeit eines kognitivbehavioralen<br />
Gruppenprogramms zum Abbau von Belastungen und <strong>zur</strong><br />
Förderung von Ressourcen bei pflegenden Angehörigen von Demenzpatienten<br />
in einem kontrollierten Längsschnitt-Design mit 3 Messzeitpunkten analysiert.<br />
Methode: Insgesamt wurden 68 Angehörige der Interventionsgruppe und<br />
41 Angehörige der Kontrollgruppe untersucht. Als Messinstrumente kamen<br />
Selbstratingskalen zu depressiven Symptomen (BDI, HADS-D), körperlichen<br />
Beschwerden (GBB-24) und gesundheitsbezogener Lebensqualität (SF-12)<br />
zum Einsatz. Zusätzlich wurden Belastungen und Ressourcen, wie Aspekte der<br />
Pflege und die soziale Unterstützung (F-SozU), sowie die subjektiv erlebte Zufriedenheit<br />
mit dem Programm erhoben. Berichtet werden erste Ergebnisse des<br />
Prä/Post-Vergleichs.<br />
Ergebnisse: Der Nutzen des Gruppenprogramms und die Zufriedenheit<br />
wurden als sehr hoch eingeschätzt. Die depressive Symptomatik nahm im zeitlichen<br />
Verlauf bei den pflegenden Töchtern ab. Die Befunde weisen auf mögliche<br />
Unterschiede im Belastungserleben und der Nutzung von Ressourcen<br />
zwischen betreuenden Töchtern und Ehefrauen von Demenzkranken hin. In der<br />
Durchführung eines Gruppenprogramms <strong>zur</strong> Ressourcenförderung sollte ein<br />
besonderes Augenmerk auf die Homogenität der Teilnehmer/innen gesetzt<br />
werden.<br />
Keywords:<br />
Gruppenprogramm, Angehörige, Ressourcen<br />
80
Konzepte von psychischer Gesundheit und Zugang <strong>zur</strong><br />
öffentlichen Versorgung aus der Sicht von Kindern,<br />
Jugendlichen und ihren Familien – Die AMHC-Studie<br />
(Access to Mental Health Care in Children)<br />
Christoph Käppler 1 , Marta Gonçalves 1 , Daria Gianella 2 , Sabine<br />
Zehnder 3 , Aristide Peng 3 & Meichun Mohler-Kuo 3<br />
1<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik<br />
Reutlingen<br />
2<br />
Universität Fribourg, Schweiz<br />
3<br />
Universität Zürich, Schweiz<br />
kaeppler@ph-ludwigsburg.de<br />
Fragestellung: Insgesamt 20 % der Kinder und Jugendlichen in industrialisierten<br />
Ländern leiden unter psychischen Belastungen. Bei mindestens einem Viertel<br />
dieser Kinder und Jugendlichen ist der Bedarf für professionelle Hilfe gegeben.<br />
Dennoch gelangt nur ein sehr kleiner Anteil dieser behandlungsbedürftigen<br />
Kinder und Jugend¬lichen tatsächlich in eine fachkundige Beratung oder Behandlung.<br />
Die vorliegende AMHC-Studie im Rahmen eines nationalen<br />
Forschungsprogramms in der Schweiz hat zum Ziel, ein vertiefteres Verständnis<br />
von Konzepten und Bedürfnissen im Bereich psychischer Gesundheit<br />
(-sversorgung) von Kindern zu erarbeiten, um die Abstimmung zwischen Bedarfs-<br />
und Angebotsseite zu verbessern.<br />
Methode: Das mehrphasige Projekt beinhaltet verschiedene methodische<br />
Zugänge wie eine qualitative Untersuchung (Interviews, Fokusgruppen) sowie<br />
eine quantitative Erhebung (Fragebogen) jeweils in den verschiedenen Sprachregionen<br />
der Schweiz einschließlich des Einbezugs von Migranten.<br />
Ergebnisse: Die Befunde der Studie auf der Basis qualitativer Inhaltsanalysen<br />
von 190 Einzelinterviews mit Kindern, Jugendlichen und Eltern sowie<br />
erster Analysen des Surveys mit insgesamt 1600 Teilnehmern zeigen Übereinstimmungen<br />
und Unterschiede im Wissen und den Konzepten über psychische<br />
Gesundheit und vorhandene Versorgungsangebote, die sich zwischen verschiedenen<br />
Generationen sowie zwischen Einheimischen und Migrantenfamilien<br />
erkennen lassen. Die Befunde weisen darauf hin, dass die Patientenperspektive<br />
auch bei Kindern und Jugendlichen eine wertvolle Informationsquelle<br />
für Maßnahmen <strong>zur</strong> Verbesserung des Zugangs und der Qualität des<br />
Gesundheitssystems darstellt.<br />
Literatur:<br />
Käppler, C. (2006). Psychische Gesundheit und Zugang zu professioneller Hilfe - Was denken<br />
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern darüber? In Schweizerischer Nationalfonds,<br />
Themenheft des NFP52 (Hrsg.), Antisoziales Verhalten bei Kindern, psychosoziale<br />
Risiken von Jugendlichen: Was bringt Prävention und Beratung?, 18-21.<br />
Keywords:<br />
public mental health, Gesundheitskonzepte bei Kindern und Jugendlichen<br />
81
Konstruktvalidität eines Fragebogens <strong>zur</strong> Erfassung<br />
der Angstsensitivität<br />
Christoph J. Kemper 1 & Matthias Ziegler 2<br />
1 Psychologisches Institut, Abteilung Persönlichkeitspsychologie und<br />
Diagnostik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz<br />
2 Fakultät für Psychologie und Pädagogik, Abteilung Methodenlehre und<br />
Evaluation, Ludwig-Maximilians-Universität München<br />
kemperc@uni-mainz.de<br />
Das Persönlichkeitsmerkmal Angstsensitivität beschreibt die Tendenz einer<br />
Person auf ihre eigenen Symptome der Erregung mit Furcht zu reagieren.<br />
Diese Furcht wurzelt nach Reiss in Überzeugungen, dass Erregungssymptome<br />
schädliche somatische, soziale oder kognitive Konsequenzen haben können<br />
(z. B. Krankheit, Peinlichkeit, Kontrollverlust). Das Merkmal wird als Risikofaktor<br />
für verschiedene Achse-I-Störungen, insbesondere für Angststörungen diskutiert.<br />
Es weist außerdem Zusammenhänge zu Bewältigungsdispostionen und<br />
gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen auf.<br />
Ein Fragebogenverfahren <strong>zur</strong> Erfassung des Konstrukts, der Anxiety<br />
Sensitivity Index – Revised wurde ins Deutsche übersetzt. In einer nichtklinischen<br />
Stichprobe (N = 380) wurden exploratorische und konfirmatorische<br />
Faktorenanalysen durchgeführt und konkurrente Validitäten für die gefundenen<br />
Skalen bestimmt.<br />
Es zeigte sich eine hierarchische Struktur mit einem Generalfaktor der<br />
Angstsensitivität und fünf spezifischen Faktoren: (1) Überzeugungen zu schädlichen<br />
Konsequenzen von somatischen Symptomen, (2) Furcht vor öffentlich<br />
sichtbaren Angstsymptomen, (3) Furcht vor respiratorischen Angstsymptomen,<br />
(4) Furcht vor Kontrollverlust, (5) Furcht vor somatischen Empfindungen ohne<br />
explizite Konsequenzen. Trotz der hohen Generalfaktorsättigung liefern die<br />
spezifischen Faktoren inkrementelle Informationen bei der Erklärung von<br />
psychopathologischer Symptomatik. Die interne Konsistenz des Verfahrens ist<br />
befriedigend bis gut. Möglichkeiten für den Einsatz in klinischen und nichtklinischen<br />
Stichproben werden diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Reiss, S. (1991). Expectancy model of fear, anxiety, and panic. Clinical Psychology Review, 11,<br />
141-153.<br />
Taylor, S., & Cox, B. J. (1998). An expanded anxiety sensitivity index: evidence for a hierarchic<br />
structure in a clinical sample. Journal of Anxiety Disorders, 12, 463-483.<br />
Keywords:<br />
Angstsensitivität, psychometrische Güte, Fragebogen<br />
82
Stresserleben und pathologisches Glücksspiel<br />
Nina Kirschner, Gerit Loeffler, Ulrike Hesselbarth & Sabine Grüsser<br />
Charité, Berlin<br />
n-kirschner@web.de<br />
Neuere Studien aus der Suchtforschung zeigen, dass Glücksspiel mit stoffgebundenen<br />
Süchten wesentliche Merkmale, insbesondere neurobiologische<br />
Grundlagen gemeinsam hat. In diesem Sinne kann exzessives Glücksspiel als<br />
eine Verhaltenssucht aufgefasst werden. Legt man das Stressverarbeitungsmodell<br />
der Abhängigkeit zugrunde, so dient Glücksspiel der Reduktion von<br />
Stress und Induktion positiver Gefühlszustände im Sinne einer inadäquaten<br />
Stressverarbeitungsstrategie.<br />
Ein Bindeglied zwischen Stresserleben und dem erneuten Spielen stellt<br />
das Verlangen dar, dass sich aus der Antizipation der Stimmungsverbesserung<br />
und der Stressreduktion bildet. Der Einfluss von Stresserleben und Stressverarbeitung<br />
wurde bisher hauptsächlich bei pathologischen Spielern untersucht,<br />
während diese bei Gelegenheitsspielern nur selten untersucht und zwischen<br />
beiden Gruppen verglichen wurde. In der vorliegenden Studie wurden verschiedene<br />
stressbezogene Variablen und Stressverarbeitungsstrategien als<br />
potenzielle Mediatorvariablen pathologischen Glücksspiels an 500 Personen<br />
(sowohl pathologische als auch Gelegenheitsspieler) untersucht. Pathologische<br />
Glücksspieler zeigen erhöhte Ängstlichkeits- und Depressionswerte, sowie<br />
vermehrt körperliche Beschwerden. Außerdem wiesen diese im Vergleich zu<br />
Gelegenheitsspielern vermehrt negative und positive Stressverarbeitungsstrategien<br />
sowie ein erhöhtes Stresserleben auf. Die Ergebnisse legen nahe,<br />
dass sich vor allem die Vermittlung der individuellen Funktionalität des Glücksspielkonsums<br />
und der Erwerb alternativer Stressverarbeitungsstrategien als<br />
Präventionsansätze bei Glücksspielgefährdeten eignen.<br />
Keywords:<br />
Glücksspiel, Stress, Stressverarbeitung<br />
83
Sportaktivität in der Schwangerschaft – zum Zusammenhang<br />
zwischen Aktivitätsausmaß und Wohlbefinden<br />
Jens Kleinert, Katharina Engelhard & Marion Sulprizio<br />
Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches Institut<br />
kleinert@dshs-koeln.de<br />
Die positiven Effekte von sportlicher Aktivität auf das physische und psychische<br />
Wohlbefinden sind in der Literatur mittlerweile gut belegt. Ob diese Zusammenhänge<br />
ebenso für Sportaktivität in der Schwangerschaft gelten, ist bislang<br />
weniger erforscht. Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Studie<br />
untersucht, welche Zusammenhänge zwischen Sportaktivität in der Schwangerschaft<br />
und Wohlbefinden im letzten Schwangerschaftsquartal bestehen.<br />
Darüber hinaus soll überprüft werden, ob und inwieweit die sportliche Aktivität in<br />
den ersten drei Schwangerschaftsquartalen als Prädiktor für Befindlichkeit im<br />
letzten Schwangerschaftsquartal gelten kann.<br />
Methode: Die Untersuchungsgruppe besteht aus 1245 Schwangeren im<br />
Alter von 17 - 45 Jahren (M = 30; SD = 4.92). Mittels eines Fragebogens<br />
wurden im letzten Schwangerschaftsquartal das körperliche Befinden (KB), das<br />
psychische Befinden (PB), das Aktivitätserleben (AE) sowie retrospektiv die<br />
Sportaktivität in allen vier Quartalen der Schwangerschaft (q1,q2,q3,q4) erfasst.<br />
Ergebnisse: Die Untersuchungsgruppe weist ein geringes Ausmaß<br />
aktueller sportlicher Aktivität (q4), ein eher hohes PB sowie ein hohes KB und<br />
ein positiv konnotiertes AE aus. Die aktuelle sportliche Aktivität korreliert<br />
schwach mit KB (r = .11; p < .01) und PB (r = .25; p < .01). Hinsichtlich KB ergibt<br />
sich ein signifikantes Regressionsmodell (F = 5.68; p < .01), wobei sich<br />
einzig q3 (nicht q1 und q2) als signifikanter Prädiktor (B = .10; T = 2.24; p < .05)<br />
erweist. Auch bezogen auf PB leistet einzig q4 einen signifikanten Erklärungsbeitrag<br />
(B = .23; T = 5.4; p < .01) im Regressionsmodell (F = 21.51; p < .01).<br />
Diskussion: Körperliches und psychisches Wohlbefinden im letzten<br />
Schwangerschaftsquartal hängen insbesondere mit der Sportaktivität in der<br />
zweiten Schwangerschaftshälfte zusammen. Dies betrifft das psychische Wohlbefinden<br />
stärker als das körperliche Befinden. Kausale Schlüsse müssen aufgrund<br />
der retrospektiven Erfassung der Sportaktivität mit Vorsicht gezogen<br />
werden.<br />
Keywords:<br />
Schwangerschaft, Sportaktivität, Wohlbefinden<br />
84
Determinanten unfallpräventiven Verhaltens – Eine<br />
VBG-unterstützte Befragung zum Tragen persönlicher<br />
Schutzausrüstung im professionellen Eishockeysport<br />
Jens Kleinert & Sabine Jüngling<br />
Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches Institut<br />
kleinert@dshs-koeln.de<br />
Im Bereich der Prävention von Unfällen und Verletzungen spielt neben der Verhältnisprävention<br />
die Verhaltensprävention eine bedeutsame Rolle. Die Entwicklung<br />
und Validierung modelltheoretischer Zugänge zu unfallpräventivem<br />
Verhalten ist ein eher seltener Forschungsgegenstand. Daher besteht ein<br />
Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit darin, am Beispiel unfallpräventiven<br />
Verhaltens im Sport ein motivationales Modell der Unfallprävention zu entwickeln.<br />
Weiterhin sollen erste Schritte einer Konstruktvalidierung vorgestellt<br />
werden.<br />
Methode: Basierend auf den Aussagen verschiedener Modelle des allgemeinen<br />
Gesundheitsverhaltens wurde ein Modell mit verschiedenen Einflusskomponenten<br />
auf unfallpräventives Verhalten entwickelt (u. a. Wissen über Unfälle<br />
und Verletzungen, eigene Verletzungserfahrungen, Einstellung zu unfallpräventiven<br />
Maßnahmen). Ein hierauf aufbauender Fragebogen wurde im<br />
professionellen Eishockey distribuiert (alle Vereine). Die so entstandene Stichprobe<br />
besteht aus 412 Profispielern im Alter zwischen 17 und 40 Jahren<br />
(M = 26.24, SD = 5.2). Die Daten wurden in eine explorative Faktorenanalyse<br />
eingebracht.<br />
Ergebnisse und Diskussion. Das empirische Datenmodell (EFA) gibt nur in<br />
Teilen die modelltheoretischen Ausgangskomponenten wieder. Die inhaltliche<br />
Interpretation der gefundenen Komponenten legt eine Unterteilung von Determinanten<br />
in sechs eher intentionsbildende (Verwundbarkeit, Verletzungserwartung,<br />
Wirksamkeit sowie Sinnlosigkeit der Schutzmaßnahme, Wahrnehmung<br />
sozialen Einflusses, normative Einstellung) und zwei eher volitive<br />
(ungünstige Eigenschaften vs. Zweckmäßigkeit/Einfachheit) Komponenten<br />
nahe. Die Ergebnisse einer anschließenden Korrelationsanalyse lassen sich in<br />
dieses Denkmodell einordnen. Die stärksten Zusammenhänge zum Schutzverhalten<br />
bestehen mit der Einschätzung der Zweckmäßigkeit/Einfachheit (r = .38)<br />
und der Wahrnehmung sozialen Einflusses (r = .39). Ein auf den Ergebnissen<br />
basierendes Modell muss zukünftig empirisch (CFA) geprüft werden.<br />
Keywords:<br />
Unfallprävention, Schutzausrüstung, Eishockey<br />
85
Einfluss unterschiedlicher Rückmeldungen im Rahmen<br />
eines Gesundheitschecks auf gesundheitsbezogene<br />
Intentionsbildung<br />
Jens Kleinert & Chloé Kleinknecht<br />
Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches Institut<br />
kleinert@dshs-koeln.de<br />
Problemstellung: Rückmeldungen über den Gesundheits- und Fitnesszustand<br />
sind immer häufiger Bestandteil von präventiven Maßnahmen. Die Auswirkung<br />
derartiger Rückmeldungen auf den Änderungsdruck (Fuchs, 1997) und hiermit<br />
auf gesundheitsbezogene Intentionen ist weitgehend unklar. Ziel der vorliegenden<br />
Arbeit ist es zu untersuchen, welche Auswirkungen unterschiedliche<br />
Rückmeldungsformen eines Gesundheitschecks auf die gesundheitsbezogene<br />
Intention haben.<br />
Methode: 58 Männer und 66 Frauen (Alter M = 54, SD = 15) führten einen<br />
Fitness- und Gesundheitscheck (sportmotorische und leistungsphysiologische<br />
Parameter, Gesundheitsverhalten, Gesundheitserleben) durch. Absichten,<br />
subjektive Realisierungsmöglichkeiten und Höhe des Planungsgrads bezüglich<br />
(a) des allgemeinen Gesundheitsverhaltens und (b) des Sport- und Bewegungsverhaltens<br />
wurden vor (t1) und nach dem Check (t2) erfasst. Bei der<br />
Hälfte der Probanden wurde vor t2 eine standardisierte Rückmeldung (inkl.<br />
Verhaltensempfehlungen) durchgeführt (Gruppe mitrück).<br />
Ergebnisse: Eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung<br />
auf dem Faktor Zeit (vorher - nachher) und dem Zwischensubjektfaktor Gruppe<br />
(mitrück - ohnerück) führt zu folgenden Haupteffekten. Es wird ein signifikanter<br />
Anstieg der Absichtsbildung und der Höhe des Planungsgrades erkennbar<br />
(Faktor Zeit). Der Anstieg der subjektiven Realisierungsmöglichkeiten ist nicht<br />
signifikant. Es bestehen keine signifikanten Interaktionseffekte (Gruppe x Zeit).<br />
Diskussion: Der Gesundheitscheck führt zu einer Verstärkung der gesundheitsbezogenen<br />
Intention während die Realisierbarkeit unbeeinflusst bleibt. Zusätzliche<br />
Rückmeldungen und Verhaltensempfehlungen haben auf dieses Ergebnis<br />
keinen Einfluss. Ein kurzes Gespräch über Verhaltensänderung im Anschluss<br />
an einen Gesundheitscheck beeinflusst somit Änderungsdruck, kann<br />
aber offensichtlich Umsetzungsbarrieren nur geringfügig ausgleichen.<br />
Literatur:<br />
Fuchs, R. (1997). Psychologie und körperliche Bewegung. Göttingen:Hogrefe.<br />
Keywords:<br />
Gesundheitsverhalten, Intentionsbildung, Rückmeldung<br />
86
Stresserleben in der deutschen Allgemeinbevölkerung:<br />
Ergebnisse einer repräsentativen Befragung mit dem<br />
Perceived Stress Questionnaire (PSQ)<br />
Rüya-Daniela Kocalevent 1 , Dieter Kleiber 1 , Burkhard Gusy 1 , Katja<br />
Mateev 2 & Burghard Klapp 2<br />
1 Freie Universität Berlin<br />
2 Charité Universitätsmedizin Berlin<br />
rdkocale@zedat.fu-berlin.de<br />
Fragestellung: Ziel der vorliegenden Studie war es, den für Stresserleben anfälligen<br />
Anteil einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Allgemeinbevölkerung<br />
zu identifizieren. Risikogruppen wurden anhand zentraler sozialer<br />
Faktoren, wie Partnerschafts- und Familienstand, Erwerbstätigkeit und Berufsrolle,<br />
Einkommen und Schulausbildungsdauer definiert. Methode: Eingesetzt<br />
wurde der Perceived-Stress-Questionnaire (PSQ), ein validiertes Selbstbeurteilungsverfahren<br />
<strong>zur</strong> Erfassung aktuell erlebter Belastungsfaktoren. Die<br />
Datenerhebung erfolgte durch ein Meinungsforschungsinstitut in einer Mehrthemenumfrage<br />
(N = 2552). Haushalte wurden dabei nach dem Random-<br />
Route-Verfahren ausgewählt, die Zielperson ebenfalls über eine Zufallsauswahl<br />
bestimmt.<br />
Ergebnisse: Die Punktprävalenz für ein moderat erhöhtes Stresserleben<br />
liegt bei 14.5 %, für ein sehr hohes Stresserleben bei 3.1 % der Befragten. Der<br />
durchschnittliche PSQ-Score lag bei M = 0.30 SD = 0.15 (Range: 0.00-0.90).<br />
Risikofaktoren für ein erhöhtes Stresserleben sind: Erwerbslosigkeit (M = 0.37,<br />
SD = 0.17), ein niedriges Einkommen (M = 0.33, SD = 0.17), kein Schulabschluss<br />
(M = 0.36, SD = 0.16) sowie Trennungserfahrungen (M = 0.35,<br />
SD = 0.14), Alter 40-60 (R²corr = .30, p < .001).<br />
Keywords:<br />
perceived stress, prevalence, risk factors<br />
87
Handlungs-versus-Lage-Orientierung und erfolgreiche<br />
Angstbehandlung<br />
Madlen Kraft 1 , Petra Ivert 1 & Edgar Geissner 1 , 2<br />
1<br />
Medizinisch-Psychosomatische Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee<br />
2<br />
Department Psychologie der Universität München<br />
egeissner@schoen-kliniken.de<br />
Patienten mit Angsterkrankungen, die an einer stationären kognitivverhaltenstherapeutischen<br />
Behandlung teilnehmen, unterscheiden sich – wie<br />
klinische Beobachtungen zeigen – in ihrem Outcome sehr. Hierfür können<br />
Komorbiditäten, aber auch unterschiedliche Motivation und Attribution verantwortlich<br />
sein. Die Studie geht der Frage nach, inwiefern ein hohes Ausmaß<br />
an Handlungsorientierung (im Gegensatz zu Lageorientierung) für unterschiedliche<br />
Ergebnisse der Angstbewältigung verantwortlich ist. Wir unterscheiden<br />
hierbei nach Kuhl Handlungsorientierung nach Misserfolg, Handlungsorientierung<br />
in der Planung und Handlungsorientierung bei der Tätigkeitsausführung.<br />
130 Patienten mit gesicherten Angstdiagnosen (hier Panikstörung<br />
und/oder Agoraphobie) nahmen an der Studie teil und füllten Fragebögen zu<br />
verschiedenen Facetten der klinischen Angst aus (BAI, ACQ, MI, BSQ, SCL).<br />
Daneben wurde als Messinstrument für Handlungs- versus Lageorientierung<br />
der HAKEMP von Julius Kuhl eingesetzt. Patienten wurden zu vier Messzeitpunkten<br />
untersucht (Anmeldung, Aufnahme, Entlassung, 6-Monats-FU). Die<br />
Interventionen waren Bestandteil eines sog. multimodalen Programms und bestanden<br />
in ihrem Kern aus Einzel- und Gruppentherapie, vor allem aber aus<br />
intensiven Expositionen.<br />
Die Ergebnisse können einen Overall-Effect für das Treatment klar zeigen.<br />
Alle Patienten profitierten, sie verbesserten sich sogar in der FU-Phase weiter.<br />
Handlungs-versus-Lageorientierung erbrachte ein unterschiedliches Bild. Die<br />
Facetten Handlungsorientierung nach Misserfolg und Handlungsorientierung bei<br />
Planung verbesserten sich sehr substanziell, während es bei der Handlungsorientierung<br />
bei Tätigkeitsausführung keine Effekte gab. Über die Zeit hinweg<br />
werden die Korrelationen zwischen den Angstmaßen und den Handlungsorientierungsmaßen<br />
immer enger und systematischer. Regressionsanalysen<br />
können klar belegen, dass die Angstausprägung <strong>zur</strong> Entlassung und zum FU<br />
davon abhängig ist, ob es gelingt, die Handlungsorientierung des Patienten zu<br />
stärken.<br />
Für das traitartige Merkmal Handlungs-versus Lageorientierung, welches<br />
per se keinen Bezug zu Angst und Angstreduktion hat, konnte insofern überzeugend<br />
dargelegt werden, dass erfolgreiche Angsttherapie auch von distalen<br />
Motivationsstilen abhängig ist, auf die wiederum in der Therapie systematischer<br />
als bisher eingegangen werden sollte.<br />
Keywords:<br />
Handlungs-versus-Lageorientierung; Angstbehandlung<br />
88
Die subjektive Gesundheit Jugendlicher vor dem Übergang<br />
von der Schule in den Beruf<br />
Martina Kraus-Haas, Corinna Maaser & Burkhard Gusy<br />
FU Berlin, FB Erziehungswissenschaften und Psychologie, AB Prävention und<br />
psychosoziale Gesundheitsforschung<br />
tina.kraus-haas@web.de<br />
Fragestellung: Über welche Ressourcen verfügen Jugendliche, die vor dem<br />
Wechsel von der 10. Klasse in die weitere schulische oder berufliche Zukunft<br />
stehen? Welche Ressourcengewinne und -verluste antizipieren sie mit Blick auf<br />
den anstehenden Statusübergang? Beeinflussen die Ressourcen sowie die<br />
antizipierten Ressourcengewinne /-verluste die subjektive Gesundheit der<br />
Jugendlichen? Diese Fragen wurden vor dem Hintergrund der „Theorie der<br />
Ressourcenerhaltung“ von Hobfoll (1988; 2004) untersucht.<br />
Methode: Eine quantitative Querschnitterhebung bei Haupt-, Real- und<br />
Gesamtschülern der 10. Klassen eines Berliner Bezirks wurde durchgeführt.<br />
Insgesamt konnten 546 Schüler befragt werden, die unterschiedliche Zukunftspläne<br />
hatten. 62 % der Jugendlichen beabsichtigten eine weiterführende Schule<br />
zu besuchen, knapp 20 % planten, eine Lehre zu beginnen und 10 % hatten<br />
noch keine Pläne.<br />
Ergebnisse: Die Jugendlichen verfügen über ein hohes Maß an Bedingungsressourcen<br />
(Familie, Peers) und persönlichen Ressourcen (z. B.<br />
Optimismus). Durch die Aufnahme einer Ausbildung/eines Arbeitsplatzes nach<br />
Beendigung ihrer Schulzeit antizipieren die Jugendlichen einen Zuwachs an<br />
Bedingungs-, Energie- und persönlichen Ressourcen. Die Mehrzahl berichtet<br />
über ein gutes Wohlbefinden trotz körperlicher Beschwerden. In hierarchischen<br />
Regressionsanalysen erweisen sich nicht nur die aktuell verfügbaren<br />
Ressourcen sondern auch die Antizipation von Ressourcengewinnen und<br />
-verlusten als bedeutsame Prädiktoren für die subjektive Gesundheit. Die Bedeutung<br />
der Ergebnisse für die Praxis werden diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Buchwald, P., Schwarzer, C. & Hobfoll, S. E. (Hrsg.) (2004). Stress gemeinsam bewältigen.<br />
Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping. Göttingen: Hogrefe.<br />
Keywords:<br />
Jugendliche, Statusübergang, subjektive Gesundheit<br />
89
Sensibilisierung von älteren Arbeitslosen mit erhöhten<br />
Gesundheitsrisiken für ein Gesundheitsstarterpaket<br />
Peter Kuhnert 1 , Türkan Ayan 2 , Melanie Kaczerowski 2 & Michael<br />
Kastner 1<br />
1 Universität Dortmund, Institut für Psychologie<br />
2 Universität Dortmund<br />
kuhnert@orgapsy.uni-dortmund.de<br />
Zahlreiche Studien zeigen, dass besonders ältere Erwerbslose im Vergleich zu<br />
älteren Beschäftigten deutlich höhere Gesundheitsrisiken für chronische Erkrankungen<br />
haben und im beträchtlichen Umfang von Dauerarbeitslosigkeit,<br />
Erwerbsunfähigkeit und sozialer Ausgrenzung bedroht sind (Kuhnert & Kastner,<br />
2006). Gleichzeitig nutzen diese kaum Angebote der Primärprävention und<br />
Gesundheitsförderung. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert<br />
in 2007 mehrere Module eines „Starterpaketes Gesundheitsmanagement“, das<br />
besonders Langzeitarbeitslosen mit zusätzlichen Problemlagen (Psyche, Sucht,<br />
Isolation, Armut) bei ersten Schritten zu aktivem Gesundheitshandeln hilft. Die<br />
verbreitete Handlungsleitlinie der Gesunderhaltung durch immer höhere Selbstkontrolle,<br />
Disziplinierung und Stigmatisieren von Möglichkeiten zum Genuss<br />
hatte bei Langzeitarbeitslosen bisher keine Erfolgschancen.<br />
Mit der Sensibilisierungsstrategie wird ein alltagsnaher und an geschwächten<br />
Ressourcen orientierter Handlungsleitfaden für Multiplikatoren der<br />
Arbeits- wie Gesundheitsförderung entwickelt, der dazu ermutigen wie befähigen<br />
soll, Präventionen wie Interventionen mit Erwerbslosen durchzuführen,<br />
die bisher nicht an den bestehenden Gesundheitsangeboten partizipieren (Altgeld<br />
et al., 2006).<br />
Mittels einer Fragebogenerhebung und problemorientierter Interviews mit<br />
Erwerbslosen und Experten werden alltags- und zielgruppennahe Daten erhoben<br />
und zu praxisbezogenen Handlungsempfehlungen verdichtet. Im Mittelpunkt<br />
steht die Erfassung von Erfolgskriterien der Selbstmanagement-Beratung<br />
für Arbeitslose (Kuhnert, 2007). Dazu gehören: 1) erfolgreiche Segmente der<br />
Verhaltensmodifikation, 2) Gesundheitshandeln begünstigende biografische<br />
Hintergründe, 3) Elemente spezifischer sozialer Unterstützung, 4) Exemplarische<br />
Eigeninitiative, 5) Gerechtigkeitsdefizite und Ausgrenzungsempfindungen<br />
6) Anerkennung und Wertschätzung der Person, ihrer Kultur und<br />
Leistung. Endergebnisse der Studie werden für Ende Mai 2007 erwartet.<br />
Keywords:<br />
Arbeitslose, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung<br />
90
Das Studium – die schönste Zeit im Leben? Belastungen<br />
und deren Bewältigung bei Studierenden<br />
Kerstin Kulterer & Eva Brunner<br />
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt<br />
kerstin.kulterer@gmx.net<br />
Fragestellung: Studierende sind mit einer Vielzahl von Belastungen konfrontiert<br />
(Giacobbi, Tuccito & Frye, 2007): Strukturelle, finanzielle, soziale und zeitliche<br />
Probleme gehören mitunter zu den möglichen Stressoren. Prüfungszeiträume<br />
stellen eine besondere Stressquelle dar (Bargiel-Matusiewicz, Trzcieniecka-<br />
Green & Krzysztof, 2005). Die vorliegende Studie untersucht Gesundheitsverhaltensweisen,<br />
Belastungen und den Umgang mit Prüfungssituationen bei<br />
Studierenden der Psychologie und Betriebswirtschaft.<br />
Methode: In einer Längsschnittuntersuchung werden Studierende zu<br />
Semesterbeginn und im Prüfungszeitraum am Ende des Semesters zu Belastungen<br />
und Ressourcen im Studium, allgemeinen und prüfungsbezogenen<br />
Bewältigungsstrategien, ausgewählten Gesundheitsverhaltensweisen (Ernährung,<br />
Bewegung, Alkohol-, Zigarettenkonsum) sowie psychischen und<br />
physischen Beschwerden befragt.<br />
Ergebnisse: Eine Deskription der interessierenden Variablen wird<br />
basierend auf den Daten des ersten Erhebungszeitpunktes präsentiert.<br />
Geschlechtsunterschiede sowie Veränderungen im Längsschnitt werden dargestellt.<br />
Die Ergebnisse sollen als Grundlage für die Entwicklung gesundheitsförderlicher<br />
Strategien an der Universität dienen (Stock et al., 2003).<br />
Literatur:<br />
Bargiel-Matusiewicz, K., Trzcieniecka-Green, A. & Krzysztof, K. (2005). Cognitive appraisal and<br />
strategies of coping applied in an exam situation. Archives of Psychiatry and<br />
Psychotherapy, 7, 33-38.<br />
Giacobbi, P. R., Tuccitto, D. E. & Frye, N. (2007). Exercise, affect, and university students'<br />
appraisals of academic events prior to the final examination period. Psychology of Sport<br />
and Exercise, 8, 261-274.<br />
Stock, C., Kücük, N., Miseviciene, I., Guillén-Grima, F., Petkeviciene, J., Aguinaga-Ontoso, I. &<br />
Krämer, A. (2003). Differences in health complaints among university students from three<br />
European countries. Preventive Medicine, 37, 535-543.<br />
Keywords:<br />
Studierende, Stress, Stressbewältigung<br />
91
Case Management Psychoonkologie: Das strukturierte<br />
psychoonkologische Versorgungsprogramm im<br />
Krankenhaus<br />
Michael Kusch<br />
Institut für Gesundheitsförderung und Versorgungsforschung GmbH an der<br />
Ruhr-Universität Bochum<br />
michael.kusch@rub.de<br />
Case Management Psychoonkologie ist ein Ansatz der strukturierten, einzelfallbezogenen<br />
psychosozialen Versorgung von Krebs betroffener Menschen.<br />
Im Rahmen dieses Ansatzes wurde ein strukturiertes psychoonkologisches<br />
Versorgungsprogramm entwickelt und in Form eines Implementierungsprojektes<br />
in sechs Akutkliniken (Brüderkrankenhaus St. Josef, Paderborn;<br />
Evangelisches Krankenhaus, Bielefeld; Franziskus Hospital, Bielefeld;<br />
Kath. St.-Johannesgesellschaft, Dortmund; Klinikum Dortmund; Klinikum<br />
Herford) erprobt. Projektträger waren die Geschäftsführer der Kliniken. Projektpartner<br />
waren das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes<br />
NRW, die AOK Westfalen-Lippe, die Krankenhausgesellschaft NRW sowie die<br />
Carina Stiftung, Herford.<br />
Fragestellung: Kann ein strukturiertes psychoonkologisches Versorgungsprogramm<br />
unter den Bedingungen der akutmedizinischen Krebstherapie in ein<br />
Krankenhaus implementiert und umgesetzt werden?<br />
Methode: Zum Einsatz kamen intranet-basierte Behandlungspfade, Ausführungsempfehlungen<br />
sowie ein edv-basiertes Dokumentationssystem <strong>zur</strong><br />
Planung, Lenkung und Prüfung der Patientenversorgung sowie <strong>zur</strong> Qualitätssicherung.<br />
Ergebnisse: Im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2004 und dem 31.<br />
Dezember 2006 wurden in 20 Fachabteilungen der sechs Kliniken 5.640<br />
Patienten mit mehr als 38 unterschiedlichen Krebserkrankungen psychoonkologisch<br />
versorgt. Neben den Ärzten und Pflegekräften der Abteilungen<br />
erfolgte die psychoonkologische Betreuung durch Psychotherapeuten, die mit<br />
7,65 Vollzeitstellen in 17.183 Arbeitsstunden knapp 23.400 Gespräche geführt<br />
haben. Umfangreiche Ergebnisse liegen <strong>zur</strong> Versorgungsqualität, <strong>zur</strong> Dienstleistungsqualität,<br />
<strong>zur</strong> Qualitätsentwicklung und <strong>zur</strong> Kosten-Nutzen-Bewertung<br />
vor (vgl. www.carina-stiftung.de).<br />
Projektkonsequenzen: Im Februar 2007 haben die beteiligten Kliniken<br />
beim InEK (Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus) einen Antrag auf<br />
„Definition eines Zusatzentgeltes für diese Therapieform“ beantragt.<br />
Keywords:<br />
Psychoonkologie, Versorgungsforschung, Qualitätssicherung<br />
92
Stressfördernde Kognitionen – Empirische<br />
Dimensionen und deren gesundheitliche Bedeutung<br />
Dirk Lehr 1 , Nadia Sosnowsky 2 , Andreas Hillert 3 & Carolin Trageser 1<br />
1 Philipps-Universität Marburg<br />
2 <strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Ludwigsburg<br />
3 Medizinisch-Psychosomatische Klinik Roseneck<br />
dirk.lehr@med.uni-marburg.de<br />
Fragestellung: Zentraler Baustein kognitiv-behaviorales Trainings <strong>zur</strong> Stressprävention<br />
ist die Modifikation von stressfördernden/dysfunktionalen Kognitionen<br />
(z. B. Kaluza, 2004; Lehr et al., 2007). Dabei stützen sich Trainings auf<br />
unterschiedliche Systematisierungen von Kognitionen. Die Systematisierungen<br />
besitzen meist eine hohe Plausibilität/Kommunizierbarkeit, wenngleich eine<br />
empirische Fundierung nicht vorliegt. Ziel der vorliegenden Studie war es, die<br />
Dimensionalität stressfördernder Kognitionen im beruflichen Kontext zu untersuchen.<br />
Methode: Stichprobe: N = 272 Lehrerinnen und Lehrer. Davon befanden<br />
sich 166 in stationärer psychosomatischer Behandlung, 106 bilden eine<br />
„gesunde“ Vergleichsgruppe. Instrumente: Eingesetzt wurden drei Instrumente<br />
<strong>zur</strong> Erfassung von dysfunktionalen Kognitionen (Skala dysfunktionaler Einstellungen<br />
DAS; Fragebogen irrationaler Einstellungen FIE; Frost<br />
Multidimensional Perfectionism Scale FMPS-D) sowie zwei neu entwickelte<br />
Skalen. Diese erfassen dysfunktionale Einstellungen im Bezug auf das Einwerben<br />
von sozialer Unterstützung sowie die Meidung von Unsicherheit und<br />
Risiko. Analyseverfahren: exploratorische und konfirmatorische Faktorenanalysen,<br />
Korrelations- und Regressionsanalysen.<br />
Ergebnisse: Exploratorische Faktorenanalysen identifizierten sieben<br />
Dimensionen, die sich robust gegenüber Methodenvariationen erwiesen:<br />
Meidung sozialer Unterstützung, Abhängigkeit von externer Anerkennung,<br />
Internalisierung von Misserfolg, hohe persönliche Standards, Meidung von Unsicherheit<br />
und Risiko, Abwertung der eigenen Person, Zweifel über Arbeitsergebnisse.<br />
Diese faktorielle Struktur zeigte in konfirmatorischen Analysen eine<br />
gute Modellpassung (χ 2 = 567.70, df = 317, p < .001, χ 2 /df = 1.791;<br />
RMSEA = .054; SRMR = .053; CFI = .945; TLI = .940).<br />
Erwartungsgemäß waren die Kognitionen mit verschiedenen Maßen des<br />
gesundheitlichen Status substanziell assoziiert: vorliegende psychische Störung<br />
vs. keine Störung, Depressivität, Burnout, habituelles Wohlbefinden, Arbeitszufriedenheit.<br />
Keywords:<br />
Dysfunktionale Kognitionen, betriebliche Gesundheitsförderung, Lehrer<br />
93
Computerbasierte Beratung zu mehr körperlicher<br />
Aktivität chronisch kranker Patienten in Hausarztpraxen<br />
Corinna Leonhardt 1 , Dominikus Herzberg 2 , Hartmut Jung 1 , Sabine<br />
Thomanek 2 & Annette Becker 3<br />
1<br />
Philipps-Universität Marburg/Institut für Medizinische Psychologie<br />
2<br />
<strong>Hochschule</strong> Heilbronn<br />
3<br />
Philipps-Universität Marburg, Abteilung Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative<br />
Medizin<br />
cleonhar@med.uni-marburg.de<br />
Fragestellung: Die Bedeutung körperlicher Aktivität für die Primär- und<br />
Sekundärversorgung chronischer Erkrankungen ist in zahlreichen Studien belegt.<br />
Computerbasierte aktivierende Beratungssysteme werden international<br />
bereits viel in Forschung und Patientenbetreuung eingesetzt (Murray et al.,<br />
2005), stellen in deutschen Hausarztpraxen jedoch eine Innovation dar.<br />
Methode: Vorgestellt wird ein PC-Beratungssystem für chronisch kranke<br />
KHK-und/oder Diabetes-Patienten, welches in Hausarztpraxen im Rahmen<br />
einer Akzeptanz- und Pilotstudie getestet wird. Das Beratungssystem wird<br />
interdisziplinär (Psychologen, Mediziner, Informatiker) für Tablet-PCs entwickelt.<br />
Die theoretische Grundlage bei der Erstellung des stufenspezifischen,<br />
individualisierten Programms bildet das transtheoretische Modell der Verhaltensänderung<br />
(TTM), einbezogen werden jedoch auch neuere Überlegungen<br />
zum Einfluss emotionaler Einstellungskomponenten auf die Bereitschaft zu<br />
regelmäßiger körperlicher Aktivität (Brand, 2006).<br />
Zum Einsatz kommen in dem interaktiven, vom Patienten steuerbaren<br />
Programm verschiedene multimediale Elemente (Videosequenzen, akustische<br />
<strong>Beiträge</strong>), um insbesondere auch Personen mit wenig Bewegungsmotivation<br />
emotional anzusprechen. Veränderungsbereiten Patienten werden direkte Umsetzungsmöglichkeiten<br />
im Rahmen eines DMP-Aktiv-Kurses „Nordic Walking“<br />
angeboten.<br />
Untersucht werden sollen die Akzeptanz, Nutzergruppen und die Möglichkeit<br />
der Einflussnahme auf Einstellungskomponenten.<br />
Ergebnisse: Vorgestellt werden können auf dem Kongress neben der<br />
inhaltlichen Gestaltung des Programms erste Daten <strong>zur</strong> Akzeptanz des Beratungssystems.<br />
Literatur:<br />
Brand, R. (2006). Die affektive Einstellungskomponente und ihr Beitrag <strong>zur</strong> Erklärung von<br />
Sportpartizipation. Zeitschrift für Sportpsychologie 13, 147-155.<br />
Murray, E., Burns, J., See Tai, S., Lai, R. & Nazareth I. (2005). Interactive health communication<br />
applications for people with chronic disease. Cochrane Database Syst Rev; (4):<br />
CD004274.<br />
Keywords:<br />
interactive health communication, chronic disease, primary care<br />
94
Vergleich verschiedener Screeningverfahren <strong>zur</strong> Identifikation<br />
problematischer und pathologischer Glücksspieler<br />
Gerit Loeffler, Nina Kirschner, Chantal Mörsen, Ulrike Hesselbarth &<br />
Sabine Grüsser<br />
Charité<br />
geritloeffler@charite.de<br />
Im Bereich des pathologischen Glücksspiels liegen zum Teil divergierende Prävalenzangaben<br />
vor. Diese Unterschiede resultieren aus verschiedenen<br />
methodischen Herangehensweisen. Dabei haben die verwendeten Messinstrumente<br />
sowie die Operationalisierung des Symptomkomplexes beim Zustandekommen<br />
der unterschiedlichen Prävalenzzahlen eine wesentliche Bedeutung.<br />
Im deutschsprachigen Raum werden vorwiegend der SOGS, der BIG und der<br />
KFG <strong>zur</strong> Diagnostik des pathologischen Glücksspielverhaltens eingesetzt. Die<br />
erwähnten Verfahren beruhen jedoch auf verschiedenen diagnostischen<br />
Kriterien und geben <strong>zur</strong> Festlegung der Diagnose unterschiedlich strenge Bedingungen<br />
vor.<br />
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht in dem Vergleich der drei<br />
verschiedenen Messinstrumente anhand von 350 Personen (175 Straftäter mit<br />
Glücksspielerfahrung und 175 Nutzern von Glücksspielangeboten). Im Vergleich<br />
zeigt sich, dass der BIG und der KFG strengere Kriterien für die<br />
Diagnosestellung pathologisches Glücksspiel anlegen. Die Analyse der Häufigkeit<br />
der Diagnose des problematischen Glücksspiels ergab, das mittels des<br />
SOGS dreimal so viele Probanden im Gegensatz zum BIG identifiziert wurden.<br />
Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Ermittlung der Häufigkeiten der DSM-IV<br />
Kriterien in der Population der pathologischen Glücksspieler. Die von den<br />
pathologischen Spielern am häufigsten genannten Kriterien sind Toleranzentwicklung,<br />
Kontrollverlust, Entzugserscheinungen, Lügen gegenüber Angehörigen/Bezugspersonen<br />
und Chasing, was allerdings ebenso häufig von den<br />
als problematisch eingestuften Spielern berichtet wurde. Im Hinblick auf die Ergebnisse<br />
der Untersuchung besteht die Notwendigkeit, der Diagnose einheitliche<br />
Definitionen zu Grunde zu legen sowie identische Messverfahren zu verwenden,<br />
um die Aussagekraft der Prävalenzschätzungen zu erhöhen.<br />
Keywords:<br />
Prävalenz, Glücksspiel<br />
95
Zähne zusammenbeißen und durch? – Stressbewältigung<br />
und temporomandibuläre Dysfunktionen<br />
Natalie Mallach 1 , Benjamin Schüz 1 , Bettina Kanzlivius 2 & Ingrid<br />
Peroz 2<br />
1 Freie Universität Berlin<br />
2 Charité Berlin<br />
malnat@zedat.fu-berlin.de<br />
Fragestellung: Es wurde untersucht, inwiefern interindividuelle Unterschiede in<br />
Stressniveau und Stressverarbeitung sich auf die Entstehung von Schmerzen<br />
bei temporomandibulären Dysfunktionen (TMD) auswirken, und ob Stressbewältigung<br />
die Beziehung zwischen Stressniveau und Schmerzen mediiert.<br />
Methode: Stress wurde retrospektiv mittels der Social Readjustment<br />
Rating Scale (SRRS, Holmes & Rahe, 1967) erhoben, Stressbewältigung wurde<br />
mit dem Stressverarbeitungsfragebogen (Janke, Erdmann & Kallus, 1997) gemessen.<br />
Es wurden Regressions- und Mediationsanalysen mit Zobels z durchgeführt<br />
um Schmerz vorherzusagen und mögliche Mediatoren zu bestimmen.<br />
Ergebnisse: Stress und kognitive Bewältigung sagten TMD vorher, Stressverarbeitung<br />
mediierte den gefundenen Zusammenhang nicht, sondern stellte<br />
sich als unabhängiger Prädiktor heraus.<br />
Schlussfolgerung: Mit dem SRRS gemessenes Stressniveau und kognitive<br />
Bewältigung sind zwei voneinander unabhängige, hochsignifikante Prädiktoren<br />
von Schmerz bei temporomandibulären Dysfunktionen.<br />
Literatur:<br />
Holmes, T. & Rahe, R. (1967) The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic<br />
Research, 11, 213–218.<br />
Janke, W., Erdmann G. & Kallus K. W. (1997) Stressverarbeitungsfragebogen (SVF). Hogrefe,<br />
Göttingen.<br />
Keywords:<br />
Stress, Stressbewältigung, Temporomandibuläre Dysfunktionen<br />
96
Das Leben mit Ersatzdrogen – medizinische und<br />
psychosoziale Veränderungen von Drogenabhängigen<br />
in ambulanter Substitutionsbehandlung<br />
Philipp Mayring & Claudia Brunner<br />
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt/Institut für Psychologie<br />
philipp.mayring@uni-klu.ac.at<br />
Fragestellung: Zur Überprüfung der Effektivität von Behandlungsmaßnahmen<br />
einer ambulanten Drogeneinrichtung wurde vor dem Hintergrund einer zu erwartenden<br />
Stabilisierung in den einzelnen Lebensbereichen (u. a. Hermann,<br />
Wagner & Lindenbauer, 2005) ein Evaluationskonzept entwickelt. Dabei ist zu<br />
beachten, dass die Diskussion um unterschiedliche Evaluationsansätze<br />
(Designs und Methoden; Evidenzstufen; experimenteller Ansatz; qualitativ vs.<br />
quantitativ) im Gesundheitsbereich so kontrovers ist (vgl. Elkeles, 2006), dass<br />
nur ein integrativer Methodenmix sinnvoll erscheint.<br />
Methodik: Baustein 1: Ausgewählte Konstrukte werden zu zwei Messzeitpunkten<br />
untersucht (B-L, Zerssen; WHOQOL-BREF, Angermeyer et al.).<br />
Vorher-Nachher Vergleiche werden angestrebt. Baustein 2: Eine Sekundäranalyse<br />
verfügbarer Daten wird durchgeführt. Neben der Deskription des Klientels<br />
werden Verbesserungen, Stabilisierungen oder Verschlechterungen der Verläufe<br />
eingeschätzt. Baustein 3: Über offene, halb-strukturierte Interviews<br />
werden die Versorgungszufriedenheit, subjektive Behandlungseffekte und Verbesserungsvorschläge<br />
erfasst. Baustein 4: In einer Team-Selbstevaluation versuchen<br />
die Betreuer ihre Arbeit zu reflektieren.<br />
Erste Ergebnisse: Es zeigt sich, dass Unzufriedenheiten mit der Betreuungsqualität<br />
auf Seiten des Teams und auf Seiten der Klienten zu finden<br />
sind. Zahlreiche Verbesserungsansätze, auch aus Klientensicht, lassen sich<br />
aufführen. Problematisch erscheint vor allem die langfristige Zukunftssicht der<br />
betreuten Personen.<br />
Literatur:<br />
Elkeles, Th. (2006). Evaluation von Gesundheitsförderung und die Forderung nach<br />
Evidenzbasierung. Zeitschrift für Evaluation, 5, 39-70.<br />
Hermann, P., Wagner W. & Lindenbauer (2005). Wirksamkeit und Verträglichkeit von oralem<br />
retardiertem Morphin für die Substitutionstherapie von Opiatabhängigen: Ergebnisse<br />
einer Pilotstudie an ambulanten Patienten. Suchtmedizin in Forschung und Praxis, 7,<br />
215-220.<br />
Keywords:<br />
Evaluation, ambulante Drogeneinrichtung, Evidenz-Based Medicine<br />
97
Entwicklung eines Fragebogenverfahrens <strong>zur</strong><br />
Erfassung von Stressbewältigung und Gesundheitsverhalten<br />
bei Kindern und Jugendlichen<br />
Stefanie Meier, Heike Eschenbeck & Carl-Walter Kohlmann<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
stefanie.newedel@ph-gmuend.de<br />
Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen beeinflussen die<br />
physische und psychische Gesundheit und erhöhen das Risiko für weitere Beschwerden<br />
im Erwachsenenalter. Nach Mann-Luoma et al. (2002) sollten im<br />
Zusammenhang mit Adipositas die Bereiche Ernährung, Bewegung und Stress<br />
nicht getrennt voneinander betrachtet werden, da eine Reihe von Wechselwirkungen<br />
zwischen diesen Verhaltensbereichen bestehen.<br />
Vorgestellt wird ein neu entwickeltes Befragungsinstrument, das die Bereiche<br />
Stressbewältigung und Gesundheitsverhalten erfasst. Zur Diagnostik der<br />
Stressbewältigungsstrategien wurden die fünf Subskalen der Stressbewältigung<br />
aus dem „Fragebogen <strong>zur</strong> Erhebung von Stress und Stressbewältigung im<br />
Kindes- und Jugendalter“ (SSKJ 3-8; Lohaus et al., 2006) verwendet und um<br />
die zwei Subskalen Mediennutzung und impulsgesteuertes Essverhalten als<br />
Bewältigungsstrategien erweitert. Gesundheitsverhalten wurde über die Bereiche<br />
Konsum von gesunden und ungesunden Lebensmitteln, körperliche<br />
Aktivität und Inaktivität, sowie Unternehmungen mit der Familie und Mithilfe der<br />
Kinder und Jugendlichen beim Einkaufen oder Kochen, Verhalten im Straßenverkehr<br />
und Sonnenschutzverhalten operationalisiert. In Zusammenarbeit mit<br />
der Gmünder ErsatzKasse GEK wurden mit diesem Befragungsinstrument 500<br />
adipöse und 500 nicht-adipöse Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14<br />
Jahren befragt. In diesem Beitrag werden die psychometrischen Kennwerte der<br />
Verfahren und Assoziationen zwischen den Variablen vorgestellt.<br />
Literatur:<br />
Lohaus, A., Eschenbeck, H., Kohlmann, C.-W. & Klein-Heßling, J. (2006). Fragebogen <strong>zur</strong> Erhebung<br />
von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter (SSKJ 3-8).<br />
Göttingen: Hogrefe.<br />
Mann-Luoma, R., Goldapp, C., Khaschei, M., Lamers, L. & Milinski, B. (2002). Integrierte Ansätze<br />
zu Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. Gesundheitsförderung von<br />
Kindern und Jugendlichen. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz,<br />
45, 952-959.<br />
Keywords:<br />
Adipositas, Stressbewältigung, Gesundheitsverhalten<br />
98
Gesundheitsbezogene Risikofaktoren exzessiver Internetnutzung<br />
im Jugendalter<br />
Sabine Meixner 1 & Matthias Jerusalem 2<br />
1 Freie Universität Berlin<br />
2 Humboldt-Universität zu Berlin<br />
meixners@zedat.fu-berlin.de<br />
Der zunehmende Einzug des Internets in den Alltag von Kindern und Jugendlichen<br />
hat Diskussionen über die Risiken des Internets und die Gefahr einer<br />
möglichen Abhängigkeit von Chats oder Onlinespielen entfacht. Forschungsbefunde<br />
deuten auf eine hohe Verbreitung exzessiver Internetnutzung unter<br />
Jugendlichen, beträchtliche personenbezogene Probleme der Betroffenen und<br />
negative Folgen längerfristigen Problemverhaltens im persönlichen, sozialen<br />
und leistungsbezogenen Bereich hin. Da viele Studien methodische Probleme<br />
aufweisen (z. B. fehlende psychometrische Gütekriterien, mangelnde Stichproben-Repräsentativität),<br />
haben wir eine Skala <strong>zur</strong> Messung von Internetsucht<br />
entwickelt und im Rahmen von Online-Studien mit ca. 17.000 Teilnehmern<br />
validiert. Dabei ergab sich für Jugendliche eine Prävalenzrate von 17 % sowie<br />
Zusammenhänge exzessiver Internetnutzung mit Abhängigkeitstendenzen<br />
(z. B. Entzugserscheinungen, Kontrollverlust) und persönlichen wie sozialen<br />
Problemen.<br />
In der hier berichteten Folgestudie wurden mit einem Fragebogen bundesweit<br />
N = 4600 Schüler zwischen 14 und 25 Jahren mit der Internetsucht-Skala<br />
untersucht und zu möglichen Risikofaktoren problematischen Internetverhaltens<br />
befragt. Es zeigte sich, dass bisherige Online-Befragungen das Ausmaß exzessiver<br />
Internetnutzung durch Jugendliche überschätzen. Jedoch weisen Betroffene<br />
ein vielfältiges Problemprofil auf. Als bedeutsame Risikofaktoren exzessiver<br />
Internetnutzung erwiesen sich insbesondere hohes Belastungserleben,<br />
dysfunktionale Copingstile und eine geringe spezifische Regulationskompetenz<br />
bzw. Selbstwirksamkeit. Weitere Zusammenhänge zeigten sich mit Persönlichkeitsfaktoren<br />
wie Ängstlichkeit, Depressivität, Selbstwertgefühl sowie mit<br />
sozialen Ressourcen und Problemen. Die Befunde werden im Hinblick auf Präventionsmöglichkeiten<br />
diskutiert.<br />
Keywords:<br />
Internetsucht, Stressbewältigung, jugendliches Risikoverhalten<br />
99
Herzratenvariabilitäts-Biofeedback in der Behandlung<br />
essenzieller Hypertonie: Die Bedeutung der<br />
Barorezeptoren-Sensitivität<br />
Lutz Mussgay 1 , Anke Reineke 2 , Sebastian Domann, 1 Richard<br />
Gevirtz 2 & Heinz Rüddel 1<br />
1<br />
Psychosomatische Fachklinik St.-Franziska-Stift, Bad Kreuznach, Abteilung<br />
für Verhaltensmedizin und Rehabilitation des Forschungszentrums für<br />
Psychobiologie und Psychosomatik (FPP), Universität Trier<br />
2<br />
Alliant International University, San Diego, USA<br />
l.mussgay@fskh.de<br />
Fragestellung: Bei Patienten mit essenzieller Hypertonie haben Behandlungsversuche<br />
mit langsamer Atmung viel versprechende Ergebnisse gezeigt. Die<br />
vorliegende Studie untersucht die Effekte einer Biofeedback-Behandlung mit<br />
Hilfe einer Steigerung der Herzratenvariabilität (HRV) durch langsame Atmung<br />
(ca. 6 Zyklen/min) (EG) im Vergleich zu einer Aufmerksamkeits-Placebo<br />
Kontrollgruppe (KG). Zusätzlich wird ermittelt, welchen Beitrag die Baroreflex-<br />
Sensitivität (BRS) als Kennwert der autonomen, kardiovaskulären Regulation<br />
leistet.<br />
Methode: Die Teilnehmer wurden in einer Psychosomatischen Fachklinik<br />
rekrutiert. Alle Versuchspersonen (Alter 18-60 Jahre) erfüllten die Kriterien für<br />
Stufe 1 Hypertonie (90-99/140–159 mmHg). Die Patienten wurden den Gruppen<br />
zufällig zugewiesen. Beide Gruppen erhielten zudem die Standardbehandlung<br />
der Klinik. Während der 1., 5. und 10. Sitzung sowie zum Follow-up-Zeitpunkt<br />
(+3 Monate) wurden die abhängigen Variablen ermittelt.<br />
Ergebnisse: Die Auswertung von 31 Patienten der EG (46,9 Jahre, 15<br />
Frauen) und 26 Patienten der KG (49,1 Jahre, 15 Frauen), von denen jeweils<br />
18 auch die 3-Monatskatamnese absolvierten, zeigen vor allem in der EG<br />
starke anfängliche Blutdruckreduktionen relativ zum ermittelten 24-Std-Wert.<br />
Diese verlieren sich jedoch im Verlauf der Erhebung wieder, so dass keine<br />
Gruppenunterschiede bestehen bleiben. Patienten der EG reduzierten jedoch<br />
signifikant ihren antihypertensiven Medikamentengebrauch. Sie zeigten auch<br />
während der initialen Trainingsphase einen starken Anstieg der BRS, die KG<br />
verändert sich kaum. Dieser anfängliche Gewinn verliert sich aber zum Ende<br />
hin wieder. Dies weist auf die Bedeutung der BRS als vermittelnder Mechanismus<br />
hin. Entsprechende starke anfängliche Anstiege mit späterer Abnahme<br />
finden sich in der HRV für die EG im gesamten, niederen und mittleren<br />
Frequenzband. Der anfängliche Anstieg bei BRS und HRV mit anschließender<br />
Abnahme weist auf ungeklärte autonome Anpassungsmechanismen hin.<br />
Keywords:<br />
Herzraten-Variabilitäts-Biofeedback, Hypertonie, Barorezeptoren-Sensitivität<br />
100
Medical Comorbidity and Treatment Outcomes in Late-<br />
Life Depression: A Longitudinal Study in Elderly Patients<br />
Ibrahim Raoua Ouedraogo, Gernot Lämmler & Elisabeth Steinhagen-Thiessen<br />
Charité Universitätsmedizin Berlin<br />
raoua@zedat.fu-berlin.de<br />
Physical mobility as well as physical health, stage of care and associated medical<br />
comorbidity was examined longitudinally in geriatrics patients. Previous<br />
studies have demonstrated an association between major depression and<br />
physical disability in late life. The purpose of this study was to explore the<br />
treatment outcomes in physical mobility and health on the one hand and the<br />
effects of specific medical illness on the treatment of depression in older adults<br />
on the other hand. It draws on a sample of 2,154 hospitalised patients who received<br />
a screening for depression at entry and shortly before release from the<br />
geriatric centre. Depressive symptoms were measured using the Geriatric Depression<br />
Scale. Physical mobility, health and need in medical treatment were<br />
successively measured using the instrumental Activities of Daily Living scale<br />
(ADL), Tinetti Test, Barthel Index and the geriatric stage of care scale.<br />
Physical mobility, physical health and stage of care were significantly related<br />
to change in depressive symptoms. Women performed better at all stage<br />
of the treatment than men. In comparison to patients admitted through hospitalization<br />
or emergency, those admitted through transferral showed a significantly<br />
higher score in Tinetti Test, Barthel Index at T2 and a lower stage of care score<br />
at release.<br />
The result supports the hypothesis that depression may impede the global<br />
medical rehabilitation outcomes if unrecognized or untreated. Moreover, the<br />
assumption of a high prevalence of depressive symptoms in elderly patients<br />
tends to be confirmed. The consequences of inadequately treated depression in<br />
the elderly include poor quality of life, reduced compliance with other medical<br />
treatment, cognitive impairment, and increased risk of mortality.<br />
Keywords:<br />
cognitive impairment, comorbidity, depression<br />
101
Schulische Suchtprävention – Bestandsaufnahme<br />
aktueller Maßnahmen an hessischen Schulen<br />
Daniela Piontek, Anneke Bühler, Stephanie Flöter, Sabine Gradl &<br />
Christoph Kröger<br />
IFT Institut für Therapieforschung<br />
piontek@ift.de<br />
Fragestellung: Für Deutschland liegt bisher keine systematische und<br />
repräsentative Evaluation <strong>zur</strong> suchtpräventiven Praxis an Schulen vor. Es ist<br />
unklar, ob evidenzbasierte verhaltenspräventive Angebote (Bühler &<br />
Heppekausen, 2005) oder auch verhältnispräventive Maßnahmen (Piontek,<br />
Bühler & Kröger, 2007) in deutschen Schulen implementiert sind. Die Fragestellungen<br />
der vorliegenden Studie lauten deshalb: (1) Inwiefern und in<br />
welchem Ausmaß werden die in den letzten Jahren entwickelten, evidenzbasierten<br />
Präventionsmaßnahmen an Schulen angewendet und/oder welche<br />
anderen Maßnahmen sind etabliert? (2) Gibt es einen Zusammenhang<br />
zwischen der Implementation verhaltenspräventiver Maßnahmen und der Ausgestaltung<br />
des Schulkontextes?<br />
Methode: In Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium und der<br />
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden im April 2007 alle etwa<br />
800 weiterführenden Schulen des Bundeslandes Hessen schriftlich befragt. Es<br />
wird eine Ausschöpfungsquote von mindestens 80 % angestrebt. An jeder<br />
Schule wird der Suchtbeauftragte oder die Lehrkraft, die sich am meisten mit<br />
dem Thema auseinandersetzt, mit Hilfe eines an internationale Projekte (Ennett<br />
et al., 2003) angelehnten Fragebogens <strong>zur</strong> aktuell an der Schule<br />
implementierten Suchtprävention befragt.<br />
Ergebnisse: Vor dem Hintergrund der Erfordernisse evidenzbasierter<br />
Suchtprävention wird der Stand der aktuellen schulischen Praxis dargestellt. Es<br />
werden Unterschiede zwischen den verschiedenen Schultypen untersucht.<br />
Darüber hinaus erfolgt ein Vergleich der in Deutschland implementierten Maßnahmen<br />
mit internationalen Daten.<br />
Keywords:<br />
Suchtprävention, Schule<br />
102
Belastungserleben und Lebenszufriedenheit von Eltern<br />
chronisch kranker Kinder<br />
Katharina Reichard 1 , Holger Domsch 2 , Christian Stierle 3 , Arnold<br />
Lohaus 2 & Dieter Vieluf 3<br />
1<br />
Universität Marburg / Entwicklungspsychologie<br />
2<br />
Universität Bielefeld / Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie<br />
3<br />
Fachklinikum Borkum<br />
holger.domsch@uni-bielefeld.de<br />
Fragestellung: Chronische Erkrankungen nehmen in den letzten Jahren stetig<br />
zu. Sie bedeuten zumeist für die Betroffenen deutliche Einschnitte und Veränderungen<br />
in ihrem Lebensalltag. Doch auch Angehörige werden mit neuen<br />
Aufgaben und Belastungen konfrontiert. Verschiedene Studien haben zeigen<br />
können, dass Eltern chronisch kranker Kinder oft von erhöhten Stresswerten<br />
berichten. Dies geht in der Regel mit einer niedrigeren Selbstwirksamkeit in Erziehungsfragen<br />
einher. Bezüglich des verwandten Konstruktes Lebensqualität<br />
finden sich dagegen zum Teil widersprüchliche Ergebnisse: In der vorliegenden<br />
Untersuchung sollen die unterschiedlichen Konstrukte gemeinsam in einer<br />
Gruppe von Eltern chronisch kranker Kinder erhoben und mit einer Kontrollstichprobe<br />
verglichen werden.<br />
Methode: Die Stichprobe bestand aus 45 Eltern chronisch kranker Kinder<br />
(Patienten der Fachklinik Borkum) und einer entsprechenden Kontrollstichprobe<br />
von Eltern gesunder Kinder. Zur Erfassung des Elternstresses kam ein neu<br />
entwickelter Fragebogen zum Einsatz. Weiterhin wurden die Eltern zu ihrer<br />
familiären Lebenszufriedenheit und der allgemeinen Selbstwirksamkeit befragt.<br />
Ergebnisse: Einhergehend mit früheren Studien zeigten sich ein erhöhter<br />
Elternstress und mehr körperliche Beschwerden bei Eltern chronisch kranker<br />
Kinder. Darüber hinaus fand sich eine geringere Lebenszufriedenheit bezüglich<br />
der Partnerschaft und der familiären Situation im Vergleich zu Eltern von<br />
gesunden Kindern. Unterschiede in der allgemeinen Selbstwirksamkeit der<br />
Eltern fanden sich dagegen nicht. Die Ergebnisse bestätigen, dass Eltern<br />
chronisch kranker Kinder über höhere Belastungen berichten. Sie unterstreichen<br />
zudem, dass eine Reduktion von Elternstress in Elternschulungen<br />
berücksichtigt werden sollte.<br />
Keywords:<br />
Elternstress, chronische Erkrankung, Lebenszufriedenheit<br />
103
Gesundheitsverhalten über die Lebensspanne<br />
Britta Renner 1 , Youlia Spivak 1 & Ralf Schwarzer 2<br />
1 Jacobs University Bremen<br />
2 Freie Universität Berlin<br />
b.renner@iu-bremen.de<br />
Modelle <strong>zur</strong> Vorhersage von Gesundheitsverhalten basieren auf der Annahme,<br />
dass sie universell für verschiedene Altersgruppen oder Kulturen gültig sind.<br />
Allerdings zeigen Befunde aus der Entwicklungspsychologie und Biologie, dass<br />
Gesundheit beispielsweise einen ganz unterschiedlichen Stellenwert für verschiedene<br />
Altersgruppen hat. Dies legt nahe, dass sozial-kognitive Determinanten<br />
von Gesundheitsverhalten alters- und kulturspezifisch sein<br />
könnten. In der vorliegenden Studie wurden auf der Grundlage des HAPA-<br />
Modells junge und ältere Erwachsene aus Deutschland (N = 580) und aus Südkorea<br />
(N = 697) in einem längsschnittlichen Design untersucht. Die Ergebnisse<br />
zeigen in beiden Kulturen, dass das HAPA-Modell innerhalb der Gruppe älterer<br />
Erwachsener gut <strong>zur</strong> Vorhersage von gesundheitsbezogenem Verhalten (Ernährung,<br />
körperliche Aktivität) geeignet ist. Allerdings zeigt sich innerhalb der<br />
jungen Erwachsenen kein guter Modellfit. Die Befunde unterstützen die Annahme,<br />
dass die Determinanten von Gesundheitsverhalten altersspezifisch<br />
sind. Implikationen für die Konzeptionalisierung von Gesundheitsverhaltensmodellen<br />
sollen diskutiert werden.<br />
Keywords:<br />
Gesundheitsverhalten, Motivation, Lebensspanne<br />
104
Anforderungen, Stress und Ressourcen im Fahrlehrerberuf<br />
– Eine Gesundheitsanalyse bei Fahrlehrern<br />
Jessica Reschke & Harry Schröder<br />
Universität Leipzig / Institut für Psychologie II<br />
JessicaReschke@web.de<br />
Gesundheitsanalysen im beruflichen Kontext dienen der Erfassung charakteristischer<br />
Anforderungen, Stressoren sowie Ressourcen einer Tätigkeit, um<br />
aufbauend darauf spezifische Interventions- und Präventionsmöglichkeiten <strong>zur</strong><br />
Förderung der Gesundheit für die betreffende Berufsgruppe aufzuzeigen.<br />
Die vorliegende Fragebogenstudie untersuchte auf der Grundlage eines<br />
Anforderungs-Ressourcen-Modells der Gesundheit externe Anforderungen und<br />
interne Ressourcen sowie das Ausmaß des Stresserlebens und die Ausprägungen<br />
verschiedener Gesundheitsindikatoren bei insgesamt 287 Fahrlehrern<br />
aus je einem alten und neuen Bundesland. Neben der allgemeinen Beschreibung<br />
der Merkmalsausprägungen für die Berufsgruppe der Fahrschullehrer<br />
wurden zudem Unterschiede zwischen Fahrlehrern aus den beiden<br />
Bundesländern analysiert.<br />
Die berufliche Anforderungssituation wird, unabhängig vom Bundesland,<br />
von den Fahrlehrern sehr ähnlich wahrgenommen, wobei finanzielle Probleme<br />
und Konkurrenzdruck die stärksten Belastungen darstellen. Insgesamt finden<br />
sich durchschnittliche Werte in Bezug auf Stresserleben und generalisierte<br />
Selbstwirksamkeitserwartung als interne Ressource. Ihre psychische und körperliche<br />
Gesundheit beschreiben die Fahrlehrer als gut bis sehr gut. Sportliche<br />
Aktivität und bewusste Ernährung als Gesundheitsverhaltensweisen werden<br />
von einer Vielzahl der Fahrlehrer wenig oder gar nicht in den Lebensvollzug<br />
integriert. Im Bundesländervergleich weisen Fahrlehrer aus dem neuen<br />
Bundesland trotz ähnlicher Anforderungssituation signifikant höheres Stresserleben<br />
und geringere Lebenszufriedenheit auf. Sie berichten niedrigere allgemeine<br />
Selbstwirksamkeitserwartung und höheren Alkoholkonsum. Insgesamt<br />
scheint diese Gruppe der Fahrlehrer ungünstigere und weniger effektive<br />
Stressbewältigungsmechanismen einzusetzen und geringere interne Ressourcen<br />
zu besitzen.<br />
Keywords:<br />
Gesundheitsanalyse, Fahrlehrer<br />
105
Strategische Planung als Mediator und Moderator der<br />
Intentions-Verhaltens-Beziehung<br />
Tabea Reuter, Jochen P. Ziegelmann, Amelie U. Wiedemann, Sonia<br />
Lippke & Benjamin Schüz<br />
Freie Universität Berlin, <strong>Gesundheitspsychologie</strong><br />
tabea.reuter@gmail.com<br />
Fragestellung: Das sozial-kognitive Prozessmodell gesundheitlichen Handelns<br />
(HAPA; Schwarzer, 1992) unterscheidet motivationale Prozesse, die <strong>zur</strong><br />
Bildung einer Intention führen, von volitionalen Prozessen, die die Handlungsausführung<br />
ermöglichen. In der vorliegenden Studie wird untersucht, welche<br />
Rolle Planungsprozesse in der volitionalen Phase der Gesundheitsverhaltensänderung<br />
spielen. Insbesondere wird überprüft, ob und inwiefern strategische<br />
Planung (Handlungsplanung, Bewältigungsplanung) die Intentions-Verhaltens-<br />
Beziehung moderiert und mediiert.<br />
Methode: Mittels standardisierter Fragebögen wurden zu drei Messzeitpunkten<br />
(Baseline, 1 Monat, 4 Monate) motivationale und volitionale Aspekte<br />
der Gesundheitsverhaltensänderung bei N = 111 Teilnehmern erfasst.<br />
Ergebnisse: Strategische Planung vermittelt teilweise den Zusammenhang<br />
zwischen Intentionen und zukünftigem Verhalten. Zudem hängt die Enge der<br />
Intentions-Verhaltens-Beziehung vom Ausmaß strategischer Planung ab.<br />
Diskussion: Die Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass Planungsprozesse<br />
entscheidend für die Umsetzung von Intentionen in Verhalten sind.<br />
Volitionale Interventionen mit Handlungsplanungs- und Bewältigungsplanungsaktivitäten<br />
sollten Bestandteil von Interventionen <strong>zur</strong> Umsetzung von<br />
Intentionen in Verhalten sein.<br />
Keywords:<br />
Strategische Planung, Intentions-Verhaltens-Beziehung, Gesundheitsverhaltensänderung<br />
106
Belastungserleben unter Schülern: Welche Rolle spielt<br />
die (In)Kongruenz zwischen Selbstkonzept und Qualität<br />
des Stressors?<br />
Tobias Ringeisen 1 , Hanns Martin Trautner 1 , Petra Buchwald 2 &<br />
Manuel Teubert 1<br />
1 Bergische Universität Wuppertal<br />
2 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf<br />
ringeisen@uni-wuppertal.de<br />
Auf Basis des dreiteiligen Modells der Selbstkonstruktion wurden die Zusammenhänge<br />
zwischen Belastungserleben und den drei Facetten des Selbst -<br />
relational (R), independent (I) und kollektiv (K) - für korrespondierende<br />
Stressoren (R, I und K) untersucht. Bisherige Forschung ist inkonsistent, da<br />
sowohl ein self-stress incongruence model (Belastung resultiert aus der Fehlpassung<br />
zwischen Stressorart und dominantem Selbst; z. B. Cross, 1995;<br />
Hardie et al., 2005) als auch ein self-stress congruence model (Ein ausgeprägtes<br />
Selbst begünstigt Belastung bei kongruenten weil selbstwertrelevanten<br />
Stressoren; z. B. Bacon, 2001; Uskul, 2005) bestätigt wurde.<br />
Zur Klärung der Zusammenhänge berichteten 100 Schüler in einer 2wöchigen<br />
Tagebuchstudie täglich den stärksten Stressor, zugehörige positive<br />
und negative Emotionen sowie das Ausmaß der Belastung. Durch qualitative<br />
Inhaltsanalyse konnten die Ereignisse zu sechs Stressor-Kategorien gruppiert<br />
werden, wobei die Ratings je Kategorie auf Personenebene gemittelt wurden.<br />
Neben zwei R- (Mangel an engen Beziehungen, Beziehungskonflikte) und drei<br />
I- (Körperliche Probleme, independente Stressoren, neutrale independente Ereignisse)<br />
resultierte eine K-Kategorie (Soziale Probleme mit anderen).<br />
Die Ergebnisse wiesen auf eine kategorie-spezifische Gültigkeit der o. g.<br />
self-stress-Modelle hin. Ein relationales Selbst führte zu Belastungen bei<br />
relationalen und independenten Stressoren, ging aber mit einer Verringerung<br />
bei kollektiven Stressoren einher. Umgekehrt begünstigte ein kollektives Selbst<br />
das Erleben von Well-being bei relationalen und körperlichen Stressoren, erhöhte<br />
aber Belastung bei kollektiven und independenten Stressoren. Ein independentes<br />
Selbst reduzierte Belastung bei independenten Stressoren und<br />
neutralen independenten Ereignissen. Offensichtlich fördert ein relationales /<br />
kollektives Selbst Stress bei inkongruenten [sozialen] Stressoren, während ein<br />
independentes Selbst Belastung in kongruenten Situationen reduziert.<br />
Keywords:<br />
Selbstkonstruktion, Belastung, daily hassles<br />
107
Zeitstruktur, Zeitverwendung und psychisches Wohlbefinden<br />
in der Erwerbslosigkeit<br />
Benedikt Rogge 1 , Peter Kuhnert 2 & Michael Kastner 2<br />
1 Universität Bremen<br />
2 Universität Dortmund<br />
brogge@gsss.uni-bremen.de<br />
Der psychische Gesundheitszustand von Erwerbslosen ist deutlich schlechter<br />
als derjenige von Beschäftigten (Paul, Hassel & Moser, 2006). Neben weiteren<br />
gelten Zeitstruktur und Zeitverwendung im Alltag als Moderatorvariablen, die<br />
einen protektiven Einfluss ausüben können. Jedoch mangelt es hierzu bislang<br />
an empirischen Studien (Lang-von Wins, von Rosenstiel & Mohr, 2004). Unsere<br />
explorative Studie untersucht anhand von zehn qualitativen Interviews mit langzeiterwerbslosen<br />
Männern (45-60 Jahre), wie diese ihre Alltagszeit<br />
strukturieren, gestalten und erleben sowie ihre psychischen Belastungen. Als<br />
Ergebnis wird 1.) eine Typologie der alltäglichen Zeitstruktur mit drei Merkmalsausprägungen<br />
vorgestellt. 2.) zeigt sich, dass der Zeitstrukturtyp entgegen weit<br />
verbreiteter Annahmen (Jahoda, 1982) in keinem interpretierbaren Zusammenhang<br />
mit den psychischen Belastungen der Männer steht. Vielmehr spielt 3.) die<br />
subjektive Bedeutung der Zeitverwendung eine deutlich wichtigere Rolle. Diese<br />
ist bei den Männern aber 4.) aus finanziellen, sozialen und persönlichkeitsbedingten<br />
Gründen stark eingeschränkt. Die Bedeutung der Ergebnisse für<br />
Forschung und Anwendung wird diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Jahoda, M. (1982). Employment and unemployment: A social-psychological analysis.<br />
Cambridge, England: Cambridge University Press.<br />
Lang-von Wins, T., Mohr, G. & von Rosenstiel, L. (2004). Kritische Laufbahnübergänge: Erwerbslosigkeit,<br />
Wiedereingliederung und Übergang in den Ruhestand. In Schuler, H.<br />
(Hrsg.), Organisationspsychologie – Grundlagen und Personalpsychologie. Enzyklopädie<br />
der Psychologie, Themenbereich D, Praxisgebiete, Serie III, Wirtschafts-,<br />
Organisations- und Arbeitspsychologie, Bd. 3. Hogrefe: Göttingen. S. 1113-1191.<br />
Paul, K.I., Hassel, A., & Moser, K. (2006). Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die<br />
psychische Gesundheit: Befunde einer quantitativen Forschungsintegration. In A.<br />
Hollederer & H. Brand (Hrsg.), Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Krankheit (S.35-51).<br />
Bern: Huber.<br />
Keywords:<br />
Arbeitslosigkeit, psychische Gesundheit, Alltag<br />
108
Einfluss sportlicher Betätigung auf das Körperkonzept<br />
und die Lebensqualität krebskranker Jugendlicher und<br />
junger Erwachsener<br />
Roberto Rojas 1 , Wolfgang Schlicht 2 , Lisa Eimert 3 & Eberhard Leidig 3<br />
1 Klinik Roseneck<br />
2 Universität Stuttgart<br />
3 Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe<br />
roberto.rojas@web.de<br />
Fragestellung: Die Studie berichtet über die Wirkungen eines angeleiteten<br />
Sportprogramms auf physiologische (PWC-150) und psychosoziale Variablen<br />
(Körperkonzept und Lebensqualität) krebskranker Jugendlicher und junger Erwachsener<br />
in der stationären Nachsorge einer Rehabilitationsklinik.<br />
Methode: Das Studiendesign folgt einem prospektiven einjährigen Längsschnitt<br />
mit zwei Gruppen (Interventions- und Kontrollgruppe) und vier Messzeitpunkten<br />
(Aufnahme, Ende der einmonatigen stationären Behandlung, Ende der<br />
6-monatigen und der 12-monatigen Katamnese). An der Studie nahmen 130<br />
krebskranke Jugendliche (15-19 Jahre) und junge Erwachsene (20-25 Jahre)<br />
teil. 90 Pbn konnten der Sport- und 40 Pbn der Kontrollgruppe zugewiesen<br />
werden.<br />
Ergebnisse: Am Ende der Untersuchung wurde eine Verbesserung der<br />
Leistungsparameter, des Körperkonzepts und der Lebensqualität sowohl in der<br />
Sport- als auch in der Kontrollgruppe festgestellt, die in der Katamnesephase<br />
geringfügig abnahm. Weitergehende Analysen zeigen eine ungleiche Verteilung<br />
der sportlichen Betätigung der Probanden beider Gruppen vor und während der<br />
Studie. Ordnet man die Pbn nach dem Ausmaß ihrer „sportlichen Tätigkeit“<br />
(überwiegend sportaktiv und überwiegend sportinaktiv), stellt sich heraus, dass<br />
überwiegend Sportaktive im Vergleich zu überwiegend Sportinaktiven ein<br />
stabiles Körperkonzept, besonders bei der Wahrnehmung der körperlichen<br />
Effizienz, des körperlichen Befindens und der Selbstakzeptanz des Körpers,<br />
trotz körperlicher Beschwerden bzw. Beeinträchtigungen und des Risikos eines<br />
negativen Krankheitsverlaufs, zeigen. Die Ergebnisse stützen die Hypothese,<br />
dass sportliche Betätigung eine Art Schutzfunktion hinsichtlich des Körperkonzepts<br />
krebserkrankter Jugendlicher und junger Erwachsenen ausübt. In<br />
diesem Zusammenhang war auch sehr motivierend festzustellen, dass die Zahl<br />
der sportlich aktiven Pbn ein Jahr nach Beendigung ihres stationären Aufenthalts<br />
deutlich höher lag (66 %) als zum Zeitpunkt der Aufnahme (42 %).<br />
Keywords:<br />
Krebs, Sport, Körperkonzept<br />
109
Der Einfluss von Ursachenzuschreibungen und Benefit-<br />
Finding auf die Lebensqualität bei chronischen Erkrankungen:<br />
Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung<br />
Udo Rudolph 1 & Eike Fittig 2<br />
1 TU Chemnitz<br />
2 TU Dresden<br />
udo.rudolph@phil.tu-chemnitz.de<br />
Die vorliegende Studie geht der Frage nach, welche Bedingungen Personen mit<br />
chronischen Erkrankungen ein möglichst hohes Ausmaß an physischem und<br />
psychischem Wohlbefinden ermöglichen. Wir nehmen an, dass hierbei kognitive<br />
Prozesse, insbesondere Ursachenzuschreibungen (Attributionen) und Benefit-<br />
Finding eine Schlüsselfunktion zukommt. Anhand eines längsschnittlichen<br />
Untersuchungsdesigns mit N = 129 Personen untersuchen wir die Auswirkungen<br />
von Attributionen und Benefit-Finding auf subjektive Lebenszufriedenheit<br />
und Wohlbefinden bei Personen mit Diabetes mellitus und<br />
koronaren Herzerkrankungen. Attributionen, psychisches und physisches<br />
Wohlbefinden sowie die subjektive Lebenszufriedenheit wurden während eines<br />
stationären Aufenthaltes der Patienten sowie nach einem durchschnittlichen<br />
Follow-up-Zeitraum von 3 Jahren erfasst. Patienten, die sich <strong>zur</strong> Baseline-<br />
Messung hohe Verantwortung für ihre Erkrankung zuschreiben, berichten 3<br />
Jahre später über signifikant geringere Lebensqualität. Bei Patienten mit<br />
Diabetes mellitus zeigt sich zudem ein signifikanter Einfluss von Stress als<br />
wahrgenommener Ursache der Erkrankung auf ein geringeres physisches und<br />
psychisches Wohlbefinden. Attributionen auf Vererbung führen hingegen zu<br />
einer signifikant besseren subjektiven Lebenszufriedenheit dieser Patienten<br />
zum Zeitpunkt der Follow-up-Erhebung. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf<br />
ihre Implikationen für tertiär-präventive Maßnahmen diskutiert.<br />
Keywords:<br />
Chronische Erkrankungen, Attribution, Lebensqualität<br />
110
Der Einfluss des Alters auf multiples Gesundheitsverhalten<br />
bei Angestellten im Bahnbetrieb<br />
Rebecca Rueggeberg 1 , Jochen P. Ziegelmann 2 , Amelie U.<br />
Wiedemann 2 , Tabea Reuter 2 & Sonia Lippke 2<br />
1 Technische Universität Berlin<br />
2 Freie Universität Berlin<br />
r_rueggeberg@web.de<br />
Im Rahmen des Projekts „Gesund und Fit“ der Freien Universität Berlin, der<br />
Deutschen Bahn AG und des DB Gesundheitsservice wurde das Zusammenspiel<br />
von sozial-kognitiven Variablen und multiplem Gesundheitsverhalten betrachtet.<br />
Es wurde untersucht inwieweit personale Ressourcen die Ausübung<br />
regelmäßiger körperlicher Aktivität und den Verzehr von Obst und Gemüse im<br />
Zusammenhang mit dem Alter beeinflussen. Die Betrachtung objektiver<br />
medizinischer Parameter sowie der subjektiven Gesundheit lieferten weitere<br />
Aufschlüsse über mögliche Wirkungszusammenhänge zwischen den untersuchten<br />
Konstrukten.<br />
Im Rahmen der Pilotierungsphase des Projekts, wurden rund 107 Bahnbeschäftigte<br />
im Alter von 20-63 Jahren befragt.<br />
Hypothesenkonform zeigte sich, dass die sportliche Selbstwirksamkeitserwartung<br />
und damit einhergehend auch die körperliche Aktivität mit dem Alter<br />
abnehmen. Dabei übte die Selbstwirksamkeit den größten Einfluss auf die<br />
Intention aus. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass die Selbstwirksamkeit<br />
sowie die Intention wiederum das multiple Gesundheitsverhalten bedeutend<br />
beeinflussen.<br />
Die körperliche Aktivität wirkte sich positiv auf die objektive Gesundheit<br />
aus, während das Alter die objektive Gesundheit erwartungsgemäß negativ beeinflusste.<br />
Ferner zeichnete sich ab, dass zwischen der objektiven und der<br />
subjektiven Gesundheit ein bedeutender Zusammenhang bestand.<br />
Keywords:<br />
Körperliche Aktivität, Ernährungsverhalten, Alter<br />
111
Nehmen Depressionen in der Schweizer Bevölkerung<br />
zu? Eine Analyse des Monitorings Psychische Gesundheit<br />
Schweiz<br />
Peter Rüesch 1 & Daniela Schuler 2<br />
1<br />
Fachstelle Gesundheitswissenschaften, Zürcher <strong>Hochschule</strong> Winterthur<br />
2<br />
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, Neuenburg<br />
rup@zhwin.ch<br />
Problem: Psychische Gesundheitsprobleme, insbesondere die Depression erregen<br />
in Medien und Öffentlichkeit Aufmerksamkeit. Auch in der Schweiz geht<br />
die Rede von der Depression als Volkskrankheit um. Dabei wird der Vermutung<br />
Ausdruck gegeben, dass Depressionen in der Bevölkerung zugenommen haben.<br />
Fragestellungen: (1) Hat die Prävalenz von Depressionen unterschiedlichen<br />
Schweregrades in der Schweizer Bevölkerung zwischen 1997 und 2004<br />
zugenommen? (2) Wie zeigt sich diese Entwicklung bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen<br />
(Geschlecht, Alter, soziale Herkunft)? (3) Wie groß ist der<br />
Anteil von Personen mit Depressionen, die professionelle Hilfe in Anspruch<br />
nehmen?<br />
Methode: Will man die Vermutung der Zunahme von Depressionen prüfen,<br />
so stellen sich v.a. zwei Probleme: Erstens ist der alltagssprachliche Begriff<br />
Depression unscharf, er deckt sich nur beschränkt mit dem psychiatrischklinischen<br />
Begriff. Zweitens liegen für die Schweizer Bevölkerung nur wenige<br />
epidemiologisch valide Daten <strong>zur</strong> Prävalenz psychischer Störungen vor. In diesem<br />
Beitrag wird der Versuch dargestellt, Informationen aus verschiedenen<br />
Datenquellen (Schweiz. Gesundheitsbefragung SGB, Schweiz. Haushaltspanel,<br />
Medizin. Statistik der Krankenhäuser) zu integrieren und valide Aussagen zu<br />
Prävalenz und zeitlichen Trends (1997-2004) von Depressionen abzuleiten. Im<br />
Zentrum der Analyse stehen Bevölkerungskennwerte des Depression Screening<br />
Questionnaire nach ICD-10 aus der SGB. Grundlage ist das Monitoring<br />
Psychische Gesundheit Schweiz, für das der Referent zusammen mit dem<br />
Schweizer Gesundheitsobservatorium einen Baseline-Bericht (2003) und einen<br />
Trendbericht (2007) verfasst hat.<br />
Ergebnisse: Befunde basierend auf dem Trendbericht des Monitorings<br />
deuten darauf hin, dass die Prävalenz von Depressionen in der Bevölkerung im<br />
untersuchten Zeitraum kaum zugenommen hat, aber mehr Menschen professionelle<br />
Hilfe in Anspruch nehmen. Im Rahmen dieses Beitrags sollen diese Befunde<br />
vertiefend untersucht werden.<br />
Keywords:<br />
Depression, Epidemiologie, Gesundheitsversorgung<br />
112
Der Einfluss erinnerter elterlicher Erziehung auf die<br />
Lebenskompetenz junger Erwachsener<br />
Marah Saenger & Urs Fuhrer<br />
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg /Institut für Psychologie<br />
marahmarie@gmail.com<br />
Die Studie untersucht den Einfluss erinnerter elterlicher (d. h. mütterlicher und<br />
väterlicher) Erziehung auf die Lebenskompetenz junger Erwachsener und prüft<br />
auch Interaktionseffekte zwischen dem Erziehungsverhalten beider Eltern.<br />
Lebenskompetenz wurde, dem Konzept der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO, 2001) folgend, als globales Maß psychosozialer Kompetenz definiert.<br />
Demnach soll sie helfen, Herausforderungen des täglichen Lebens durch<br />
positives Verhalten effektiv zu bewältigen. In der Studie wurden acht der von<br />
der WHO genannten Lebensfertigkeiten operationalisiert: Entscheidungen<br />
treffen, Probleme lösen, Kreatives Denken, Effektive Kommunikation, Interpersonale<br />
Beziehungsfähigkeiten, Selbstkenntnis, Empathie und Coping mit<br />
Emotionen. In Anlehnung an die neuere psychologische Erziehungsforschung<br />
(Fuhrer, 2005) wurden drei globale Dimensionen elterlichen Erziehungsverhaltens<br />
erfasst: elterliche Wärme, Verhaltenskontrolle und psychologische<br />
Kontrolle.<br />
Die retrospektive, querschnittliche Fragebogenstudie wurde an einer<br />
akademischen Stichprobe (N = 544; 55 % weiblich, 45 % männlich; Altersdurchschnitt<br />
24 Jahre, SD = 2.6) in drei deutschen Städten durchgeführt. Mittels<br />
linearer Strukturgleichungsmodelle (SGM) wurde der Einfluss elterlicher Erziehung<br />
auf die Lebenskompetenz geprüft. Von den drei Erziehungsdimensionen<br />
erwies sich elterliche Wärme als stärkster Prädiktor für Lebenskompetenz.<br />
Die getesteten SGM zeigten einen eher unbefriedigenden Daten-Fit<br />
und indizieren, dass weitere Faktoren <strong>zur</strong> Erklärung der Lebenskompetenz<br />
herangezogen werden müssen. Zudem zeigten sich in den Regressionsanalysen<br />
bei Söhnen Wechselwirkungen mütterlicher und väterlicher Wärme bzw.<br />
psychologischer Kontrolle. Für die Ausprägung der Lebenskompetenz erwiesen<br />
sich Diskrepanzen zwischen dem Erziehungsverhalten der beiden Eltern als<br />
abträglich.<br />
Literatur:<br />
Fuhrer, U. (2005). Lehrbuch Erziehungspsychologie. Bern: Huber.<br />
World Health Organisation (Ed.) (2001). Skills for health. Geneva: WHO.<br />
Keywords:<br />
Erziehung, Lebenskompetenz<br />
113
Der Gesundheits-Q-Sort (GQS) – ein innovatives<br />
Verfahren <strong>zur</strong> Messung des gesundheitsbezogenen<br />
Selbstkonzepts<br />
Christian Sander & Harry Schröder<br />
Universität Leipzig<br />
Chsander@uni-leipzig.de<br />
Einer Erfassung des Konzepts der eigenen psychischen Gesundheit kommt<br />
klinische und gesundheitspsychologische Relevanz zu, da sich im Selbstbild<br />
das Ausmaß der psychischen Gesundheit widerspiegelt und sich psychische<br />
Störungen in Struktur- und Funktionsbesonderheiten des Selbstkonzepts<br />
äußern. Somit ist das Selbstkonzept Kernpunkt vieler therapeutischer Bemühungen.<br />
Dennoch handelt es sich beim gesundheitsbezogenen Selbstkonzept<br />
um einen Aspekt, der von bestehenden Selbstkonzept-Skalen bisher<br />
nicht abgedeckt wird.<br />
Der hier vorgestellte Gesundheits-Q-Sort (GQS) dient der Erfassung<br />
personaler Gesundheitsqualitäten und deren Veränderung unter Bedingungen<br />
systematischer Interventionen. Erfasst wird neben dem Selbstbild auch das<br />
Idealkonzept der eigenen Gesundheit. Aus dem Vergleich beider Konzepte<br />
kann ein Maß für innerseelische Konsistenz abgeleitet werden. Ein solches<br />
Maß ist von Interesse für die Beurteilung von Status und Veränderung der<br />
seelischen Gesundheit. Größere Diskrepanzen zwischen Selbst- und Idealbild<br />
korrelieren mit negativer Emotionalität und niedriger Lebenszufriedenheit.<br />
Wirkeffekte psychosozialer Intervention sollten sich in einer Reduktion solcher<br />
Unterschiede zeigen. Ein wichtiger Anwendungsbereich des GQS ist somit die<br />
Qualitätssicherung psychosozialer, speziell auch psychotherapeutischer Interventionen.<br />
Ein Vergleich von Selbst- und Idealkonzept kann ausschließlich im<br />
Bezugssystem des konkreten Individuums erfolgen. Deshalb ist ein ipsatives<br />
Vorgehen dem Gegenstandsbereich angemessen. Der GQS nutzt die Q-<br />
Sortierungstechnik und ist somit in einer der Messintention entsprechenden<br />
Methodik gestaltet.<br />
Im Referat wird der Gesundheits-Q-Sort vorgestellt, wobei die <strong>zur</strong> Verfahrenskonstruktion<br />
nötigen Schritte, das Testmaterial und die Durchführung<br />
des Verfahrens beschrieben werden. Es werden Ergebnisse einer Validierungsstudie<br />
mit 344 Psychotherapiepatienten referiert sowie eine Kurzform des Verfahrens<br />
und eine Computer-Version vorgestellt.<br />
Keywords:<br />
Selbstkonzept, Q-Sort, Therapieevaluation<br />
114
Elterliche Belastung als Mediator der Erziehungskompetenz<br />
Uli Sann<br />
Universität Frankfurt<br />
u.sann@paed.psych.uni-frankfurt.de<br />
Fragestellung: Trainingsansätze <strong>zur</strong> Verbesserung elterlicher Kompetenzen<br />
spielen eine bedeutsame Rolle in der Prävention und Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten<br />
bei Kindern. Sind die Belastungen der Eltern allerdings<br />
hoch können vorhandene oder in Elterntrainings erworbene Erziehungskompetenzen<br />
kaum umgesetzt werden. Die von Abidin (1992) postulierte Rolle<br />
elterlichen Belastungserlebens als Mediator der Beziehung verschiedener<br />
Ressourcen und Risikofaktoren einerseits und der elterlichen Erziehungskompetenz<br />
andererseits wurde in einer Untersuchung überprüft.<br />
Methode: In Anlehnung an verschiedene Forschungsergebnisse, die für<br />
die elterliche Kompetenzüberzeugung als einem Indikator für tatsächliche Erziehungskompetenz<br />
sprechen, wurden an einer Stichprobe von 409 Teilnehmerinnen<br />
von Eltern-Kind-Gruppen elterliche Kompetenzüberzeugung<br />
(Parenting Sense of Competence) als Kriterium und elterliches Belastungserleben<br />
(Parenting Stress Index) als Mediator erhoben. Als Prädiktoren wurden<br />
elterliche Uneinigkeit (Parenting Problem Checklist), soziale Unterstützung<br />
(Fragebogen <strong>zur</strong> Sozialen Unterstützung) und kindliche Problembereiche betrachtet.<br />
Zusätzlich wurden mit einer für die Mutter-Kind-Interaktion adaptierten<br />
Form des Fragebogens „Umgang mit Belastungen im Verlauf“ Informationen<br />
zum Bewältigungsverhalten der Mütter gesammelt.<br />
Ergebnisse: In der pfadanalytischen Überprüfung ergibt sich ein Mediatoreffekt<br />
des elterlichen Belastungserlebens auf die Beziehung zwischen elterlicher<br />
Uneinigkeit und sozialer Unterstützung einerseits und elterlichen<br />
Kompetenzüberzeugungen andererseits, dessen Plausibilität auch bei der Betrachtung<br />
der Zusammenhänge zu zwei Messzeitpunkten gestützt wird. Weitere<br />
Ergebnisse <strong>zur</strong> Rolle des elterlichen Bewältigungsverhaltens werden vorgestellt.<br />
Grenzen und Entwicklungsmöglichkeiten der vorgestellten Befunde<br />
werden diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Abidin, R.R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of Clinical Child Psychology,<br />
21, 407-412.<br />
Keywords:<br />
Erziehungskompetenz, Belastung<br />
115
Entwicklung und Evaluation eines sinnesorientierten<br />
Zugangs <strong>zur</strong> Gesundheits- und Ernährungsbildung<br />
Steffen Schaal<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Ludwigsburg / Abt. Biologie<br />
schaal@ph-ludwigsburg.de<br />
Ein wichtiger Aspekt schulischer Gesundheitsbildung ist die Vermittlung einer<br />
gesunden Ernährung. Die bisher erzielten Erfolge sind jedoch entweder<br />
marginal oder in Hinblick auf das Ernährungsverhalten Jugendlicher mäßig<br />
dokumentiert (vgl. Lach, 2003). Das Ernährungsverhalten Jugendlicher ist nur<br />
schwer zu beeinflussen: Für Jugendliche steht die Befriedigung kurzfristiger<br />
Bedürfnisse eher im Vordergrund als die Betrachtung langfristiger Folgen und<br />
Auswirkungen. Von daher sollte sich schulische Ernährungsbildung statt an<br />
normativ-defizitorientierten Ansätzen in stärkerem Maße an ressourcenorientierten<br />
Konzepten orientieren (Bartsch & Methfessel, 2004). Diese müssen<br />
alltagsgerecht, mehrperspektivisch und verhaltensrelevant sein, um die Bedürfnisse<br />
der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen.<br />
Im Forschungsprojekt „Geschmacksunterricht – SINNvolle Gesundheitsbildung“<br />
wird eine Unterrichtseinheit <strong>zur</strong> Ernährungsbildung unter besonderer<br />
Berücksichtigung des Geschmackssinns betreut und unter ökologischen Bedingungen<br />
evaluiert und weiterentwickelt. Hierbei wird neben der Betonung<br />
eines sinnhaften Zugangs <strong>zur</strong> Ernährung der authentische Lernkontext durch<br />
Chefköche als externe Experten sichergestellt (www.eurotoques.de).<br />
Es wurden drei Teilstudien in der 5. Klasse der Realschule (N = 160) in<br />
einem Pre-/ Post-Test-Design mit einer Kontrollgruppe (N = 25) durchgeführt.<br />
Dabei sollte geklärt werden, ob die kurzfristige Intervention über drei Schulstunden<br />
zu relevanten Wissenszunahmen führt und ernährungsbezogene Verhaltensweisen,<br />
Einstellungen und Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflussen<br />
kann. Zur Messung wurden bewährte empirische Verfahren verwendet sowie<br />
neue Verfahren eingesetzt (Eschenbeck & Kohlmann, 2004). Die Ergebnisse<br />
zeigen erwartungsgemäß keine Verhaltensänderungen, jedoch eine Zunahme<br />
des Wissens, positive Veränderungen bei gesundheitsbezogenen Einstellungen<br />
und ernährungsrelevanten Selbstwirksamkeitserwartungen sowie der Beurteilung<br />
der Bedeutsamkeit des Essens.<br />
Keywords:<br />
Ernährungsbildung, Geschmacksunterricht, authentischer Lernkontext<br />
116
Implementation und Evaluation von Gesundheitsförderung<br />
in Schulentwicklungsprozessen<br />
Steffen Schaal 1 & Waldemar Mittag 2<br />
1 <strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Ludwigsburg / Abt. Biologie<br />
2 <strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Ludwigsburg / Psychologie<br />
schaal@ph-ludwigsburg.de<br />
Schulische Gesundheitsbildung sollte neben der Stärkung der gesundheitsbezogenen<br />
Lebenstüchtigkeit der Lernenden auch die Gesundheit aller an der<br />
Schule Beteiligten berücksichtigen. Damit wird Gesundheitsbildung zu einem<br />
Teil eines Schulentwicklungsprozesses, der das gesamte „Setting Schule“ betrifft<br />
und auch Gemeindestrukturen und vorhandene Netzwerke mit einbezieht.<br />
Im Rahmen dieser Studie (’07-’10) werden fünf Schulen der Sek. I bei der<br />
Ausbildung eines schulischen Leitbildes <strong>zur</strong> „Gesundheitsfördernden Schule“<br />
begleitet und durch ein Netzwerk der <strong>Pädagogische</strong>n <strong>Hochschule</strong> Ludwigsburg,<br />
dem BZgA-Programm „Gut Drauf“ sowie dem Gesundheitsamt und dem<br />
Landesinstitut für Schulsport betreut.<br />
Hierzu wurde der „Gut Drauf“-Präventionsansatz für die Schule adaptiert<br />
und als fester Bestandteil in der Lehrerausbildung an der PH Ludwigsburg<br />
etabliert. Studierende erhielten zunächst eine Qualifikation als „Gut Drauf“-<br />
Multiplikatoren und wurden an der schulischen Adaptation des Programms beteiligt.<br />
Dabei wurden didaktisch aufbereitete Unterrichtskonzepte und<br />
Materialien zu „Ernährung – Bewegung – Stressbewältigung“ entwickelt, erprobt<br />
und evaluiert. Diese sind am Curriculum verankert und stehen den Schulen im<br />
Unterricht <strong>zur</strong> Verfügung. Damit werden die LehrerInnen bei der Vorbereitung<br />
entlastet und Ressourcen für den Schulentwicklungsprozess gewonnen.<br />
Zusätzlich übernehmen Studierende Unterrichtssequenzen und die Gestaltung<br />
außerunterrichtlicher Veranstaltungen.<br />
Die empirische Evaluation wird in längs- und querschnittlicher Betrachtung<br />
den Erwerb relevanten Wissens, Veränderungen ernährungs-/ bewegungs- und<br />
entspannungsbezogener Selbstwirksamkeitserwartungen, das Ernährungs-<br />
oder Bewegungsverhalten der SchülerInnen sowie deren Wohlbefinden untersuchen.<br />
Verfahren der Implementationsforschung überwachen den schulischen<br />
Entwicklungsprozess und ermöglichen Aussagen über den Zusammenhang zu<br />
den schülerbezogenen Ergebnissen. Präsentiert werden die Ergebnisse der<br />
Eingangsuntersuchung.<br />
Keywords:<br />
Schulische Gesundheitsförderung, Schulentwicklung, "Gut Drauf"-Programm<br />
117
Empirische Gesundheitsanalysen bei Orchestermusikern<br />
Ingolf Schauer 1 & Harry Schröder 2<br />
1 <strong>Hochschule</strong> für Musik und Theater Leipzig<br />
2 Universität Leipzig<br />
ingolf_schauer@web.de<br />
Hintergrund: Berufsmusiker sind physischen und psychischen Belastungen<br />
ausgesetzt, die vor und während des Berufslebens akute oder chronische Beschwerden<br />
(mit)verursachen können. In Deutschland sind derzeit 10.500<br />
Orchestermusiker tätig, wobei die Zahl der wegen Berufsunfähigkeit vorzeitig<br />
berenteten sehr hoch ist.<br />
Ziel des Beitrages ist die Identifikation von berufsspezifischen Belastungen<br />
und Stressoren sowie die Suche nach gesundheitsprotektiven<br />
Faktoren und Ressourcen.<br />
Methode: Eine empirische Felderhebung in Form einer „betrieblichen“ Gesundheitsanalyse<br />
nutzte psychometrische Fragebogenskalen. Untersucht<br />
wurden 8 philharmonische Orchester aus 4 Bundesländern (N = 370 Musiker),<br />
unterteilt nach Alter (50), Geschlecht, Position im Orchester (Solo,<br />
Tutti).<br />
Ergebnisse: Die Befunde zeigen, dass die Mehrheit der Musiker ihre<br />
Arbeit positiv bewertet: sie ist abwechslungsreich, sinnvoll, bereitet ihnen<br />
Freude und trägt <strong>zur</strong> Entfaltung ihrer Fähigkeiten bei. Knapp die Hälfte der<br />
Musiker leidet unter den Auswirkungen von Organisations- und Umgebungsbedingungen<br />
(mangelnde Entscheidungsmöglichkeiten, un<strong>zur</strong>eichende<br />
Informiertheit bei Veränderungen und geringe Fürsorge). Zwischen den einzelnen<br />
Orchestern bestehen gravierende Unterschiede (spezifische Problemmuster).<br />
Jüngere Musiker beurteilen die Arbeitsbedingungen negativer als<br />
ältere und leiden häufiger an Magen-Darm-Beschwerden. Solisten schätzen<br />
Arbeitsinhalte und Entscheidungsmöglichkeiten positiver ein. Die mit<br />
Regressionsanalysen erstellten Modelle belegen, dass sowohl institutionelle als<br />
auch personale Bedingungen körperliche und psychische Beschwerden mit<br />
unterschiedlichen Gewichten prädizieren.<br />
Schlussfolgerungen: Aus den differenzialpsychologischen Befunden bezüglich<br />
Orchester, Position, Alter und Geschlecht konnten Ansätze für gruppenspezifische<br />
Prävention und Interventionen abgeleitet werden.<br />
Keywords:<br />
Gesundheitsanalysen, Stressoren, Orchestermusiker<br />
118
Chronifizierung von Schlafstörungen bei Kindern<br />
Angelika Schlarb & Martin Hautzinger<br />
Universität Tübingen<br />
angelika.schlarb@uni-tuebingen.de<br />
Einführung: Schlafstörungen im Kindesalter sind häufiger als allgemein angenommen:<br />
25 % (Mindell, 1993) bis 40 % der Kinder im Vorschul- und Schulalter<br />
leiden unter Schlafstörungen. Schulprobleme und psychische Auffälligkeiten<br />
sind als Komorbidität bzw. als Folgeerscheinung häufig. In diesem<br />
Forschungsprojekt wurden Kinder mit behavioraler Insomnie im Alter von 5 bis<br />
10 Jahren mit Hilfe eines psychologischen Behandlungsprogramms<br />
(standardisiert) behandelt. Das Behandlungsprogramm wurde in einem<br />
kontrollierten Design evaluiert.<br />
Patienten und Methode: Das Design folgte einem kontrollierten<br />
randomisierten Versuchsplan. Die Kinder wurden nach Aufklärung und Zustimmung<br />
der Eltern zufällig einer Kontrollbedingung oder einer Experimentalbedingung<br />
(Psychologische Therapie) zugeteilt. Bisher wurden 24 Kinder<br />
zwischen 5 und 10 Jahren behandelt. Eingesetzte Schlafmaße waren: CSHQ,<br />
SDI in einer deutschen Version. Daneben wurden jedoch weitere psychologische<br />
Maße erhoben: CBCL, SCL-90, PSOC, EFBK. Neben Prä- und Postmessungen<br />
wurden 3 und erste 6 Monatskatamnesen durchgeführt.<br />
Ergebnisse: Das Training zeigte vielfältige signifikante Verbesserungen,<br />
so reduzierten sich die schlafbezogenen Schwierigkeiten in hochsignifikantem<br />
Maße. Die Eltern schätzen das Verhalten ihrer Kinder als gesünder ein, denn<br />
die Werte in der CBCL zeigten signifikante Veränderungen. Darüber hinaus<br />
verbesserte sich jedoch auch das persönliche Befinden der Eltern signifikant<br />
(SCL-90). Und die Eltern konnten sich in ihrer Erziehungsfunktion als<br />
kompetenter wahrnehmen (PSOC).<br />
Schlussfolgerung: Das multimodale psychologische Trainingsprogramm<br />
für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren erreicht signifikante Verbesserungen.<br />
Neben der Veränderung des elterlichen Erziehungsverhaltens zeigt sich vor<br />
allem auch eine Verbesserung der schlafbezogenen Maße und anderer psychologischer<br />
Parameter.<br />
Keywords:<br />
Schlafstörungen, Kinder, Therapie<br />
119
Personale Ressourcen, Coping und Lebensqualität von<br />
Brustkrebspatientinnen im postoperativen Verlauf<br />
Gabriele Schmid, Barbara Voigt, Anne Grimm, Burghard F. Klapp &<br />
Martina Rauchfuß<br />
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik, Charité, Berlin<br />
gabriele.schmid@charite.de<br />
Fragestellung: Bei Krebserkrankungen gilt die Lebensqualität als wichtiger Indikator<br />
für die Krankheitsanpassung. In einigen Studien mit Brustkrebspatientinnen<br />
wurden Zusammenhänge zwischen personalen Ressourcen, dem<br />
Copingstil und der Lebensqualität gefunden. In der vorliegenden Studie soll<br />
überprüft werden, wie sich die personalen Ressourcen, der Copingstil, die<br />
Stressbelastung und die Lebensqualität von Brustkrebs-Patientinnen postoperativ<br />
(im Laufe eines Jahres) entwickeln. Außerdem soll untersucht werden,<br />
ob es Zusammenhänge gibt zwischen den personalen Ressourcen, dem<br />
Copingstil, der Stressbelastung und der Lebensqualität.<br />
Methode: Ausgewertet wurden die Daten von n = 64 Patientinnen mit Erstdiagnose<br />
Brustkrebs, die zu drei Messzeitpunkten befragt wurden: drei Monate<br />
(T1), sechs Monate (T2) und 12 Monate (T3) postoperativ. Erfasst wurden<br />
personale Ressourcen (Selbstwirksamkeit, Optimismus, Pessimismus,<br />
Kohärenzsinn), der Copingstil (Brief-COPE), die Stressbelastung (PSQ) sowie<br />
die krankheitsspezifische (QLQBR-23) und die allgemeine (SF-8) Lebensqualität.<br />
Die Analyse der Daten erfolgte mittels multivariater Verfahren.<br />
Ergebnisse: Es zeigte sich, dass sich das Körperbild im postoperativen<br />
Verlauf über ein Jahr verbesserte und die Stressbelastung zunahm. Die allgemeine<br />
Lebensqualität, die personalen Ressourcen und der Copingstil veränderten<br />
sich nicht. Darüber hinaus berichteten Patientinnen mit einem hohen<br />
Kohärenzgefühl (T1) nach einem Jahr ein signifikant besseres Körperbild und<br />
weniger Stressbelastung als Patientinnen mit einem niedrigen Kohärenzgefühl.<br />
Der Copingstil‚ Selbstbeschuldigung’ (T1) hing mit einem schlechteren Körperbild<br />
(T3) zusammen. Außerdem zeigten sich Zusammenhänge zwischen hohen<br />
Werten für Selbstwirksamkeitserwartung und Optimismus (T1) und einer<br />
geringeren Stressbelastung (T3).<br />
Keywords:<br />
Ressourcen, Lebensqualität, Brustkrebs<br />
120
Burnout: Neue Erkenntnisse in neuen Branchen<br />
Sabine Schmidt & Kathleen Otto<br />
Universität Leipzig, Institut für Psychologie II<br />
sa-schmidt@gmx.de<br />
Durch die stetig zunehmende Anzahl an Betroffenen ist Burnout in den letzten<br />
Jahren zu einem Schlagwort in der breiten Öffentlichkeit geworden. Von<br />
wissenschaftlicher Seite aus wurde Burnout bisher vorwiegend an sozialen Berufen<br />
wie KrankenpflegerInnen oder LehrerInnen untersucht. Während Burnout<br />
hier mit negativen Konsequenzen wie Leistungsabfall und krankheitsbedingter<br />
Abwesenheit vom Arbeitsplatz in Verbindung gebracht wurde, sind vergleichbare<br />
Untersuchungen zu Tätigkeiten in Industrie und Wirtschaft bisher kaum<br />
durchgeführt worden. Um diese Forschungslücke zu füllen, befragten wir mehr<br />
als 200 Beschäftigte unterschiedlicher Branchen (z. B. Computer & EDV,<br />
Finanzen & Versicherungen, Handel) in einer Onlinestudie zu ihrem Burnouterleben<br />
(Depersonalisation, emotionale Erschöpfung, persönliche Erfüllung,<br />
Betroffenheit) und zu Umgebungsfaktoren wie der Bewertung des sozialen<br />
Arbeitskontextes (Rückmeldung durch Führungskraft und Kollegen; Unterstützung<br />
durch die Organisation, Mobbingerleben) oder der Einschätzung aufgabenbezogener<br />
Merkmale (Feedback durch die Tätigkeit, Rollenklarheit).<br />
Weiterhin erfragten wir individuelle Faktoren wie das Verhalten bei Krankheit<br />
(Abwesenheit vs. Anwesenheit), die emotionale Gebundenheit an den Arbeitgeber<br />
sowie die Selbstbewertung der erbrachten Arbeitsleistung. In einem<br />
Extremgruppenvergleich von weniger vs. stärker Betroffenen von Burnout erwarteten<br />
wir, dass sich Unterschiede sowohl in den Umgebungsfaktoren als<br />
auch in den individuellen Faktoren finden. Bisherige Analysen bestätigten<br />
unsere Annahmen. Es wird diskutiert, dass Burnout künftig auch außerhalb der<br />
sozialen Berufe erforscht werden sollte. Das Wissen, welche Umgebungs- und<br />
individuellen Faktoren <strong>zur</strong> Entwicklung von Burnout beitragen, kann so bei<br />
Organisationsentwicklungsprozessen genutzt werden, um Burnout bei Tätigkeiten<br />
in Industrie und Wirtschaft gezielt entgegenzuwirken.<br />
Keywords:<br />
Burnout, Wirtschaft<br />
121
Ernährungsumstellung bei Übergewichtigen:<br />
Ein veränderungsorientierter Zugang<br />
Urte Scholz, Matthias Kliegel & Rainer Hornung<br />
Universität Zürich<br />
urte.scholz@psychologie.unizh.ch<br />
Fragestellungen: Weltweit steigt die Anzahl übergewichtiger Personen. Übergewicht<br />
geht mit einem erhöhten Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko einher. Die<br />
nachhaltigste Methode <strong>zur</strong> dauerhaften Gewichtsreduktion ist eine Umstellung<br />
der Ernährung. Das Prozessmodell gesundheitlichen Handelns von Schwarzer<br />
(1992) diente als theoretisches Rahmenmodell <strong>zur</strong> Untersuchung der Relevanz<br />
motivationaler und volitionaler Komponenten bei der Veränderung der Ernährungsgewohnheiten.<br />
Insbesondere interessierte hier die Frage, wie der<br />
dynamische Prozess der Ernährungsumstellung durch die Veränderung in den<br />
motivationalen und volitionalen Prädiktoren erklärt werden kann.<br />
Methode: Die Online-Datenerhebung fand im Rahmen eines Online-<br />
Ernährungsprogramms (www.eBalance.ch) statt. Zum ersten Messzeitpunkt<br />
wurden 469 Personen befragt (81.9 % Frauen; mittleres Alter 44.25,<br />
SD = 12.40; mittlerer Body-Mass-Index = 27.44, SD = 4.83). Drei Monate später<br />
nahmen 344 TeilnehmerInnen (73.3 %) teil. Die Daten wurden anhand von<br />
Strukturgleichungsmodellen mit latenten Differenzwerten analysiert.<br />
Ergebnisse: Für die Vorhersage der Veränderung der Intention, sich fettarm<br />
zu ernähren, ergab sich ein bedeutsamer positiver Zusammenhang mit der<br />
Veränderung der Selbstwirksamkeit, jedoch entgegen der theoretischen Annahmen<br />
nicht mit der Veränderung der Risikowahrnehmung oder der Handlungsergebniserwartungen.<br />
Die Veränderung der fettarmen Ernährung<br />
wiederum wurde durch die Veränderung der Intention, der Selbstwirksamkeit<br />
und vor allem der beiden volitionalen Konstrukte Ausführungsplanung und<br />
Handlungskontrolle vorhergesagt. Insgesamt konnten 34 % der Varianz der<br />
Veränderung der Ernährungsgewohnheiten aufgeklärt werden.<br />
Die Ergebnisse demonstrieren explizit, dass nicht nur das Ausgangsniveau<br />
von Selbstwirksamkeit, Intentionen und den volitionalen Variablen Ausführungsplanung<br />
und Handlungskontrolle, sondern insbesondere eine<br />
Steigerung dieser Konstrukte für eine erfolgreiche Verhaltensumstellung<br />
relevant ist.<br />
Keywords:<br />
Planung, Handlungskontrolle, Verhaltensänderung<br />
122
Die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Kindern<br />
und Jugendlichen mit einer Hypospadie<br />
Verena Schönbucher, Markus Landolt & Daniel Weber<br />
Universitäts-Kinderspital Zürich<br />
verena.schoenbucher@kispi.unizh.ch<br />
Bei der Hypospadie handelt es sich um eine Malformation des Penis, von der<br />
zirka jeder dreihundertste Knabe betroffen ist. Ziel einer Operation im Kindesalter<br />
ist es, frühzeitig ein möglichst normales Genital zu rekonstruieren, um auffällige<br />
Beeinträchtigungen auf die psycho-sexuelle Entwicklung und die Lebensqualität<br />
der betroffenen Knaben zu verringern. Im Bestreben die Operationsverfahren<br />
ständig zu verbessern, wurde aber die psychosoziale Entwicklung der<br />
Kinder und Jugendlichen bis heute kaum empirisch untersucht. Ziel der Studie<br />
ist die Untersuchung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Kindern<br />
und Jugendlichen mit einer operativ-korrigierten Hypospadie. Dabei wird der<br />
Frage nachgegangen, welche medizinischen (z. B. das Operationsalter) und<br />
welche psychosozialen Merkmale (z. B. der familiäre Hintergrund der Knaben)<br />
die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Knaben beeinflussen. Dazu<br />
wurden 77 Knaben (Alter: 7-17), die am Universitäts-Kinderspital Zürich (1991-<br />
2005) wegen einer Hypospadie operiert wurden, in einem standardisierten<br />
Interview befragt und medizinisch untersucht. Medizinische Charakteristiken<br />
wurden aus den Krankengeschichten erfasst. Die Eltern wurden schriftlich<br />
mittels Fragebogen befragt. Als Kontrollgruppe dienten 77 Knaben, die wegen<br />
einer Inguinalhernie operiert wurden. Folgende standardisierten Messinstrumente<br />
kamen <strong>zur</strong> Anwendung: TACQOL (Lebensqualität), FKSI (Körperbild),<br />
FRI (Qualität der Familienbeziehungen) and SCL-27 (Psychisches Befinden der<br />
Eltern). Die Ergebnisse deuten daraufhin, dass die gesundheitsbezogene<br />
Lebensqualität der Knaben mit Hypospadie im Vergleich <strong>zur</strong> Kontrollgruppe und<br />
im Vergleich zu einer Normstichprobe beeinträchtigt ist. Als wichtige Determinanten<br />
der gesundheitsbezogenen Lebensqualität haben sich das Alter,<br />
das Körperbild, die Qualität der familiären Beziehungen und das psychische<br />
Befinden der Mutter erwiesen. Ein Zusammenhang mit medizinischen<br />
Merkmalen hat sich nicht bestätigt.<br />
Keywords:<br />
Lebensqualität, Hypospadie, Kindes-/Jugendalter<br />
123
Burnout bei Rettungskräften – Welchen Einfluss haben<br />
personale und interpersonale Ressourcen?<br />
Nicola K. Schorn & Petra Buchwald<br />
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf<br />
Nicola.Karla.Schorn@uni-duesseldorf.de<br />
Personale Ressourcen, die Rettungskräfte <strong>zur</strong> Stressbewältigung benötigen<br />
und sie damit vor Burnout bewahren, stehen seit einiger Zeit im Mittelpunkt<br />
theoretischer und empirischer Forschung. Unklar blieb bislang, welchen Einfluss<br />
interpersonale Ressourcen auf Burnout haben. Die Theorie der<br />
Ressourcenerhaltung (Conservation of Resources Theory; Hobfoll, 1998) versteht<br />
die Entwicklung von Burnout als einen Prozess, bei dem durch<br />
permanente Arbeitsbelastung und deren ineffektiver Bewältigung bestehende<br />
Ressourcen schneller verbraucht als ersetzt werden (Buchwald & Hobfoll,<br />
2004).<br />
In einer Längsschnittstudie wurde untersucht, ob individuelle und gemeinsame<br />
Stressbewältigungsstrategien sowie kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen<br />
die Entstehung von Burnout beeinflussen.<br />
Rettungskräfte (N = 20) beantworteten die German Strategic Approach to<br />
Coping Scale (Schwarzer, Starke & Buchwald, 2003), das Maslach Burnout<br />
Inventory (Maslach & Jackson, 1984) und die Kollektive Selbstwirksamkeitsskala<br />
(Schwarzer & Jerusalem, 1999). Die Ergebnisse der Regressionsanalyse<br />
unterstützen die Annahme, dass nicht nur personale Ressourcen wie Vermeidung<br />
und Selbstbehauptung mit den drei Burnout-Dimensionen emotionale<br />
Erschöpfung, Depersonalisierung und reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit<br />
in Zusammenhang stehen, sondern interpersonale Ressourcen, wie die Suche<br />
nach sozialer Unterstützung und die kollektive Kompetenzerwartung, ebenfalls<br />
eine große Rolle spielen. Die Ergebnisse weisen neben der Bedeutung des<br />
ressourcenbasierten Burnout-Modells (Hobfoll & Shirom, 2000; Hobfoll & Buchwald,<br />
2004) auf die Wichtigkeit von Interventionsprogrammen hin, die die erfolgreiche<br />
Stressbewältigung von Rettungskräften zu verbessern helfen.<br />
Literatur:<br />
Buchwald, P. & Hobfoll, S. E. (2004). Burnout aus ressourcentheoretischer Perspektive.<br />
Psychologie in Erziehung und Unterricht, 51, 247-257.<br />
Hobfoll, S.E. (1998). Stress, culture, and community: The psychology and philosophy of stress.<br />
New York: Plenum.<br />
Keywords:<br />
Coping, Burnout, kollektive Selbstwirksamkeit<br />
124
Personale und soziale Ressourcen als Determinanten<br />
des Internetgebrauchs<br />
Annette Schröder & Ulrike Six<br />
Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, Fachbereich Psychologie<br />
schroede@uni-landau.de<br />
Im Zuge der gewachsenen gesellschaftlichen Bedeutung des Internets wird seit<br />
einigen Jahren auch über das Thema Internetsucht diskutiert. Die in der<br />
Literatur angegebenen Prävalenzraten streuen dabei je nach Untersuchungsmethode<br />
und gewählter Stichprobe in der Mehrzahl zwischen drei und 12 Prozent.<br />
Ergebnisse zu Risiko- und Schutzfaktoren liegen allerdings bisher erst<br />
sehr vereinzelt vor.<br />
In diesem Beitrag wird ein theoretisches Erklärungsmodell vorgestellt, das<br />
vor dem Hintergrund neuerer Ansätze und empirischer Ergebnisse aus der<br />
Medienforschung einerseits und der <strong>Gesundheitspsychologie</strong> andererseits<br />
Kriterien, Determinanten und Konsequenzen der Internetnutzung analysiert und<br />
klassifiziert. Forschungsleitend ist dabei die begründete Annahme eines<br />
Kontinuums individueller Ausprägungen und Qualitäten der Internetnutzung<br />
(von persönlich und sozial angemessener, funktionaler Nutzung bis zu dysfunktionaler<br />
pathologischer „Vielnutzung“), innerhalb dessen „Internetsucht“<br />
allenfalls eine Extremposition ausmacht. Dementsprechend werden <strong>zur</strong> Bestimmung<br />
der individuellen Position auf dem Kontinuum Kriteriumsvariablen<br />
eingesetzt, die – abgesehen von klassischen Suchtkriterien – vorrangig aus<br />
dem Konzept internetbezogener Medienkompetenz abgeleitet wurden. Als Determinanten<br />
werden neben internetbezogenen insbesondere internetunabhängige<br />
personale Ressourcen, Kompetenzen, Erfahrungen und Kognitionen<br />
untersucht.<br />
Aus dem Modell werden empirische Hypothesen abgeleitet und Ergebnisse<br />
zu Teilprüfungen des Modells dargestellt. Diskutiert werden damit zusammenhängende<br />
Implikationen für weitere Forschungsbemühungen sowie für<br />
Präventionsansätze.<br />
Keywords:<br />
personale Ressourcen, Internetgebrauch, theoretisches Modell<br />
125
Unterschiede zwischen Fibromyalgie- und anderen<br />
Schmerzpatienten und deren Bedeutung für die<br />
Schmerzbewältigung<br />
Annette Schröder, Alexandra Zaby & Jens Heider<br />
Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, Fachbereich Psychologie<br />
schroede@uni-landau.de<br />
Das Fibromyalgie-Syndrom stellt wegen seiner schlechten Beeinflussbarkeit<br />
immer noch eine Herausforderung für die Schmerztherapie dar. Außerdem<br />
werden bisher nur selten die in der Literatur berichteten psychischen Besonderheiten<br />
der Fibromyalgiepatienten bei den Trainingsprogrammen berücksichtigt,<br />
die sich in psychologisch relevanten Variablen wie z. B. Kontrollüberzeugungen,<br />
Stressverarbeitung, Depression und Hilflosigkeit von anderen chronischen<br />
Schmerzpatienten zu unterscheiden scheinen.<br />
Vor diesem Hintergrund wurde daher ein bereits empirisch gut bewährtes<br />
Schmerzbewältigungsprogramm (Basler & Kröner-Herwig, 1995) entsprechend<br />
der psychologischen Besonderheiten und Bedürfnisse von Fibromyalgiepatienten<br />
adaptiert und im Rahmen eines ambulanten Gruppentrainings eingesetzt.<br />
Fragestellung: 1. Wir gehen davon aus, dass sich nach Abschluss von<br />
zwölf, jeweils wöchentlich stattfindenden Sitzungen (a) Veränderungen sowohl<br />
in der Schmerzsymptomatik wie auch in der Schmerzverarbeitung finden<br />
lassen. Auf der Basis psychologischer Bewältigungstheorien vermuten wir zudem<br />
(b) eine verbesserte allgemeine und interpersonelle Belastungsverarbeitung.<br />
2. Unter differenziellen Gesichtspunkten werden vor Trainingsbeginn die<br />
Unterschiede zwischen Fibromyalgiepatienten und anderen chronischen<br />
Schmerzpatienten untersucht, um so (c) mögliche Prädiktoren für den Therapieverlauf<br />
zu identifizieren.<br />
Methode: Fragebogenuntersuchung, kombiniertes längs- und querschnittliches<br />
quasi-experimentelles Gruppendesign<br />
Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Bis dato liegen Daten von jeweils 38<br />
Patienten vor. Die Ergebnisse bestätigen nur tendenziell unsere Hypothesen. In<br />
der Diskussion der zum Kongresstermin größeren Stichprobe soll insbesondere<br />
auf die Charakteristika von Fibromyalgiepatienten und die damit einhergehenden<br />
Implikationen für die psychologische Praxis eingegangen werden.<br />
Keywords:<br />
Fibromyalgie, Schmerzbewältigung, Gruppentraining<br />
126
www.icd-forum.de – Ein internetbasiertes Programm für<br />
Patienten mit implantiertem Cardioverter Defibrillator<br />
Stefan M. Schulz 1 , Joachim Baumeister 1 , Alexander Crössmann 1 ,<br />
Georg W. Alpers 1 , Hans Neuser 2 , Frank Puppe 1 & Paul Pauli 1<br />
1 Universität Würzburg<br />
2 Herz- und Gefäß-Klinik Bad Neustadt/Saale<br />
schulz@psychologie.uni-wuerzburg.de<br />
Fragestellung: Für Patienten mit implantiertem Cardioverter Defibrillator (ICD)<br />
ist es oft schwierig, Kontakt zu geeigneten Ansprechpartnern und anderen Betroffenen<br />
in ihrer lokalen Umgebung herzustellen. Das Internet bietet dabei<br />
spezifische Vorteile gegenüber traditionellen gesundheitspsychologischen Angeboten.<br />
Beispiele sind standortunabhängige Verfügbarkeit, Anonymität und<br />
damit eine geringere Hemmschwelle für aktive Beteiligung und Selbstoffenbarung,<br />
effiziente Informationsvermittlung und leichte Dokumentierbarkeit der<br />
Interaktion. In einer Pilotstudie wurde daher Akzeptanz und Wirkung eines<br />
speziell für die Bedürfnisse von ICD-Patienten gestalteten 6-Wochen-<br />
Programms mit Schwerpunkt auf der Prophylaxe schockinduzierter Herzphobie<br />
untersucht.<br />
Methode: www.icd-forum.de integriert strukturierte Informationsvermittlung<br />
mit interaktiven Kontaktmöglichkeiten (Chat und Diskussionsforum), in denen<br />
thematisch moderierte Diskussionen und Kontakte zwischen Betroffenen im<br />
Sinne einer virtuellen Selbsthilfegruppe möglich sind. Soziodemografische<br />
Variablen, Einstellung gegenüber dem Internet, Einstellung gegenüber dem<br />
ICD, Herzangst (HAF) und Depressivität (HADS) wurden sechs Wochen vor<br />
Beginn, unmittelbar vor und nach der Intervention, sowie im 1-Monats Follow-<br />
Up gemessen. Verhaltensdaten wurden kontinuierlich protokolliert.<br />
Ergebnisse: Insgesamt wurde das Angebot von den Patienten positiv und<br />
nützlich bewertet. Die Moderation von Chat und Forum erwies sich als wichtiges<br />
Element der Prozessgestaltung. Dabei standen Nutzungsfrequenz und<br />
-intensität im Zusammenhang mit dem Ausmaß der Selbstoffenbarung und erlebtem<br />
Nutzen. Die geringe Internetverfügbarkeit in der betroffenen Altersgruppe<br />
der Patienten schränkt die Generalisierbarkeit dieser Ergebnisse<br />
allerdings ein. Das Projekt zeigt, wie das Internet erfolgreich für die dezentrale<br />
Versorgung spezifischer Bedürfnisse genutzt werden kann und ermutigt für<br />
weitere Studien in größerem Umfang.<br />
Keywords:<br />
Implantierbarer Cardioverter Defibrillator, Internetprogramm, Dezentrale Versorgung<br />
127
Weniger sind manchmal mehr: Identifikation und Überprüfung<br />
von gemeinsamen Übergängen in aktuellen<br />
Stadienmodellen<br />
Benjamin Schüz 1 , Falko F. Sniehotta 2 , Natalie Mallach 3 & Ralf<br />
Schwarzer 3<br />
1 Jacobs University Bremen<br />
2 University of Aberdeen<br />
3 Freie Universität Berlin<br />
schuez@zedat.fu-berlin.de<br />
Fragestellung: Die am weitesten verbreiteten Stadientheorien (z. B. TTM, MAP,<br />
PAPM, HAPA) nehmen unterschiedlich viele Stadien an, grundlegende Annahmen<br />
lassen sich aber integrieren. Evidenz aus Untersuchungen <strong>zur</strong><br />
Effektivität von Planung, zu phasenspezifischer Selbstwirksamkeit sowie die<br />
Identifikation einer Intentions-Verhaltens-Lücke sprechen dafür, statt vieler fein<br />
differenzierter drei grundlegend qualitativ unterschiedliche Stadien zu unterscheiden<br />
(Weinstein, Rothman & Sutton, 1998): Ein präintentionales Stadium<br />
(noch keine Intention zu handeln), ein intentionales (Intention, aber noch keine<br />
Handlung) und ein aktionales Stadium (bereits handelnd). Qualitative Unterschiede<br />
zwischen Stadien lassen sich über stadienspezifische Prädiktoren von<br />
Stadienübergängen nachweisen (Weinstein, Rothman & Sutton, 1998).<br />
Methode: Längsschnittliche Studie <strong>zur</strong> Zahnhygiene mit zwei Messzeitpunkten<br />
im Abstand von vier Wochen. Übergänge zwischen den drei Stadien<br />
wurden mit Diskriminanzanalysen durch die evidenzbasierten Faktoren Risikowahrnehmung,<br />
Handlungs-Ergebnis-Erwartungen, Selbstwirksamkeit, Ausführungsplanung<br />
und Bewältigungsplanung vorhergesagt.<br />
Ergebnisse: Ausführungsplanung sagt Progression aus dem präintentionalen<br />
(Wilks λ = .93), Bewältigungsplanung und Selbstwirksamkeit<br />
Progression sowie Regression aus dem intentionalen (Wilks λ = .61), und<br />
Selbstwirksamkeit Regression aus dem aktionalen Stadium vorher (Wilks λ =<br />
.94).<br />
Schlussfolgerungen: Die Identifikation von stadienspezifischen Prädiktoren<br />
von Stadienwechseln spricht für qualitative Unterschiede zwischen einem präintentionalem,<br />
einem intentionalen und einem aktionalen Stadium. Die Ergebnisse<br />
und das Vorgehen bei dieser Studie implizieren, Gemeinsamkeiten von<br />
Theorien zu identifizieren und bei Untersuchungen zu berücksichtigen.<br />
Literatur:<br />
Weinstein, N. D., Rothman, A. J., & Sutton, S. R. (1998). Stage theories of health behavior:<br />
Conceptual and methodological issues. Health Psychology, 17, 290-299.<br />
Keywords:<br />
Stadientheorien, Evidenzbasierung, theoretische Integration<br />
128
Selbstwirksamkeit, Support und Coping:<br />
Theorie und Evidenz<br />
Ralf Schwarzer<br />
Freie Universität Berlin<br />
health@zedat.fu-berlin.de<br />
Die Beziehungen zwischen Selbstwirksamkeit, sozialer Unterstützung und<br />
Stressbewältigung werden anhand von mehreren empirischen Längsschnittstudien<br />
untersucht. Nach der Ermächtigungshypothese wird angenommen,<br />
dass Unterstützung die Selbstwirksamkeit stärkt und somit die Stressbewältigung<br />
ermöglicht. Nach der Kultivierungshypothese wird angenommen,<br />
dass Selbstwirksamkeit den Aufbau und Erhalt eines sozialen Netzes begünstigt.<br />
Mediatormodelle spiegeln diese beiden gegensätzlichen Annahmen<br />
wider. Für beide Kausalrichtungen gibt es empirische Evidenz. Im Weiteren wird<br />
untersucht, inwieweit die aktive Mobilisierung von sozialer Unterstützung eine<br />
Bedingung für erlebte Unterstützung und für Stressbewältigung darstellt. Überlegungen<br />
zum Ressourcentransfer und dyadischen Coping werden angestellt.<br />
Literatur:<br />
Luszczynska, A., Boehmer, S., Schulz, U., Knoll, N. & Schwarzer, R. (in press). Emotional support<br />
for men and women with cancer: Do patients receive what their partners provide? International<br />
Journal of Behavioral Medicine.<br />
Schwarzer, R. & Knoll, N. (in press). Social networks and social support as facilitating factors in<br />
the recovery from illness. International Journal of Psychology.<br />
Keywords:<br />
Selbstwirksamkeit, Support, Coping<br />
129
Evaluation eines Netzwerkes <strong>zur</strong> Gesundheitsförderung<br />
im Elementarbereich – Auswirkungen von Gesundheitsförderungsprogrammen<br />
auf das Elternhaus<br />
Christine Schwarzer, Norbert Posse, Britta Kroll<br />
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf , Abteilung für Weiterbildung und Beratung,<br />
Erziehungswissenschaftliches Institut<br />
schwarzer@phil-fak.uni-duesseldorf.de<br />
Gesundheit wird von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und<br />
gelebt, dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben (Ottawa Charta, 1986).<br />
Gesundheitsförderung gehört heute zu den Kernaufgaben im Elementarbereich.<br />
In Kindertagesstätten findet ein wichtiger Teil frühkindlicher<br />
Sozialisation und Bildung statt und sie sind für die Gesundheitsförderung<br />
zentrale Settings. Ebenso ist die Familie als Hauptbezugspunkt für die Kinder<br />
ein wichtiger Ort für Gesundheitsförderung, denn gerade in dieser Lebensphase<br />
können Eltern auf die gesundheitliche Entwicklung ihrer Kinder einen weitreichenden<br />
Einfluss nehmen, der positive Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter<br />
hat.<br />
Das Netzwerk OPUS NRW- Bildung und Gesundheit basiert auf dem<br />
salutogenetischen Modell von Aaron Antonovsky und unterstützt die beteiligten<br />
Schulen und Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen den gesundheitsfördernden<br />
Settingansatz für ihren Standort systematisch weiter zu entwickeln.<br />
Eine zentrale Fragestellung der Evaluation ist die nach der Wirksamkeit<br />
des Ansatzes. Hierzu wurden Leitungen, Erzieherinnen und Eltern befragt.<br />
Durchgeführt wurde die Evaluation an 37 OPUS-Einrichtungen im Rhein-Kreis<br />
Neuss und als Kontrollgruppe an 22 nicht an dem Netzwerk teilhabenden KiTas<br />
der Caritas des Bistums Aachen.<br />
Neben einer Anzahl interessanter Befunde, ergaben sich zwischen den<br />
beiden Gruppen empirisch relevante Unterschiede bei den Eltern. Gesundheitsförderung<br />
an Kindertagesstätten wirkt sich demnach nicht allein auf die direkt<br />
beteiligten Personen wie Kinder und Erzieher/Innen positiv aus, sondern hat<br />
Auswirkungen auf das Gesundheitsverhalten der Eltern. Eltern der Kinder an<br />
Einrichtungen mit Gesundheitsförderungsprogramm geben an, dass ihr<br />
Interesse an Themen der Gesundheitsförderung gewachsen und das eigene<br />
Gesundheitsverhalten durch die KiTa-Arbeit beeinflusst wurde.<br />
Relevante Befunde in diesem Bereich und entsprechende Empfehlungen<br />
werden auf der Tagung dargestellt.<br />
130
Teilnahme- und Ablehnungsgründe für ein Elterntraining<br />
in sozial benachteiligten Nachbarschaften<br />
Wiebke Lina Seefeldt, Nina Heinrichs & Frank Eggert<br />
TU Braunschweig<br />
w.seefeldt@tu-bs.de<br />
Fragestellung: Elterntrainings bieten sich sowohl <strong>zur</strong> Verminderung bereits<br />
existierender psychischer Auffälligkeiten bei Kindern als auch <strong>zur</strong> Vorbeugung<br />
der Entstehung solcher Probleme an. Voraussetzung für die Wirksamkeit von<br />
Elterntrainings ist allerdings die Teilnahme der Familien. Über entscheidungsrelevante<br />
Gründe für oder gegen eine Teilnahme an einem Elterntraining ist<br />
bisher wenig bekannt. Es sollen daher Faktoren identifiziert werden, die mit<br />
einer Teilnahmeentscheidung positiv oder negativ zusammenhängen.<br />
Methode: Im Rahmen des Projektes „Zukunft Familie II“ konnten insgesamt<br />
N = 311 Familien zu teilnahme- respektive ablehnungsrelevanten<br />
Gründen befragt werden.<br />
Ergebnisse: Die erfassten Gründe konnten den Faktoren Offenheit für das<br />
Interventionsprojekt, logistisches Management und wahrgenommene Anfälligkeit<br />
für kindliche Verhaltensauffälligkeiten zugeordnet werden. Eltern, die sich<br />
für eine Teilnahme entscheiden, drücken das Bedürfnis nach Erziehungsreflexion<br />
aus. Eltern, die sich gegen eine Teilnahme entscheiden, nennen vor<br />
allem logistische Gründe als Barrieren und nehmen kaum Anfälligkeit bei sich<br />
bzw. ihren Kindern wahr. Die Offenheit gegenüber Präventivinterventionen<br />
sollte erhöht werden, um die Teilnahmerate zu erhöhen. Die Erhöhung der<br />
Wahrnehmung von Anfälligkeit bei Familien könnte zu einer Reduktion der Ablehnungsrate<br />
führen.<br />
Keywords: Verhaltensstörung, Teilnahmebereitschaft, Elterntrainings<br />
131
Psychische Belastung bei Studierenden des Zweiten<br />
Bildungswegs<br />
Simone Seemann, Sonja Weigand & Martin Hautzinger<br />
Universität Tübingen, Psychologisches Institut<br />
seemann@uni-tuebingen.de<br />
Fragestellung: Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass sich unter den Absolventen<br />
des Zweiten Bildungsweges überproportional häufig Personen finden,<br />
die durch große psychosoziale Belastungen gekennzeichnet sind. Die bisherigen<br />
Aussagen hierzu beruhen jedoch zum Großteil auf soziologischen<br />
Studien der sechziger und siebziger Jahre oder auf Beobachtungen von<br />
Lehrern oder Psychologen an Studierendenberatungsstellen. Aktuelle<br />
empirische Daten <strong>zur</strong> psychischen Belastung bei Studierenden des Zweiten<br />
Bildungsweges existieren dagegen bisher nicht. Daher soll untersucht werden,<br />
wie groß die psychische Belastung bei Studierenden des Zweiten Bildungsweges<br />
tatsächlich ist. Ob sich im Vergleich <strong>zur</strong> Normstichprobe qualitative oder<br />
quantitative Unterschiede zeigen. Ob es biografische und/oder psychologische<br />
Merkmale gibt, durch die sich die Gruppe der psychisch auffällig belasteten<br />
Studierenden von den Unbelasteten unterscheidet?<br />
Methode: Die Fragestellung wurde an einer Stichprobe von 433<br />
Schülerinnen und Schülern untersucht, die zum Zeitpunkt der Erhebung eine<br />
Einrichtung des Zweiten Bildungsweges im Großraum Stuttgart besuchten. Die<br />
psychische Belastung wurde mit der deutschen Version des Brief Symptom<br />
Inventory (BSI, Franke, 2000) erhoben. Darüber hinaus kamen weitere psychologische<br />
Testverfahren sowie ein biografischer Fragebogen zum Einsatz.<br />
Ergebnisse: Ca. 15 % der Befragten sind laut Definition von Derogatis als<br />
psychisch auffällig einzustufen. Sie unterscheiden sich von psychisch weniger<br />
belasteten Schülern deutlich hinsichtlich ihrer Prüfungsangst, wichtiger Persönlichkeitsmerkmale<br />
sowie der wahrgenommenen sozialen Unterstützung. Beim<br />
Vergleich mit der studentischen Normstichprobe weisen Studierende des<br />
Zweiten Bildungsweges im Mittel jedoch keine signifikant höhere psychische<br />
Belastung auf.<br />
Keywords:<br />
Psychische Belastung, Zweiter Bildungsweg<br />
132
Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung<br />
in der Grundschule mit dem Programm Klasse2000<br />
Christina Storck, Thomas Duprée & Marina Angladagis<br />
Verein Programm Klasse2000 e.V., Nürnberg<br />
christina.storck@klasse2000.de<br />
Klasse2000 ist ein evidenzbasiertes Programm <strong>zur</strong> Prävention und Gesundheitsförderung<br />
in der Grundschule. Im Schuljahr 2005/06 nahmen über 219.000<br />
Kinder am Programm teil. Ziel von Klasse2000 ist es, Kinder in ihren<br />
Gesundheits- und Lebenskompetenzen zu stärken. Hierzu gehören Lebenskompetenzen<br />
wie Empathie, kritisches Denken, Kommunikations- und Konfliktlösefähigkeiten<br />
sowie Stressbewältigung und Entspannung. Diese Fähigkeiten<br />
sind Grundlagen für eine gesunde psychische und soziale Entwicklung und<br />
gleichzeitig Schutzfaktoren gegen Substanzmissbrauch und Suchtentwicklung.<br />
Die Grundschule bietet ein geeignetes Setting, um die Kinder in ihrer Lebenswelt<br />
unabhängig von ihrer sozio-kulturellen Herkunft zu erreichen. Während die<br />
meisten anderen Programme über Lehrerfortbildungen verbreitet werden, setzt<br />
Klasse2000 auf den Einsatz externer Experten, den Klasse2000-Gesundheitsförderern.<br />
Diese verfügen über eine medizinische, pädagogische oder<br />
psychologische Qualifikation und werden für ihren Einsatz bei Klasse2000<br />
speziell geschult. Je nach Jahrgangsstufe führen sie 2-3 Unterrichtseinheiten in<br />
der Klasse durch. Diese Stunden setzen Impulse und motivieren Schüler und<br />
Lehrer an den gesundheitsbezogenen Themen weiter zu arbeiten.<br />
Die Finanzierung durch Patenschaften sowie die kontinuierliche Zusammenarbeit<br />
von Lehrern und Gesundheitsförderern fördern die langfristige<br />
konzepttreue Umsetzung in der Praxis (Storck et al., 2007). Unterstützt durch<br />
die Gmünder Ersatzkasse und die Lions Clubs in Baden-Württemberg wird in<br />
den Schuljahren 2007/08 und 2008/09 in insgesamt 1.000 Grundschulklassen<br />
das Programm Klasse2000 eingeführt. Das Projekt wird begleitend vom Verein<br />
Programm Klasse2000 e.V. evaluiert. Die Studie untersucht die Auswirkungen<br />
des Programms Klasse2000 auf der Wirkungs- und der Prozessebene.<br />
Keywords:<br />
Gesundheitsförderung, Suchtvorbeugung, Grundschule<br />
133
Klasse2000 an deutschen Schulen:<br />
Erreicht schulische Gesundheitsförderung Kinder<br />
aus sozial benachteiligten Gruppen?<br />
Christina Storck 1 , Thomas Duprée 1 , Marina Angladagis 1 & Pál L.<br />
Bölcskei 2<br />
1 Verein Programm Klasse2000 e.V., Nürnberg<br />
2 IRT Institut für Rauchberatung & Tabakentwöhnung, München<br />
christina.storck@klasse2000.de<br />
Soziale Schichtzugehörigkeit ist ein zentraler Erklärungsfaktor für den Gesundheitszustand<br />
von Kindern und Jugendlichen. Niedriger Sozialstatus und<br />
Migrationshintergrund sind Risikofaktoren für Übergewicht, Essstörungen,<br />
motorische Defizite und psychische Probleme (Kurth, 2006). Ergebnisse <strong>zur</strong><br />
sozialen Ungleichheit von Gesundheitschancen zeigen, dass insbesondere diejenigen<br />
von einem hohen Krankheitsrisiko betroffen sind, die über geringe<br />
psychosoziale Ressourcen verfügen und ein riskantes Gesundheitsverhalten<br />
praktizieren. Deshalb ist es notwendig, Kinder aus Familien mit geringem<br />
Sozialstatus oder Migrationshintergrund möglichst frühzeitig in ihrem Gesundheitsbewusstsein<br />
und ihren persönlichen und sozialen Kompetenzen zu<br />
stärken. Hierfür eignen sich Maßnahmen der Verhaltensprävention, die<br />
individuelle Verhaltensweisen und alltägliche Aspekte der Lebensführung<br />
ebenso beeinflussen wie psychosoziale Kompetenzen.<br />
Im Zentrum von Präventionsbemühungen sollten soziale Gruppen stehen,<br />
die gesundheitsfördernde Maßnahmen am stärksten benötigen. Erfahrungsgemäß<br />
sind diese jedoch in der Praxis schwer zu erreichen. Vor dem<br />
Hintergrund dieses „Präventionsparadoxons“ (Hurrelmann, 2003) wird am Beispiel<br />
des schulischen Präventionsprogramms „Klasse2000“ untersucht, in<br />
welchem Umfang Grundschulen aus sozialen Brennpunkten erreicht werden<br />
und wie sich dort Akzeptanz und Praktikabilität des Programms darstellen.<br />
Datengrundlage bildet eine bundesweite Befragung teilnehmender Lehrkräfte<br />
(N = 3756). 23,8 % der Lehrkräfte geben an, dass ihre Schule zu einem<br />
„sozialen Brennpunkt“ gehört. Die Ergebnisse belegen eine hohe Akzeptanz<br />
und Praktikabilität für die spezifische Zielgruppe. Lehrkräfte aus Brennpunkt-<br />
Schulen beurteilen das Unterrichtskonzept positiver als ihre Kollegen. Unterschiede<br />
hinsichtlich Intensität und Konzepttreue der Programmumsetzung bestehen<br />
nicht. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf spezifische Bedürfnisse<br />
und Präventionsstrategien für sozial Benachteiligte diskutiert.<br />
Keywords:<br />
Suchtvorbeugung, Gesundheitsförderung, Grundschule<br />
134
Bestandsaufnahme verfügbarer Patientenschulungsprogramme<br />
und Entwicklungsbedarf für die Anwendung<br />
in der medizinischen Rehabilitation<br />
Veronika Ströbl, Roland Küffner, Almut Friedl-Huber, Andrea<br />
Reusch, Heiner Vogel & Hermann Faller<br />
Universität Würzburg, Institut für Psychotherapie und Medizinische Psychologie<br />
stroebl@uni-wuerzburg.de<br />
Patientenschulungen werden überwiegend in der Versorgung von Patienten mit<br />
chronischen Erkrankungen eingesetzt, insbesondere im Rahmen der medizinischen<br />
Rehabilitation. Diese indikationsspezifischen Gruppenprogramme<br />
zielen auf eine Verbesserung von Compliance, Selbstmanagement und<br />
Empowerment. Im Rahmen des Projekts „Zentrum Patientenschulung“ wurde<br />
neben einer Bestandsaufnahme verfügbarer Schulungskonzepte eine Klinikbefragung<br />
<strong>zur</strong> Praxis der Patientenschulung in der medizinischen Rehabilitation<br />
durchgeführt. Im Hinblick auf die Qualität von Schulungen konnten in einer<br />
Expertenbefragung Mindeststandards (z. B. Manualisierung, interaktive<br />
Methodik) festgelegt werden. Ziel des Projekts ist es, die Dissemination<br />
strukturierter Programme zu fördern. Hierzu werden die ermittelten Schulungen<br />
in einer internetbasierten Datenbank für die Fachöffentlichkeit beschrieben<br />
(www.zentrum-patientenschulung.de).<br />
In diesem Beitrag wird dargestellt, welche indikationsspezifischen<br />
Schulungsprogramme für verschiedene Indikationsbereiche (u. a. Herz-<br />
Kreislauferkrankungen, Diabetes) verfügbar sind, und ob diese grundlegende<br />
Anforderungen an Patientenschulungen erfüllen. Zudem soll exemplarisch für<br />
Herz-Kreislauferkrankungen der Entwicklungsbedarf für Schulungen in Bezug<br />
auf die Anwendung in der medizinischen Rehabilitation abgeleitet werden.<br />
Die Schulungsprogramme wurden über Literatur-/Internetrecherchen und<br />
Klinikbefragungen identifiziert. Ausgewählt wurden publizierte, d. h. allgemein<br />
zugängliche Programme. Entwicklungsbedarf wurde anhand der Mindeststandards<br />
sowie der Erfordernisse der Behandlung im Rahmen der<br />
medizinischen Rehabilitation abgeleitet.<br />
Bis Redaktionsschluss wurden 83 Programme ermittelt. Für alle Indikationsbereiche<br />
zeigt sich weiterer Bedarf an Evaluationsstudien. 11<br />
Programme liegen <strong>zur</strong> Schulung bei Herz-Kreislauferkrankungen vor. Neben<br />
Evaluation scheint hier die Entwicklung und Publikation von Programmen zu<br />
einzelnen Erkrankungen (z. B. Herzinsuffizienz) angezeigt.<br />
Keywords:<br />
Patientenschulung, Gesundheitstraining, Entwicklungsbedarf<br />
135
„Kompetenter Begleiten:<br />
Sterbende und deren Angehörige“ – Interventionsprogramm<br />
zu Sterben und Tod<br />
Kristin Tölg 1 , Christina Schröder 2 & Harry Schröder 1<br />
1 Universität Leipzig/Institut für Psychologie II<br />
2 Universität Leipzig/Selbstständige Abteilung für Medizinische Psychologie und<br />
Medizinische Soziologie der Medizinischen Fakultät Leipzig<br />
toelg@uni-leipzig.de<br />
Durch die Stärkung des Faches Medizinische Psychologie im vorklinischen<br />
Unterricht im Rahmen der neuen Approbationsordnung konnte ein wahlobligatorischer<br />
Kurs <strong>zur</strong> Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen in<br />
das medizinische Curriculum an der Medizinischen Fakultät Leipzig implementiert<br />
werden. Es liegen zudem Programmvarianten für Psychologie- und<br />
Theologiestudenten vor. Dadurch wird der Forderung nach einer vertieften Auseinandersetzung<br />
mit Sterben und Tod entsprochen und erstmals ein auf<br />
emotionalen, kognitiven sowie behavioralen Lernzielen ausgerichteter Death-<br />
Education-Kurs für Studenten angeboten. Der Kurs ermöglicht den verschiedenen<br />
studentischen Zielgruppen vor ihrem Berufseinstieg einen<br />
reflektierteren Umgang mit der Thematik Sterben und Tod und bereitet sie angemessen<br />
auf die Aufgabe, Sterbende und ihre Angehörigen zu begleiten, vor.<br />
Das dient der eigenen Gesundheitsförderung und trägt <strong>zur</strong> Verbesserung der<br />
Betreuungsqualität von Patienten und Angehörigen bei. In vier Veranstaltungen,<br />
die jeweils sechs Stunden umfassen, wird basierend auf der Auseinandersetzung<br />
mit eigenen Einstellungen zu Sterben und Tod (Selbsterfahrung) ein<br />
patientenzentrierter, situations- und rollenangemessener Kommunikationsstil<br />
(Kompetenzförderung) erarbeitet. Die Methode der Themenzentrierten Interaktion<br />
wird genutzt, wodurch kognitive Lernziele v. a. in thematischen Diskussionen<br />
und Vorträgen umgesetzt werden, emotionale und behaviorale Lernziele<br />
v. a. in imaginativen Übungen, Rollenspielen und mit anderen kreativen<br />
Mitteln. Die parallele Prozess- und Effektevaluation beinhaltete Einstellungen zu<br />
Sterben und Tod, Fertigkeiten in der Gesprächsführung und der Stressbewältigung<br />
sowie die Akzeptanz des Kurses. Die Ergebnisse zeigen, dass der<br />
sehr gut akzeptierte Kurs zu einer Verringerung der Angst bzw. zu einem Anstieg<br />
der Akzeptanz bzgl. Sterben und Tod führt und einen empathischen Gesprächsstil<br />
fördert.<br />
Keywords:<br />
death education, Selbsterfahrung, Kompetenzförderung<br />
136
Selbst- und Fremdberichte kindlichen Problemverhaltens<br />
als Prädiktoren riskanten Gesundheitsverhaltens<br />
im Jugendalter<br />
Marc Vierhaus & Arnold Lohaus<br />
Universität Bielefeld<br />
marc.vierhaus@uni-bielefeld.de<br />
Fragestellung: Die Studie untersucht, inwieweit riskantes Gesundheitsverhalten<br />
in der Adoleszenz durch Selbst- und Fremdberichte kindlichen Problemverhaltens<br />
zwei bzw. vier Jahre zuvor vorhergesagt werden kann. Methode: 366<br />
Viertklässler nahmen an dieser längsschnittlichen Studie teil. In der vierten und<br />
sechsten Klasse wurden die SchülerInnen und ihre Eltern bezüglich internalisierenden<br />
und externalisierenden Problemverhaltens (Youth Self Report<br />
bzw. Child Behavior Checklist) befragt. In der achten Klasse machten die<br />
Kinder darüber hinaus Angaben zum Nikotinkonsum, Sexualverhalten, Diätverhalten<br />
und zu suizidalen Tendenzen.<br />
Ergebnisse: Die Korrelationen zwischen den Eltern- und Kindangaben<br />
waren gering bis mittelmäßig hoch und stiegen über die Klassenstufen leicht an.<br />
Kinder berichteten mehr Problemverhalten als ihre Eltern. Riskantes Gesundheitsverhalten<br />
konnte insbesondere in der Gruppe der Jungen teilweise durch<br />
die Angaben in der vierten Klasse vorhergesagt werden. Obwohl die so ermittelten<br />
Zusammenhänge stabil blieben, verbesserten sich die Effektstärken<br />
aber deutlich durch die Vorhersage anhand des berichteten Problemverhaltens<br />
in Klasse 6. Selbst- und Fremdberichte erwiesen sich dabei als relativ gleichwertige<br />
und verhaltensspezifische Prädiktoren.<br />
Keywords:<br />
Problemverhalten, Adoleszenz, Selbst- und Fremdberichte<br />
137
Theoriegeleitete Untersuchung des Zusammenspiels<br />
sozial-kognitiver Variablen und Stadien der Gesundheitsverhaltensänderung<br />
Lisa M. Warner, Sonia Lippke, Amelie U. Wiedemann, Tabea Reuter<br />
& Jochen P. Ziegelmann<br />
Freie Universität Berlin<br />
lwarner@gmx.de<br />
Fragestellung: Der Weg zu gesünderem Verhalten ist ein komplexer Prozess.<br />
Der Health Action Process Approach (HAPA) bildet diesen Prozess und die<br />
Stadien, die während dessen durchlaufen werden, ab. Ziel dieser Arbeit war es,<br />
das Zusammenspiel der Variablen des HAPA-Modells zu untersuchen.<br />
Weiterhin sollten qualitativ unterschiedliche „Mindsets“ (Diskontinuitätsmuster)<br />
in den drei Stadien (Non-Intender, Intender, Actor) gefunden werden.<br />
Methoden: N = 103 Mitarbeiter der DB AG wurden bezüglich der HAPA<br />
Variablen (Risikowahrnehmung, Handlungsergebniserwartung, Selbstwirksamkeit,<br />
Intentionen, Planung) und verschiedener Aspekte körperlicher Aktivität<br />
(Gesamtdauer mittlerer und intensiver körperlicher Aktivität pro Woche, Häufigkeit<br />
körperlicher Aktivität in der Freizeit, bei der Arbeit, zu Fortbewegungszwecken<br />
und in Haushalt und Garten) befragt.<br />
Ergebnisse: Theoriekonform zeigte sich, dass Handlungsergebniserwartungen<br />
(β = .35) und Selbstwirksamkeit (β = .39) Intentionen beeinflussen.<br />
Risikowahrnehmung war kein Prädiktor für Intentionen. Planung mediierte die<br />
Umsetzung von Zielen in körperliche Aktivität: Bei Einfügung der Planung in die<br />
Beziehung zwischen Intentionen und Verhalten sank sie von β = .36 auf β = .21<br />
(Sobel´s z = 3.87). Die Annahme unterschiedlicher Mindsets in den drei Stadien<br />
konnte für alle sozial-kognitiven Variablen und die verschiedenen Verhaltensmaße<br />
bestätigt werden.<br />
Diskussion: Eine Unterteilung des Prozesses der Verhaltensänderung in<br />
drei Stadien ist sinnvoll, da sich Menschen in den verschiedenen Stadien durch<br />
qualitativ unterschiedliche Mindsets auszeichnen. Künftige Interventionen<br />
sollten daher auf die spezifischen Bedürfnisse in jedem Stadium eingehen, um<br />
Verhaltensänderungen wahrscheinlicher zu machen.<br />
Keywords:<br />
Körperliche Aktivität, Stadienmodelle, HAPA<br />
138
Volitionale Intervention in der Rehabilitation von Gefäßpatienten<br />
Manfred Wegner & Florian Pochstein<br />
Universität Kassel/ Institut für Sport und Sportwissenschaft<br />
m.wegner@uni-kassel.de<br />
Fragestellung: Trotz vorhandener Intention, körperlich aktiv zu werden,<br />
scheitern Rehabilitationspatienten oft an der Umsetzung dieser Intention in tatsächliches<br />
Verhalten. Metaanalysen <strong>zur</strong> Vorsatzbildung (Gollwitzer & Sheeran,<br />
2006) zeigen, dass gezielte Interventionen die Rehabilitation unterstützen<br />
können. Ziel der Studie ist die Effektivitätsprüfung von wenn-dann-Vorsätzen<br />
und der Einsatz von Handlungskontrollprozessen im Verlauf einer Rehabilitationsmaßnahme.<br />
Methode: Teilnehmer dieser experimentellen Kontrollgruppenstudie sind<br />
84 Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit. Alle verfügen über<br />
eine hohe Intention, eine medizinisch indizierte und verordnete Bewegungstherapie<br />
durchzuführen. Die abhängigen Variablen (volitive Planung und körperliche<br />
Aktivität) werden zu Beginn und in Abständen von drei und sechs Monaten<br />
erhoben. Die Kontrollgruppe durchläuft ein Standardbehandlungsprogramm,<br />
während die Experimentalgruppe in der Bildung von Ausführungs- und Bewältigungsplänen<br />
durch die psychologische Intervention unterstützt wird. Die<br />
Stärkung der Handlungskontrolle erfolgt über eine Kontaktaufnahme per Telefon<br />
über sechs Wochen, in der an Pläne erinnert und Möglichkeiten <strong>zur</strong> Plananpassung<br />
gegeben werden.<br />
Ergebnisse: Die varianzanalytische Auswertung zeigt, dass die Experimentalgruppe<br />
zu t2 und t3 sowohl höhere Werte in den Planungs- und<br />
Kontrollvariablen (p < .05, Eta² von 0.22 bis 0.39), im Verlauf von t2 zu t3<br />
(p < .05, Eta² von 0.75 bis 0.79) als auch zu t3 höhere Werte in der körperlichen<br />
Aktivität aufweist (p < .05, Eta² von 0.34).<br />
Diskussion: Die Anregung von Handlungskontrollprozessen und die<br />
Bildung von Plänen sollten in die Therapiefolge implementiert werden. Modelle<br />
der study nurse und weitere volitive Maßnahmen werden diskutiert.<br />
Literatur:<br />
Gollwitzer, P.M. & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A<br />
meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Psychology, 38, 69-<br />
119.<br />
Keywords:<br />
Volition, Vorsatzbildung, pAVK<br />
139
Intentionen moderieren Mediationseffekte: Zusammenhänge<br />
zwischen Intentionen, Planungsprozessen und<br />
zwei Gesundheitsverhaltensweisen<br />
Amelie U. Wiedemann 1 , Benjamin Schüz 1 , Ralf Schwarzer 1 , Falko F.<br />
Sniehotta 2 & Urte Scholz 3<br />
1 Freie Universität Berlin<br />
2 University of Aberdeen<br />
3 Universität Zürich<br />
wiedeman@zedat.fu-berlin.de<br />
Fragestellung: Planungsprozesse setzen gesundheitsbezogene Intentionen in<br />
Verhalten um, indem sie die Effekte von Intentionen auf Verhalten mediieren.<br />
Theorie und empirische Evidenz belegen, dass Planung einen postintentionalen<br />
Prozess darstellt: Planungsprozesse sagen Verhalten besser vorher,<br />
wenn die entsprechenden Intentionen stark ausgeprägt sind. Dieser Beitrag<br />
integriert beide Zusammenhänge und untersucht, ob der Mediationseffekt von<br />
Planungsprozessen von der zugrunde liegenden Intentionsstärke abhängt. Es<br />
wird daher angenommen, dass Planung besonders dann zwischen Intentionen<br />
und Verhalten vermittelt, wenn Personen über hohe Intentionen verfügen<br />
(moderierte Mediation).<br />
Methode: In zwei Längsschnittstudien zu körperlicher Aktivität (N = 167)<br />
und Dentalhygiene (N = 209) wurden Intentionen, Planungsprozesse und<br />
Gesundheitsverhalten <strong>zur</strong> Baseline und nach drei bzw. vier Monaten erfasst.<br />
Die Annahmen <strong>zur</strong> Mediation und moderierten Mediation wurden in einem<br />
regressionsanalytischen Ansatz durch non-parametrisches Bootstrapping überprüft.<br />
Ergebnisse: Beide Studien weisen darauf hin, dass Planungsprozesse die<br />
Beziehung zwischen Intentionen und Verhalten mediieren. Darüber hinaus<br />
zeigte sich, dass Intentionen diesen Effekt moderieren: Die Stärke des<br />
Mediationseffekts nimmt mit steigenden Intentionen zu.<br />
Die Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass Planung förderlich für die<br />
Umsetzung von Intentionen in Verhalten ist. Dieser vermittelnde (mediierende)<br />
Effekt von Planung tritt jedoch nur dann auf, wenn die zugrunde liegenden<br />
Intentionen hinreichend ausgeprägt sind.<br />
Keywords:<br />
Planung, Intention, Moderierte Mediation<br />
140
Salutogenesis and aging: The sense of coherence<br />
as a mediator of the relationship between resistance<br />
resource and subjective health<br />
Ulrich Wiesmann, Gabriele Niehörster & Hans-Joachim Hannich<br />
Universität Greifswald, Institut für Medizinische Psychologie<br />
wiesmann@uni-greifswald.de<br />
Research question: The salutogenic model focuses on people’s resources and<br />
capacities to create and preserve health, which can be regarded as a crucial<br />
developmental task in old age. Its core concept is the sense of coherence<br />
(SOC) – a global orientation of the world as consistent, meaningful and manageable<br />
– which determines an individual’s health level. Over the life-span, the<br />
SOC is shaped by generalized resistance resources (GRRs) – culturally bound<br />
internal and external forces which create reliable life experiences. Main objectives<br />
are to test a) the presumed GRRs-SOC-relationship and b) the status of<br />
the SOC as a mediator variable in an age-heterogenous sample of elderly persons.<br />
Method. 387 seniors (26.6 % men) volunteered. We recruited most participants<br />
from community senior organizations, a minority lived in a nursing home<br />
(22.2 %). Mean age was M = 73.8 years (SD = 7.58). During a period of four<br />
weeks, data were collected by using a questionnaire which assessed psychological<br />
health, physical health and symptom reporting, the SOC, and a spectrum<br />
of 19 bio-psycho-social resistance resources.<br />
Results: Overall, GRRs, SOC and health measures co-varied significantly.<br />
A multiple regression analysis revealed that the SOC is substantially strengthened<br />
by psychological factors: an optimistic life orientation, high self-esteem,<br />
low depressive mood, high self-efficacy, and high expected social support.<br />
Stepwise hierarchical regression analyses and subsequent Sobel tests revealed<br />
that the SOC mediated resistance resource effects on psychological health and<br />
symptom reporting, but not on physical health.<br />
Conclusion: The data pattern confirms basic assumptions of the salutogenic<br />
model for successful psychological aging, but not for biological aging, as<br />
perceived by elderly persons. With respect to gerontological practice and intervention,<br />
the SOC is an important estimate of idiographic strengths and weaknesses<br />
in bio-psycho-social health matters.<br />
Keywords:<br />
Salutogenesis, Sense of Coherence, Elderly Persons<br />
141
The dimensional structure of the generalized healthrelated<br />
self-concept<br />
Ulrich Wiesmann 1 , Gabriele Niehörster 1 , Hans-Joachim Hannich 1 &<br />
Ute Hartmann 2<br />
1 Universität Greifswald, Institut für Medizinische Psychologie<br />
2 Fachhochschule Bielefeld<br />
wiesmann@uni-greifswald.de<br />
Research question: We explore health as a potentially relevant category of selfdefinition.<br />
Instead of studying particular areas (e.g., smoking, exercising, sunbathing),<br />
we focus global-stable representations, that is, health-related knowledge<br />
structures about the self that are generalized over different health-related<br />
areas and over experiences at different points in time. In a recent study (Wiesmann<br />
et al. in submission), we identified five dimensions: health-protective dispositions,<br />
health-protective motivation, vulnerability, health-risky habits, and<br />
external, avoidant motivation. Our main objective is to replicate these findings<br />
with a shortened measurement instrument.<br />
Method: 436 college students (70.5 % women) filled out a revised 25-itemversion<br />
of the general health-related self-concept (GHSC) scale, including five<br />
new items which were added to improve interpretability of the fifth factor.<br />
Results: A principal components analysis yielded a five-factor solution<br />
(60.2 % variance accounted for). Using structural equation modeling, we found<br />
support for a single second-order factor of GHSC that explains the five firstorder<br />
factors.<br />
Conclusion: The five dimensions represent both positive and negative facets<br />
of the GHSC. The first two denote health resources as identified in socialcognitive<br />
models of health behavior and in personality psychology approaches.<br />
The remaining three bring up one’s health “deficits”, such as perceived susceptibility<br />
to illness and illness experiences, knowledge about one’s “behavioral<br />
pathogens”, and resignative-avoidant tendencies. The practical implication is<br />
that an individual’s GHSC, representing particular health needs and motivations,<br />
guides his or her information processing and behavior. Successful health<br />
communications should follow a strategy of self-affirmation.<br />
Reference:<br />
Wiesmann, U. et al. (in submission). Dimensions and profiles of the generalized health-related<br />
self-concept. British Journal of Health Psychology.<br />
Keywords:<br />
Health-Related Self-Concept, Measurement, Structural Equation Modeling<br />
142
Ressourcenaktivierung durch therapeutisches<br />
Schreiben<br />
Gabriele Wilz, Anika Mull & Luise Lamberz<br />
Technische Universität Berlin, Fachgebiet für <strong>Gesundheitspsychologie</strong> und<br />
Klinische Psychologie<br />
gabriele.wilz@gp.tu-berlin.de<br />
Fragestellung: Zur Förderung von Ressourcenaktivierung als wesentlicher Wirkfaktor<br />
von Psychotherapie ist die Entwicklung von Therapie unterstützenden,<br />
Patienten zentrierten und ökonomischen Interventionsstrategien von hoher<br />
Relevanz. Auf Basis der Konzepte der Ressourcenaktivierung und des<br />
therapeutischen Schreibens wurde ein Ressourcentagebuch entwickelt. Ziel<br />
war ein für Patienten praktikables Instrument zu entwickeln, das zum einen<br />
Therapie begleitend wie auch nach Abschluss der Therapie <strong>zur</strong> Stabilisierung<br />
der Therapieeffekte und Rückfallprophylaxe sowie <strong>zur</strong> Therapieprozessevaluation<br />
einsetzbar ist. Methode: Die Anwendbarkeit wurde in einer ersten<br />
Pilotstudie erprobt (N = 32). Mittels eines randomisierten Kontroll-Versuchsgruppendesigns<br />
zu zwei Messzeitpunkten (Prä/Post) sollten erste Ergebnisse<br />
<strong>zur</strong> Anwendbarkeit sowie <strong>zur</strong> Effektivität der Fragebausteine betrachtet werden.<br />
Die Stichprobe setzte sich aus zwei vollständigen Durchgängen einer Rehabilitationsmaßnahme<br />
zusammen, die zwischen März und Mai 2005 in der<br />
Rehabilitationsklinik Kinder-Rehazentrum Usedom behandelt wurden. Die Zielgruppe<br />
stellten dabei die Mütter von chronisch kranken Kindern dar, die ihre<br />
Kinder für einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen in der Rehabilitationsklinik begleiteten.<br />
Neben dem Ressourcentagebuch wurden folgende Fragebögen eingesetzt:<br />
Probandinnen-Fragebogen (Teichmann & Brzezinski, 1999) die<br />
Symptomcheckliste (SCL-90-R, Franke, 1995), das Berner Ressourceninventar<br />
(RES, Trösken, 2002), die Kurzversion des Inkongruenzfragebogens (K-INK,<br />
Grosse Holtforth et al., 2004) sowie visuelle Stimmungsskalen (VAS).<br />
Ergebnisse: Als Ergebnis dieser Pilotstudie ist ein Ressourcentagebuch in<br />
handhabbarer Form mit Anregungen und Empfehlungen <strong>zur</strong> Weiterentwicklung<br />
entstanden. Die Effektivität und Anwenderfreundlichkeit sollte in Folgestudien<br />
weiter untersucht werden.<br />
Keywords:<br />
Ressourcenaktivierung, Tagebuch, therapeutisches Schreiben<br />
143
Predisposing factors to early sexual activity and its<br />
psychosocial effects on female children in Ethiopia<br />
Yemataw Wondie & Harry Schröder<br />
Universität Leipzig<br />
yematawondie@yahoo.com<br />
Early engagement in sexual activities has become an abundantly occurring<br />
phenomenon all over the globe. The situation is even more tragic in developing<br />
nations particularly in sub-Saharan Africa where one of the youngest populations<br />
is found. This age group, upon which nations future development depends,<br />
is particularly exposed to grave risks in matters of reproductive health<br />
and its associated psychosocial impacts which may eventually jeopardize the<br />
socio-economic development of these nations. This is especially becoming an<br />
exceedingly growing problem for women and young girls in Ethiopia, who are<br />
subjected to various harmful traditional practices such as early marriage and<br />
forced sexual intercourse as well as child prostitution.<br />
This study attempts to examine the psychosocial effects of early sexuality<br />
and the major socio-cultural and economic factors that have predisposed sexually<br />
abused children specifically to early marriage, rape, and prostitution. A<br />
cross-sectional design was used; and data have been collected from a randomly<br />
as well as purposively selected 320 respondents residing in two different<br />
cities in Ethiopia (Addis Ababa, Bahr Dar). Out of this 118 were fistula patients,<br />
and the remaining 200 were rape survivors and child prostitutes. The respondents<br />
were specifically from hospitals and rehabilitating organizations.<br />
A structured interview schedule that focuses on the socio-demographic<br />
variables of the respondents plus the Children’s Impact of Events Scale and the<br />
Rosenberg Self Esteem Scale were employed to elicit responses on the predisposing<br />
factors and associated psychosocial consequences of early sexual engagement<br />
on the respondents. This will be substantiated by a qualitative case<br />
study, expert’s interview, focus group discussions and a real video document<br />
analysis, which come upon the second phase of data collection, and will be part<br />
of the final analysis of the entire project. The results will be presented right at<br />
the congress.<br />
Keywords:<br />
psychosocial effects, female children, sexual activity<br />
144
Gesundheit älterer Erwerbstätiger: Voraussetzungen<br />
und Folgen einer vorzeitigen Erwerbsbeendigung<br />
Susanne Wurm & Clemens Tesch-Römer<br />
Deutsches Zentrum für Altersfragen<br />
susanne.wurm@dza.de<br />
In den vergangenen Jahren wurden ältere Erwerbstätige oftmals in den vorzeitigen<br />
Ruhestand oder in die Arbeitslosigkeit entlassen. Dies war in Deutschland<br />
wie in anderen europäischen Ländern gängige Praxis und spiegelte die<br />
wirtschaftliche Situation ebenso wider wie die Einstellung gegenüber älteren<br />
Erwerbstätigen. Vorzeitiger Ruhestand bzw. Arbeitslosigkeit stellen kritischere<br />
Lebensereignisse dar als der Übergang in den normalen Ruhestand, da sie<br />
eher als “off-time Ereignis” (Neugarten, 1996) erlebt werden. Welche Faktoren<br />
tragen dazu bei, dass ältere Erwerbstätige erwerbslos werden oder in Vorruhestand<br />
wechseln und in welchem Ausmaß ist dieser Wechsel von gesundheitlichen<br />
Veränderungen begleitet? Diese Fragen wurden auf der Grundlage des<br />
Alterssurveys untersucht, einem bundesweit repräsentativen Survey an<br />
Personen im mittleren und höheren Erwachsenenalter (40-85 Jahre). Die vorliegende<br />
Studie bezog eine Teilstichprobe älterer Erwerbspersonen ein, die<br />
innerhalb von sechs Jahren zweimal befragt wurden (T1: 45-54 Jahre, T2: 51-<br />
60 Jahre; N = 384). Die Analysen machten deutlich, dass Personen, die zum<br />
ersten Befragungszeitpunkt eine schlechtere körperliche Gesundheit hatten, mit<br />
größerer Wahrscheinlichkeit innerhalb des Sechsjahreszeitraums arbeitslos<br />
wurden oder in den Vorruhestand wechselten; das subjektive Gesundheitserleben<br />
konnte hingegen keine Veränderungen des Erwerbsstatus’ vorhersagen.<br />
Umgekehrt führten Veränderungen im Erwerbsstatus (d. h. Verlust des<br />
Arbeitsplatzes bzw. Wechsel in den Vorruhestand) zu einer Verschlechterung<br />
der subjektiven Gesundheit. Die ergänzende Analyse einer älteren Vergleichsgruppe<br />
(T1: 55-64 Jahre, T2: 61-70 Jahre, N = 392) machte deutlich, dass dies<br />
nicht für jene Personen zutrifft, die in den normalen Ruhestand wechselten. Die<br />
Befunde legen nahe, dass ein schlechter Gesundheitszustand ein Risiko für<br />
Erwerbslosigkeit darstellt und dass ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Erwerbsleben<br />
belastender erlebt wird als der normale Übergang in den Ruhestand.<br />
Keywords:<br />
Gesundheit, ältere Erwerbstätige<br />
145
Motivationale und volitionale Prozesse der Gesundheitsverhaltensänderung<br />
bei chronisch kranken<br />
Menschen<br />
Jochen Philipp Ziegelmann & Sonia Lippke<br />
Freie Universität Berlin, Health Psychology PF10<br />
jochenzi@zedat.fu-berlin.de<br />
Fragestellung: Inwiefern unterscheiden sich die motivationalen und volitionalen<br />
Prozesse bei Menschen mit unterschiedlichem Ausmaß an körperlichen Beeinträchtigungen?<br />
Methode: N = 368 orthopädische Rehabilitationspatienten füllten Fragebögen<br />
zu ihren körperlichen Aktivitäten vor der Rehabilitation und 36 Monate<br />
nach Entlassung aus. Körperliche Beeinträchtigung wurde mit dem SF12 Health<br />
Survey erfasst. Zusätzlich zu den motivationalen Variablen wurden die<br />
volitionalen Variablen Planung und Strategienutzung, sowie phasenspezifische<br />
Selbstwirksamkeit erfasst. Planung wurde in Handlungsplanung (wann, wo, wie<br />
Planung) und Bewältigungsplanung (wie handeln trotz Barrieren?) unterteilt.<br />
Ergebnisse: Anhand der Werte auf dem SF12 Health Survey wurden die<br />
Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilt (hohes vs. niedriges Ausmaß an körperlicher<br />
Beeinträchtigung). In Multigruppen-Strukturgleichungsmodellen zeigten<br />
sich gruppenspezifische motivationale und volitionale Muster.<br />
Schlussfolgerung: Die hier untersuchten motivationalen und volitionalen<br />
Prozesse scheinen vom Ausmaß an körperlichen Beeinträchtigungen abzuhängen,<br />
was nahe legt in der tertiären Prävention anhand des Ausmaßes an<br />
körperlicher Beeinträchtigung maßgeschneiderte Unterstützung anzubieten.<br />
Literatur:<br />
Ziegelmann, J. P., Luszczynska, A., Lippke, S. & Schwarzer, R. (2007). Are goal intentions or<br />
implementation intentions better predictors of health behavior? A longitudinal study in orthopedic<br />
rehabilitation. Rehabilitation Psychology, 52, 97-102.<br />
Ziegelmann, J. P., Lippke, S. & Schwarzer, R. (2006 a). Adoption and maintenance of physical<br />
activity: Planning interventions in young, middle-aged, and older adults. Psychology &<br />
Health, 21, 145-163.<br />
Ziegelmann, J. P., Lippke, S. & Schwarzer, R. (2006 b). Subjective residual life expectancy in<br />
health self-regulation. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 61B, 195-201.<br />
Keywords:<br />
Self-Management, Chronische Erkrankung, Strategienutzung<br />
146
Autoren<br />
Aazami-Gilan, Donya, .............................. 53 Duprée, Thomas ..............................133, 134<br />
Albani, Cornelia ......................................... 35 Ebner-Priemer, Ulrich ................................36<br />
Allmer, Henning......................................... 45 Eggert, Frank ...........................................131<br />
Alpers, Georg W...................................... 127 Ehret, Christoph.........................................64<br />
Altenstein, Christine ............................ 46, 47 Eimert, Lisa..............................................109<br />
Angladagis, Marina.......................... 133, 134 Engelhard, Katharina .................................84<br />
Antoniw, Katja ............................... 21, 48, 77 Eschenbeck, Heike ............31, 65, 74, 76, 98<br />
Auckenthaler, Anna................................... 61 Faller, Hermann .......................................135<br />
Ayan, Türkan ............................................. 90 Faltermaier, Toni........................................66<br />
Barskova, Tatjana ..................................... 49 Fehlberg, Esther ........................................67<br />
Barth, Jürgen............................................. 50 Fietz-Schwarzrock, Ina ........................68, 75<br />
Bauer, Christina......................................... 51 Fittig, Eike ................................................110<br />
Baumann, Robert ...................................... 60 Fix, Caroline...............................................67<br />
Baumeister, Joachim............................... 127 Flöter, Stephanie......................................102<br />
Bengel, Jürgen .................................... 50, 52 Franke, Alexa.............................................43<br />
Becker, Annette......................................... 94 Fridrici, Mirko .............................................69<br />
Beschoner, Petra....................................... 56 Friedl-Huber, Almut..................................135<br />
Bölcskei, Pál L......................................... 134<br />
Bongard, Stephan ..................................... 53<br />
Borghardt, Andrea..................................... 21<br />
Brähler, Elmar ..................................... 35, 54<br />
Brandstetter, Susanne............................... 55<br />
Braun, Maxi ............................................... 56<br />
Braun, Melanie .......................................... 57<br />
Brunner, Claudia ................................. 58, 97<br />
Brunner, Eva ........................... 58, 59, 79, 91<br />
Buchwald, Petra ........................ 60, 107, 124<br />
Bühler, Anneke........................................ 102<br />
Burkert, Silke ....................................... 24, 63<br />
Chwallek, Katharina .................................. 61<br />
Ciccarello, Liborio...................................... 29<br />
Crössmann, Alexander............................ 127<br />
Deinzer, Renate ........................................ 73<br />
Depta, Arno ............................................... 17<br />
Dohnke, Birte....................................... 27, 39<br />
Domann, Sebastian................................. 100<br />
Domsch, Holger................................. 62, 103<br />
Dudey, Stefan............................................ 31<br />
Dunkel, Anne............................................. 63<br />
Fuchs, Reinhard.........................................71<br />
Fuhrer, Urs...............................................113<br />
Galm, Christof............................................55<br />
Gärtner, Angelika.......................................70<br />
Geissner, Edgar...................................78, 88<br />
Geßner, Anja..............................................15<br />
Gevirtz, Richard .......................................100<br />
Geyer, Michael...........................................35<br />
Gianella, Daria ...........................................81<br />
Glaeske, Gerd............................................43<br />
Glaesmer, Heide........................................54<br />
Göhner, Wiebke.........................................71<br />
Gonçalves, Marta.......................................81<br />
Gosch, Angela ...........................................72<br />
Gradl, Sabine...........................................102<br />
Gralla, Oliver........................................24, 63<br />
Granrath, Nicole.........................................73<br />
Gredig, Daniel............................................28<br />
Grimm, Anne............................................120<br />
Groß, Cornelia ...........................................74<br />
Grüsser, Sabine...................................83, 95<br />
Gusy, Burkhard..............................61, 87, 89<br />
Haas, Tobias..............................................74<br />
147
Hackmann, Elke .................................. 68, 75 Khatib, Ahmad........................................... 51<br />
Haisch, Jochen .......................................... 43 Kim, Yong-Bum ......................................... 53<br />
Hamminger, Margit .................................... 25 Kirschner, Nina.................................... 83, 95<br />
Hannich, Hans-Joachim ......46, 47, 141, 142 Klapp, Burghard F............................. 87, 120<br />
Härter, Martin............................................. 50 Klauer, Thomas................................... 21, 23<br />
Hartges, Brigitte......................................... 39 Kleiber, Dieter ..................................... 61, 87<br />
Hartmann, Ute ......................................... 142 Kleinert, Jens ................................ 84, 85, 86<br />
Hautzinger, Martin ...........................119, 132 Kleinknecht, Chloé .................................... 86<br />
Hees, Kristina ............................................ 67 Klenk, Jochen............................................ 55<br />
Heide Filipp, Sigrun ................................... 23 Kliegel, Matthias...................................... 122<br />
Heider, Jens ............................................ 126 Klinkhammer-Schalke, Monika ................. 64<br />
Heim-Dreger, Uwe..................................... 76 Knoll, Nina........................................... 24, 63<br />
Heinicke, Annett ........................................ 77 Kocalevent, Rüya-Daniela ........................ 87<br />
Heinrichs, Nina ........................................ 131 Kohlmann, Carl-Walter...... 31, 65, 74, 76, 98<br />
Hermanns, Norbert .................................... 65 Koller, Michael........................................... 64<br />
Herzberg, Dominikus ................................. 94 Kraft, Madlen....................................... 78, 88<br />
Hess, Natascha.......................................... 39 Kratka, Lucie ............................................. 15<br />
Hesselbarth, Ulrike ............................. 83, 95 Kraus-Haas, Martina ................................. 89<br />
Hillert, Andreas .......................................... 93 Krischke, Norbert R............................. 66, 75<br />
Hofstädter, Ferdinand................................ 64 Kröger, Christoph .................................... 102<br />
Horn, Andrea B.......................................... 22 Krohne, Heinz W............... 15, 16, 18, 41, 42<br />
Hornung, Rainer ..........................43, 57, 122 Kroll, Britta............................................... 130<br />
Hrabal, Vladimir ......................................... 56 Kröller, Katja.............................................. 33<br />
Ivert, Petra ........................................... 78, 88 Krowatschek, Dieter.................................. 62<br />
Jahnke, Dörthe .......................................... 33 Küffner, Roland ....................................... 135<br />
Kuhnert , Jenull-Schiefer, Brigitte..................58, 59, 79<br />
Peter.................................... 90, 108<br />
Jerg-Bretzke, Lucia.................................... 56 Kulterer, Kerstin ........................................ 91<br />
Jerusalem, Matthias ............................ 11, 99 Kusch, Michael.......................................... 92<br />
Jüngling, Sabine ........................................ 85 Laireiter, Anton-Rupert........................ 21, 25<br />
Jung, Hartmut ............................................ 94 Lamberz, Luise........................................ 143<br />
Kaczerowski, Melanie................................ 90 Lämmler, Gernot ..................................... 101<br />
Kada, Olivia ......................................... 58, 59 Landolt, Markus....................................... 123<br />
Kaluza, Gert............................................... 43 Lehmkuhl, Elke.......................................... 40<br />
Kalytta, Tanja............................................. 80 Lehr, Dirk............................................. 67, 93<br />
Kanning, Martina ................................. 35, 37 Leidig, Eberhard...................................... 109<br />
Kanzlivius, Bettina ..................................... 96 Leonhardt, Corinna ................................... 94<br />
Käppler, Christoph..................................... 81 Lippke, Sonia .................. 106, 111, 138, 146<br />
Kastner, Michael ............................... 90, 108 Loeffler, Gerit ...................................... 83, 95<br />
Kelava, Augustin........................................ 53 Lohaus, Arnold .......................... 69, 103, 137<br />
Kemper, Christoph J.................................. 82 Lorenz, Wilfried ......................................... 64<br />
Kendel, Friederike ..................................... 40 Maaser, Corinna........................................ 89<br />
148
Maggiori, Christian .................................... 38 Reith, Martin...............................................60<br />
Mahler, Caroline ........................................ 71 Renner, Britta.....................................26, 104<br />
Mallach, Natalie................................. 96, 128 Renner, Karl-Heinz ....................................15<br />
Martin, Alexandra ...................................... 54 Reschke, Jessica.....................................105<br />
Martin, Mike............................................... 57 Reschke, Konrad .......................................70<br />
Mateev, Katja ............................................ 87 Reusch, Andrea .......................................135<br />
Matiba, Katrin ............................................ 26 Reuter, Tabea..........................106, 111, 138<br />
Matterne, Uwe ........................................... 29 Rieder, Stephan.........................................22<br />
Mayring, Philipp......................................... 97 Rief, Winfried .............................................54<br />
Meier, Stefanie .................................... 74, 98 Ringeisen, Tobias ..............................60, 107<br />
Meixner, Sabine ........................................ 99 Rogge, Benedikt ......................................108<br />
Mittag, Waldemar .................................... 117 Rojas, Roberto.........................................109<br />
Mitter, Simona ........................................... 73<br />
Mohler-Kuo, Meichun ................................ 81<br />
Molina, Louella .......................................... 22<br />
Mörsen, Chantal ........................................ 95<br />
Mull, Anika............................................... 143<br />
Müller, Thomas.......................................... 62<br />
Mussgay, Lutz ......................................... 100<br />
Neuser, Hans .......................................... 127<br />
Nideröst, Sibylle ........................................ 28<br />
Niehörster, Gabriele ........................ 141, 142<br />
Nitzko, Sina ............................................... 32<br />
Otto, Kathleen ......................................... 121<br />
Ouedraogo, Ibrahim Raoua..................... 101<br />
Parpan-Blaser, Anne................................. 28<br />
Pauli, Paul ............................................... 127<br />
Peng, Aristide ............................................ 81<br />
Peroz, Ingrid .............................................. 96<br />
Perrez, Meinrad......................................... 22<br />
Piontek, Daniela ...................................... 102<br />
Plonait, Sabine .......................................... 39<br />
Pochstein, Florian.................................... 139<br />
Posse, Norbert ........................................ 130<br />
Puppe, Frank........................................... 127<br />
Rauchfuß, Martina................................... 120<br />
Rebelein, Theresa..................................... 41<br />
Regitz-Zagrosek, Vera .............................. 40<br />
Reichard, Katharina................................. 103<br />
Reicherts, Michael..................................... 38<br />
Reineke, Anke ......................................... 100<br />
Rottmann, Nina..........................................52<br />
Rüddel, Heinz ..........................................100<br />
Rudolph, Udo...........................................110<br />
Rueggeberg, Rebecca.............................111<br />
Rüesch, Peter ..........................................112<br />
Sabic, Merima............................................53<br />
Saenger, Marah .......................................113<br />
Sander, Christian .....................................114<br />
Sann, Uli ..................................................115<br />
Schaal, Steffen.................................116, 117<br />
Schauer, Ingolf.........................................118<br />
Scheel, Lena..............................................17<br />
Schlarb, Angelika.....................................119<br />
Schlicht, Wolfgang ...................................109<br />
Schmid, Gabriele .....................................120<br />
Schmidt, Sabine.......................................121<br />
Schnell, Barbara ........................................17<br />
Schoebius, Dominique...............................22<br />
Schoenfeldt-Lecuona, Carlos ....................56<br />
Scholz, Urte .........................24, 57, 122, 140<br />
Schönbucher, Verena ..............................123<br />
Schorn, Nicola K. .....................................124<br />
Schröder, Annette............................125, 126<br />
Schröder, Christina ..................................136<br />
Schröder, Harry..70, 105, 114, 118, 136, 144<br />
Schuler, Daniela.......................................112<br />
Schulz, Stefan M......................................127<br />
Schürholz, Martin.......................................31<br />
Schürholz, Thomas....................................43<br />
149
Schüz, Benjamin................96, 106, 128, 140 Trautner, Hanns Martin ........................... 107<br />
Schwarzer, Christine ............................... 130 Vieluf, Dieter............................................ 103<br />
Schwarzer, Ralf ...............104, 128, 129, 140 Vierhaus, Marc ........................................ 137<br />
Schwerdtfeger, Andreas............................ 17 Vögele, Claus............................................ 31<br />
Seefeldt, Wiebke Lina.............................. 131 Vogel, Heiner .......................................... 135<br />
Seelig, Harald ............................................ 71 Voigt, Barbara ......................................... 120<br />
Seemann, Simone ................................... 132 Vollmann, Manja ........................... 26, 48, 77<br />
Seifer, Ilona ......................................... 68, 75 Vollmer, Heinz C. ...................................... 51<br />
Seiffge-Krenke, Inge.................................. 32 Wabitsch, Martin ....................................... 55<br />
Sieverding, Monika ........................27, 29, 30 Warner, Lisa M........................................ 138<br />
Six, Ulrike................................................. 125 Warschburger, Petra................................. 33<br />
Smits, Jacqueline ...................................... 42 Wartha, Olivia............................................ 55<br />
Sniehotta, Falko F. ..........................128, 140 Weber, Daniel ......................................... 123<br />
Sonntag, Dilek ........................................... 51 Weber, Hannelore............................... 21, 26<br />
Sosnowsky, Nadia ..................................... 93 Wegner, Manfred .................................... 139<br />
Spaderna, Heike......................18, 39, 41, 42 Weidner, Gerdi .................. 10, 18, 39, 41, 42<br />
Spies, Claudia D........................................ 27 Weigand, Sonja....................................... 132<br />
Spinath, Frank M. ...................................... 19 Weiß-Gerlach, Edith.................................. 27<br />
Spivak, Youlia.......................................... 104 Wetz, Franz Josef ..................................... 13<br />
Steinacker, Jürgen M................................. 55 Wiedemann, Amelie U. ... 106, 111, 138, 140<br />
Steinger, Brunhilde .................................... 64 Wiesmann, Ulrich ................ 46, 47, 141, 142<br />
Steinhagen-Thiessen, Elisabeth.............. 101 Wight, Melanie .......................................... 57<br />
Stierle, Christian ...................................... 103 Wilhelm, Peter........................................... 22<br />
Storck, Christina ..............................133, 134 Wilz, Gabriele.............................. 49, 80, 143<br />
Ströbl, Veronika ....................................... 135 Wingert, Gordon........................................ 62<br />
Stroebe, Wolfgang....................................... 9 Wolf, Heike................................................ 19<br />
Sulprizio, Marion........................................ 84 Wondie, Yemataw ................................... 144<br />
Tesch-Römer, Clemens........................... 145 Wurm, Susanne ...................................... 145<br />
Teubert, Manuel ...................................... 107 Zaby, Alexandra ...................................... 126<br />
Thiex, Dagmar L. ....................................... 16 Zahn, Daniela................................ 18, 41, 42<br />
Thomanek, Sabine ................................ 9416 Zehnder, Sabine........................................ 81<br />
Tölg, Kristin.............................................. 136 Ziegelmann, Jochen P. ... 106, 111, 138, 146<br />
Trageser, Carolin....................................... 93 Ziegler, Matthias........................................ 82<br />
Traue, Harald C. ........................................ 56 Zimmermann, Friederike........................... 30<br />
150
Band 1 (1987) Vergriffen!<br />
Günter Kolb (Hrsg):<br />
Schöne neue Welt. Medien verändern den Alltag<br />
Band 2 (1987)<br />
Gerd Noetzel:<br />
Vom Notstandsgebiet Schwäbisch Gmünd und den<br />
hiesigen Anfängen der Zahnradfabrik Friedrichshafen AG<br />
Band 3 (1988)<br />
Wolfgang Knörzer:<br />
Die Hauptschulabschlussprüfung<br />
Erzieherische und leistungsmäßige Auswirkungen der<br />
Einführung des Hauptschulabschlussverfahrens<br />
Band 4 (1988)<br />
Bruno Heilig (Hrsg):<br />
Perspektiven der Verkehrspädagogik<br />
Kongressbericht 11. – 13. Mai 1988<br />
Band 5 (1988) Vergriffen!<br />
Gerd Noetzel:<br />
Margarethe Kajtar<br />
Spätaussiedler aus Rumänien im Ostalbkreis<br />
Aus den Lebensverhältnissen in der alten Heimat<br />
Band 6 (1989)<br />
Lothar Daemgen, Bruno Heilig, Erich Pommerenke,<br />
Karl M. Setzen, Rudolf Wichard:<br />
Zeitung in der Schule<br />
Untersuchungen zu einem Medienprojekt<br />
Band 7 (1989)<br />
Gertrud Seydelmann:<br />
Von der Kinderbewahranstalt <strong>zur</strong> Bibliothekarin<br />
Schulerlebnisse von 1916 bis 1935 im katholischen Köln<br />
Mit einem Vorwort von Albert Heller<br />
Band 8 (1989)<br />
Helmut Christmann (Hrsg.):<br />
Kolonisation und Dekolonisation<br />
Referate des internationalen Kolonialgeschichtlichen<br />
Symposiums '89 an der <strong>Pädagogische</strong>n <strong>Hochschule</strong><br />
Schwäbisch Gmünd<br />
Band 9 (1990) Vergriffen!<br />
Albert Heller / Rudolf Wichard (Hrsg.):<br />
Entwicklung durch Bildung?<br />
Alternativen <strong>zur</strong> europäischen Schule in der Dritten Welt<br />
151
152<br />
Band 10 (1990)<br />
Gabriele Huber:<br />
Die "Città dei Ragazzi" – eine selbstverwaltete Kinderstadt<br />
Band 11 (1991) Vergriffen!<br />
Ursula Coburn-Staege, Brunhilde Kanzler,<br />
Margarete Schmid (Hrsg.):<br />
Frau und Gesellschaft<br />
Entstanden aus einer Ringvorlesung<br />
an der <strong>Pädagogische</strong>n<br />
<strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd im WS 1989/90<br />
Band 12 (1996)<br />
Ursula Coburn-Staege, Manfred Zirkel (Hrsg.):<br />
Interkulturelle Erziehung in Deutschland, Großbritannien<br />
und Italien<br />
Band 13 (1993)<br />
Dieter Rodi (Hrsg.):<br />
Umweltschutz, Umweltpolitik, Umweltbildung –<br />
Beitrag der Fächer zu einem Überlebensproblem<br />
Entstanden aus einer Ringvorlesung<br />
an der <strong>Pädagogische</strong>n <strong>Hochschule</strong><br />
Schwäbisch Gmünd im WS 1992/93<br />
Band 14 (1994)<br />
Doris Friedel:<br />
Persönlichkeitsentwicklung und ganzheitlicher Unterricht<br />
Band 15 (1996)<br />
Karl Setzen (Hrsg.):<br />
Technik – Chancen und Risiken<br />
Band 16 (1997)<br />
Wolfgang Schmid:<br />
Das Bildungssystem in der Ukraine<br />
Band 17 (2000)<br />
Helmut und Margret Schneider:<br />
Verhaltenskundliche Schwäbisch Gmünder<br />
Stadtexkursion<br />
Band 18 (2001)<br />
Martin Weyer-Menkhoff (Hrsg.):<br />
Engagierte Theologie<br />
Festgabe für Manfred Köhnlein zum 65. Geburtstag<br />
Beispiele und Erfahrungen
Band 19 (2001)<br />
Karl M. Setzen:<br />
Soziologie in der Pädagogen-Ausbildung<br />
– Beispiele und Erfahrungen –<br />
Band 20 (2001)<br />
Heike Eschenbeck, Carl-Walter Kohlmann, Anton Nuding (Hrsg.):<br />
<strong>Beiträge</strong> der empirischen Forschung für Unterricht und Erziehung<br />
61. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische <strong>Pädagogische</strong><br />
Forschung (AEPF) vom 27.-29.09.2001 in Schwäbisch Gmünd<br />
Band 21 (2002)<br />
Stefan Immerfall, Carsten Quesel, Lothar Rother (Hrsg.):<br />
Europa<br />
Konzepte, politischer Alltag, pädagogische Entwürfe<br />
Zwischenbilanzen und Zukunftsperspektiven<br />
der Europäischen Integration<br />
Festschrift zum 65. Geburtstag von Rudolf Wichard<br />
Band 22 (2002)<br />
Hansjörg Seybold, Werner Rieß (Hrsg):<br />
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der Grundschule<br />
Methodologische und konzeptionelle Ansätze<br />
Band 23 (2003)<br />
Axel Horn (Hrsg.):<br />
Sport macht Schule –<br />
Kinder stark machen im Verein und Schule<br />
Fachkongress in Schwäbisch Gmünd am 4./5. April 2003<br />
Band 24 (2004)<br />
Gerhard Fritz (Hrsg.):<br />
Landesgeschichte und Geschichtsdidaktik<br />
Festschrift für Rainer Jooß<br />
Band 25 (2004)<br />
Werner Sinn:<br />
Veränderungen einer Kulturlandschaft<br />
am Beispiel der Region Ostwürttemberg.<br />
„Forschendes Lernen“ an der Seniorenhochschule<br />
Band 26 (2005)<br />
Axel Horn (Hrsg.):<br />
Kinder in Bewegung<br />
BewegGründe für Kinder<br />
Sportkongress in Schwäbisch Gmünd am 22./23.April 2005<br />
Band 27 (2007)<br />
Martin Plieninger<br />
Eva Schumacher (Hrsg.)<br />
Auf den Anfang kommt es an –<br />
Bildung und Erziehung im Kindergarten<br />
und im Übergang <strong>zur</strong> Grundschule<br />
153
154<br />
Band 28 (2007)<br />
Axel Horn und Jens Keyßner (Hrsg.)<br />
Sport integriert – integriert Sport<br />
Alle Bände sind zu beziehen über die<br />
<strong>Pädagogische</strong> <strong>Hochschule</strong> Schwäbisch Gmünd<br />
Oberbettringer Str. 200, 73525 Schwäbisch Gmünd<br />
Tel.: (0 71 71) 983-238<br />
E-Mail: verw1@vw.ph-gmuend.de