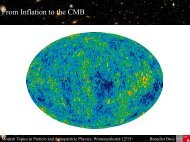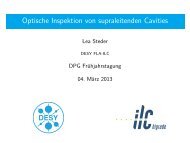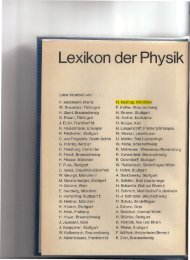ingo.strauch.diplom - Desy
ingo.strauch.diplom - Desy
ingo.strauch.diplom - Desy
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4.2. ENTWICKLUNG NEUER TEILCHENMODELLE 29<br />
anhand dieses Wertes alle weiteren Eigenschaften angesprochen werden können.<br />
Der H1Jet stellt eine Zusammenfassung von einem oder mehreren Teilchen dar. Er wird<br />
als einziger nicht direkt mit Werten für seine Eigenschaften erzeugt sondern als leeres Objekt,<br />
dem dann Teilchen hinzugefügt werden. Diese werden beim Jet als Töchter bezeichnet und ihre<br />
Vierervektoren zum Gesamt-Vierervektor des Jets aufsummiert.<br />
Das konkrete Design der Relationen war bei diesem Entwurf noch nicht vorhanden. Das<br />
H1-Pointermanagement wurde erst zu dem Zeitpunkt entwickelt, als klar wurde, daß in naher<br />
Zukunft keine zufriedenstellende Funktionalität in ROOT integriert werden würde, die erlaubt,<br />
Referenzen ohne vollständige Kopie des referenzierten Objektes abzuspeichern.<br />
4.2.2 Zwei unabhängige Hierarchien für allgemeine und identifizierte Teilchen<br />
Der Ansatz aus Abschnitt 4.2.1, welcher nur generische, gemessene Teilchen, Jets und generierte<br />
Teilchen vorsieht, wird dem Konzept des µODS nicht gerecht, da es keine Klassen gibt, die sich<br />
für die Listen der identifizierten Teilchen eignen. Somit wäre nicht möglich, beispielsweise allein<br />
aus den µODS-Informationen � (E − pz) aus dem gestreuten Elektron und dem HFS (Hadronic<br />
Final State = hadronischer Endzustand) zu berechnen, da die H1ParticleCands keinerlei<br />
Information haben, aus was sie konstruiert wurden. Ausnahme wäre eine Situation, wo nur die<br />
Teilchen des hadronischen Endzustandes und das gestreute Elektron in dieser Liste gespeichert<br />
würden. Da dies nicht das angestrebte Ziel ist, muß ein allgemeingültigeres Konzept für die<br />
Behandlung von Teilchenidentifikation gewählt werden.<br />
Vom H1ParticleCand abgeleitete Klassen kommen nicht in Frage, da mit diesem Ansatz<br />
Information dupliziert würde, die bereits in der globalen Liste aller Teilchen enthalten ist.<br />
Möglich ist eine zweite Hierarchie von Teilchenklassen, die unabhängig von derjenigen aus<br />
Abbildung 4.1 ist. Auch hier gilt es wieder, Gemeinsamkeiten zu suchen, die in eine Basisklasse<br />
für identifizierte Teilchen (H1IDPart) integriert werden können. Es stellt sich heraus, daß als<br />
einzige gemeinsame Eigenschaft der Zusammenhang zwischen einem identifizierten Teilchen<br />
und seinem zugeordneten generischen Teilchen besteht. Alle weiteren Dinge sind zu speziell,<br />
um in der Basisklasse implementiert zu werden.<br />
Eine konkrete Klasse für identifizierte Teilchen ist H1IDScElec für die gestreuten Elektronen.<br />
Sie enthält den Typ des Elektrons (im SpaCal oder LAr gemessen) und ein Qualitätskennzeichen.<br />
Letzteres gibt an, ob dieses Elektron engen oder losen Schnitten genügt.<br />
Zwei abgeleitete Klassen – H1IDTrack und H1HFS – werden als reine “Zeigerklassen”<br />
benutzt, d.h. sie besitzen nur den H1Pointer aus H1IDPart, um einen Zugriff auf die zugeordneten<br />
generischen Teilchen zu ermöglichen. Bei den Spuren handelt es sich um solche, die<br />
besonderen Qualitätskriterien entsprechen.<br />
Es ergibt sich ein Vererbungsbaum für die identifizierten Teilchen wie in Abbildung 4.2. Die<br />
Klassen aus diesem Baum werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit als “Zeigerklassen” bezeichnet,<br />
da sie im wesentlichen nur wenig Informationen mehr enthalten als die generischen Teilchenkandidaten,<br />
auf die sie verweisen. Ihr Zweck ist hauptsächlich, den H1ParticleCands eine<br />
Identität zu geben, wobei es auch erlaubt ist, von zwei unterschiedlichen identifizierten Teilchen