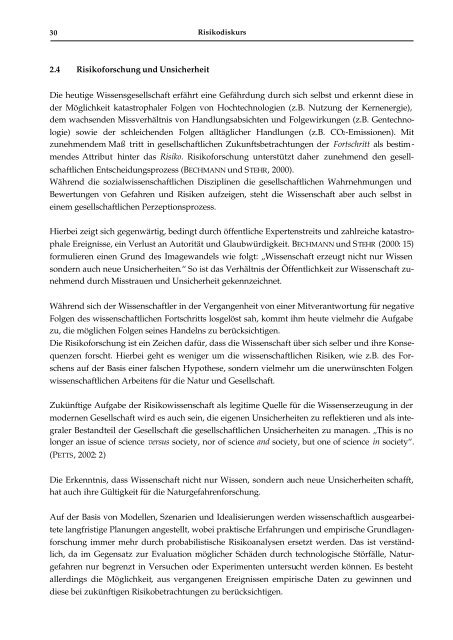risikobetrachtung von naturgefahren - Christian-Albrechts ...
risikobetrachtung von naturgefahren - Christian-Albrechts ...
risikobetrachtung von naturgefahren - Christian-Albrechts ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
30<br />
2.4 Risikoforschung und Unsicherheit<br />
Risikodiskurs<br />
Die heutige Wissensgesellschaft erfährt eine Gefährdung durch sich selbst und erkennt diese in<br />
der Möglichkeit katastrophaler Folgen <strong>von</strong> Hochtechnologien (z.B. Nutzung der Kernenergie),<br />
dem wachsenden Missverhältnis <strong>von</strong> Handlungsabsichten und Folgewirkungen (z.B. Gentechno-<br />
logie) sowie der schleichenden Folgen alltäglicher Handlungen (z.B. CO2-Emissionen). Mit<br />
zunehmendem Maß tritt in gesellschaftlichen Zukunftsbetrachtungen der Fortschritt als bestim-<br />
mendes Attribut hinter das Risiko. Risikoforschung unterstützt daher zunehmend den gesell-<br />
schaftlichen Entscheidungsprozess (BECHMANN und STEHR, 2000).<br />
Während die sozialwissenschaftlichen Disziplinen die gesellschaftlichen Wahrnehmungen und<br />
Bewertungen <strong>von</strong> Gefahren und Risiken aufzeigen, steht die Wissenschaft aber auch selbst in<br />
einem gesellschaftlichen Perzeptionsprozess.<br />
Hierbei zeigt sich gegenwärtig, bedingt durch öffentliche Expertenstreits und zahlreiche katastro-<br />
phale Ereignisse, ein Verlust an Autorität und Glaubwürdigkeit. BECHMANN und STEHR (2000: 15)<br />
formulieren einen Grund des Imagewandels wie folgt: „Wissenschaft erzeugt nicht nur Wissen<br />
sondern auch neue Unsicherheiten.“ So ist das Verhältnis der Öffentlichkeit zur Wissenschaft zunehmend<br />
durch Misstrauen und Unsicherheit gekennzeichnet.<br />
Während sich der Wissenschaftler in der Vergangenheit <strong>von</strong> einer Mitverantwortung für negative<br />
Folgen des wissenschaftlichen Fortschritts losgelöst sah, kommt ihm heute vielmehr die Aufgabe<br />
zu, die möglichen Folgen seines Handelns zu berücksichtigen.<br />
Die Risikoforschung ist ein Zeichen dafür, dass die Wissenschaft über sich selber und ihre Konse-<br />
quenzen forscht. Hierbei geht es weniger um die wissenschaftlichen Risiken, wie z.B. des For-<br />
schens auf der Basis einer falschen Hypothese, sondern vielmehr um die unerwünschten Folgen<br />
wissenschaftlichen Arbeitens für die Natur und Gesellschaft.<br />
Zukünftige Aufgabe der Risikowissenschaft als legitime Quelle für die Wissenserzeugung in der<br />
modernen Gesellschaft wird es auch sein, die eigenen Unsicherheiten zu reflektieren und als inte-<br />
graler Bestandteil der Gesellschaft die gesellschaftlichen Unsicherheiten zu managen. „This is no<br />
longer an issue of science versus society, nor of science and society, but one of science in society“.<br />
(PETTS, 2002: 2)<br />
Die Erkenntnis, dass Wissenschaft nicht nur Wissen, sondern auch neue Unsicherheiten schafft,<br />
hat auch ihre Gültigkeit für die Naturgefahrenforschung.<br />
Auf der Basis <strong>von</strong> Modellen, Szenarien und Idealisierungen werden wissenschaftlich ausgearbei-<br />
tete langfristige Planungen angestellt, wobei praktische Erfahrungen und empirische Grundlagen-<br />
forschung immer mehr durch probabilistische Risikoanalysen ersetzt werden. Das ist verständlich,<br />
da im Gegensatz zur Evaluation möglicher Schäden durch technologische Störfälle, Natur-<br />
gefahren nur begrenzt in Versuchen oder Experimenten untersucht werden können. Es besteht<br />
allerdings die Möglichkeit, aus vergangenen Ereignissen empirische Daten zu gewinnen und<br />
diese bei zukünftigen Risikobetrachtungen zu berücksichtigen.