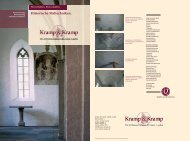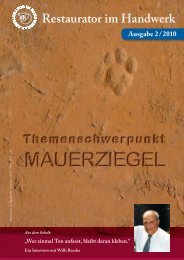Restaurator im Handwerk – Ausgabe 4/2011 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk – Ausgabe 4/2011 - Kramp & Kramp
Restaurator im Handwerk – Ausgabe 4/2011 - Kramp & Kramp
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Blick vom heutigen<br />
Hotelhof<br />
auf das Hauptgebäude<br />
8<br />
Die Restaurierung von Schloss Neuhardenberg<br />
Projektplanung<br />
Die Überlegungen des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes<br />
(DSGV), Schloss Neuhardenberg zu erwerben<br />
und zum Kultur- und Tagungszentrum auszubauen,<br />
gehen auf das Jahr 1993 zurück. Nach ersten Gesprächen<br />
mit den Erben der Familie von Hardenberg wurde <strong>im</strong><br />
Mai 1994 ein Architekturbüro mit der Bestandsaufnahme<br />
der vorhandenen Gebäude zur Ermittlung der Sanierungskosten<br />
und zur Entwicklung von Nutzungskonzepten<br />
beauftragt.<br />
Vorrangig zu klären waren jedoch noch die Eigentumsverhältnisse<br />
und die Nutzung des Schloss-Ensembles<br />
durch zahlreiche öffentliche und private Einrichtungen.<br />
So unterhielt die Gemeindeverwaltung <strong>im</strong><br />
westlichen Kavaliershaus ein Standesamt, die Orangerie<br />
diente als Turnhalle, und das Schloss selbst wurde als<br />
Museum genutzt. Barackenähnliche Gebäude neben<br />
der Remise beherbergten eine Kindertagesstätte, westlich<br />
des Schlosses lag die in den 1970er Jahren errichtete<br />
Hauptschule mit den dazugehörigen Schulhöfen,<br />
und vor der Remise entlang des Angers <strong>im</strong> ehemaligen<br />
Wirtschaftshof waren drei größere Wohneinheiten in<br />
Plattenbauweise mit insgesamt 80 Wohnungen errichtet<br />
worden. <strong>Handwerk</strong>sbetriebe und die freiwillige Feuerwehr<br />
beanspruchten ebenfalls Teile des Areal und der<br />
historischen Gebäude. An der Stelle des heutigen Saalbaus<br />
standen größere Garagen und Lagergebäude. Die<br />
örtliche Sparkasse hatte <strong>im</strong> Bereich der heutigen "Brennerei"<br />
ein Gebäude aus den 1970er Jahren bezogen. Zudem<br />
grenzten weiter östlich zwei größere Kleingartenanlagen<br />
unmittelbar an den historischen Schlosspark.<br />
Die Freiräumung all dieser Einrichtungen war Voraussetzung<br />
für die Realisierung der umfangreichen Sanierungs-<br />
und Umbauarbeiten. Dies wurde 1996 in einer<br />
"Gütlichen Vereinbarung" mit dem Land Brandenburg,<br />
der Kreisverwaltung, dem Amt Neuhardenberg, der<br />
Treuhand, der gräflichen Familie und den privaten Nutzern<br />
der Liegenschaften verbindlich geregelt.<br />
Vernichtete oder unvollständige Grundbücher erschwerten<br />
die Klärung der zu restituierenden Grundstücke.<br />
Erst durch intensive Recherchen in Zusammenarbeit<br />
mit dem Landesamt für offene Vermögensfragen in<br />
Frankfurt (Oder) und durch eidesstattliche Versicherungen<br />
von Zeitzeugen konnte zumindest ein wesentlicher<br />
<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> <strong>–</strong> <strong>Ausgabe</strong> 4/<strong>2011</strong><br />
Teil rechtsverbindlich festgelegt werden. lm Jahre 1996<br />
erhielten schließlich <strong>im</strong> Rahmen des Einigungsvertrages<br />
die Nachfahren der letzten, von den Nationalsozialisten<br />
enteigneten Besitzer des Schlosses ihr ehemaliges<br />
Eigentum zurück. Der Umzug der <strong>Handwerk</strong>sbetriebe,<br />
der öffentlichen Einrichtungen und − unter Einbeziehung<br />
eines psychologischen Expertenteams − auch der<br />
Mieter wurde 1997 mit finanzieller Unterstützung des<br />
DSGV und des Landes Brandenburg vollzogen. Noch<br />
<strong>im</strong> gleichen Jahr wurde auch der Kaufvertrag mit Friedrich-Carl<br />
Graf von Hardenberg als Oberhaupt der Familie<br />
abgeschlossen.<br />
Parallel zu den ersten Entwürfen und Nutzungskonzepten<br />
wurde gemeinsam mit dem Brandenburgischen<br />
Landesamt für Denkmalpflege, von Bauhistorikern eine<br />
gründliche Bestandsaufnahme der vorgefundenen Baukörper<br />
und -teile durchgeführt. In einer sorgfältigen<br />
Analyse ging es insbesondere darum, historische Bauelemente<br />
ihrem Entstehungsjahr nach zuzuordnen. Hieraus<br />
ergab sich für jeden vorhandenen Baukörper eine umfangreiche<br />
Dokumentation, die deutlich machte, welche<br />
historischen Bauteile und -elemente überhaupt noch<br />
vorhanden waren und in welchem Zustand sie sich befanden.<br />
Anhand dieser Dokumentation konnten nichthistorische<br />
Wände, Decken und sonstige Bauteile genau<br />
definiert werden, woraus sich letztendlich die Abbruchplanung<br />
bzw. die Entkernungsmaßnahmen ergaben.<br />
Im Winter 1997/98 begannen daraufhin die vorbereitenden<br />
Baumaßnahmen mit dem Abriss der Werkstätten<br />
und Betriebsgebäude sowie der drei Wohnblöcke.<br />
Restaurierung und Wiederaufbau<br />
Der denkmalgerechte Wiederaufbau und die Restaurierung<br />
des Schlossensembles vollzog sich zeitlich in fünf<br />
Bauabschnitten:<br />
• Rückbau aller Gebäude und Gebäudeeinrichtungen bis<br />
auf die historischen Bauteile;<br />
• Grundsanierung der zu erhaltenden Bauteile, insbesondere<br />
gegen aufsteigende Feuchtigkeit;<br />
• Wiederaufbau und Sanierung der historischen Gebäude<br />
und Errichtung von Neubauten;<br />
• Restaurierung und Instandsetzung der Außenanlagen<br />
und des historischen Landschaftsparks;<br />
• Restaurierung der historischen Räume und komplette<br />
lnnengestaltung und Möblierung.<br />
Sanierung des Schlosses<br />
Zu Beginn der Sanierungsarbeiten waren die Fassadenflächen<br />
des bereits in den 1960er und 1980er Jahren<br />
mehrmals sanierten Schlosses zu annähernd 50% ohne<br />
Untergrundhaftung und mussten entfernt werden. Zur<br />
Instandsetzung wurden nach entsprechender Reinigung<br />
eine neue Putzbeschichtung und ein neuer Fassadenanstrich<br />
aufgebracht. lm Kellergeschoß, von dem einige<br />
Teile zu den ältesten erhaltenen Räumen des heutigen<br />
Schlosses zählen, musste wie in den anderen Gebäuden<br />
eine neue Horizontaldichtung eingebracht werden, wobei<br />
der Kellerboden zur besseren Raumnutzung geringfügig<br />
abgesenkt wurde.<br />
Der zum großen Teil erhaltene historische Dachstuhl<br />
stellte die Architekten vor eine besonders schwer<br />
zu lösende Aufgabe. Etliche Balken waren so vermodert<br />
oder durch Insekten zerfressen, dass <strong>im</strong> Normalfall eine<br />
Sanierung kaum vertretbar gewesen wäre. Schinkel hat-