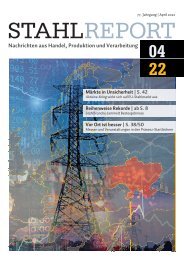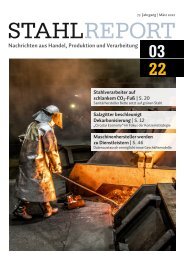Stahlreport 2019.05
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
74. Jahrgang | Mai 2019<br />
STAHLREPORT<br />
Das BDS-Magazin für die Stahldistribution<br />
5|19<br />
Elektromobilität – Stahl in der Pole Position
Elektromobilität –<br />
Stahl in der Pole Position<br />
EDITORIAL<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
Konjunkturprognosen weisen – die betroffenen<br />
Experten mögen es verzeihen –<br />
eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Wetteraussichten<br />
auf. Schon rein sprachlich<br />
ziehen, wie gerade jetzt auch wieder,<br />
dunkle Wolken am Konjunkturhimmel<br />
auf und es droht Gegenwind (siehe ab<br />
S. 24). Doch es gibt – mindestens – einen wichtigen Unterschied<br />
zwischen Wetternachricht und Konjunkturprognose:<br />
Wie wir über das Wetter reden, ändert nichts daran, wie es<br />
morgen tatsächlich wird. Das ist bei Konjunkturausblicken<br />
anders. Denn es beeinflusst auch das eigene Handeln, wenn<br />
man zum Beispiel hört, dass sich die Stimmung „allgemein<br />
eingetrübt“ hat – und es besteht die Gefahr, dass sich diese<br />
Prophezeiung selbst erfüllt. Das heißt nicht, dass Konjunkturprognosen<br />
nutzlos sind. Das sind Wetternachrichten ja<br />
auch nicht. Tatsächlich sind beide im Laufe der Jahre dank<br />
verbesserter Datenlage und Methodik sehr viel präziser<br />
geworden. Man sollte sich aber von Zeit zu Zeit vergegenwärtigen,<br />
dass Konjunktur-Vorhersagen „nur“ auf Statistik<br />
basieren – und die konkrete Situation von der Vorhersage<br />
abweichen kann. Denn wie heißt es vom großen Dortmunder<br />
Fußballweisen Adi Preißler? „Entscheidend is’ auf’m Platz“.<br />
Dieser schöne Satz gilt letztlich übrigens für Alles und Alle<br />
– und daher werden Sätze dieser Art oft auch Binsenweisheit<br />
genannt (obwohl man zugestehen muss, dass sie vielleicht<br />
niemand so überzeugend und unterhaltsam vorbringen<br />
kann, wie Fußballer). Diese Binsenweisheit gilt auch mit<br />
Blick auf die Entwicklung der Elektromobilität – und die<br />
Frage, welche Rolle der Werkstoff Stahl für diese Technologie<br />
spielt und noch spielen wird. Die Entscheidung wird von<br />
vielen konkreten Faktoren abhängen – wobei es für Stahl<br />
gar nicht so schlecht aussieht (siehe S. 22 ).<br />
In diesem Sinne, gute Fahrt, viel Vergnügen und hoffentlich<br />
einigen Informationszuwachs beim Lesen,<br />
Freundliche Grüße<br />
Markus Huneke<br />
Titelbild: voestalpine. Der österreichische Technologiekonzern voestalpine ist<br />
seit Beginn der Saison 2018/19 für zunächst zwei Jahre Partner der ABB FIA<br />
Formel E Meisterschaft. Das Unternehmen wird allen europäischen Rennen<br />
seinen Namen geben und die „voestalpine European Races“ präsentieren.<br />
INHALT<br />
PERSÖNLICHES<br />
4 Kurznachrichten<br />
STAHLHANDEL<br />
6 Andernach & Bleck: Auf dem Weg in die Zukunft<br />
10 Ullner u. Ullner: Ein richtiger Schritt nach vorn<br />
STAHLPRODUKTION<br />
14 thyssenkrupp Steel: Wasserstoff statt Kohle<br />
16 ArcelorMittal: Pilotanlage zur Direktreduktion<br />
geplant<br />
ANARBEITUNG UND LOGISTIK<br />
18 progress: Starker Partner für die<br />
BAMTEC-Bewehrungstechnologie<br />
WERKSTOFFE<br />
22 Studie: Stahl in der Elektromobilität<br />
MESSEN UND MÄRKTE<br />
Schwerpunkt Konjunktur<br />
24 Bauwirtschaft stützt Konjunktur<br />
26 Zulieferer: Politische Stabilität bereitet Sorge<br />
28 Industrieproduktion auf Talfahrt<br />
30 Wirtschaftsforschung: Konjunktur deutlich abgekühlt<br />
32 Düsseldorfer Edelstahltage: Ambivalenter Ausblick<br />
BDS<br />
34 Research: Unterschiedliche Stimmungslagen<br />
36 Berufsbildung – Fernstudium<br />
Neuer Jahrgang startet zum Juli<br />
37 Berufsbildung – Standards und<br />
Branchenausprägungen<br />
VERBÄNDE UND POLITIK<br />
38 BME: Digitalisierung und Beschaffung<br />
42 bauforumstahl: Neues Veranstaltungsformat<br />
42 „hub.berlin“: Digitale Welt<br />
WISSENSWERTES<br />
44 BIBB-Studie analysiert Schülerwünsche –<br />
Ausbildung vs. Studium<br />
LIFESTEEL<br />
48 Brückenfunktionen: Edelstahl Rostfrei<br />
50 thyssenkrupp freut sich über Hochhauspreis<br />
Impressum<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
3
Persönliches<br />
Kurznachrichten<br />
Foto: RM Rudolf Müller<br />
Foto: BDS<br />
Stephan Schalm<br />
hat zum 1.4.19 die Leitung des Geschäftsbereichs<br />
Planen der Rudolf Müller Mediengruppe in<br />
Köln übernommen. In der Gruppe verteilen sich<br />
die Verantwortlichkeiten auf drei gleich strukturierte<br />
Programmbereiche – Planen, Bauen und<br />
Handel. Der Geschäftsbereich<br />
Planen vereint<br />
die Geschäftsfelder<br />
Brandschutz, Immobilienwirtschaft,<br />
barrierefreies<br />
Bauen, Normen<br />
& Recht sowie Architektur<br />
& Ingenieurwesen<br />
mit allen Verlagsprodukten<br />
und<br />
Services. Ca. 40 Mitarbeiter<br />
erwirtschaften im Geschäftsbereich einen<br />
zweistelligen Millionenumsatz – Print, Digital und<br />
Live. Der 44jährige Stephan Schalm ist Dipl.-<br />
Bauingenieur und als zertifizierter Verlagsmanager<br />
seit über 10 Jahren in leitenden Funktionen<br />
tätig. Er kommt vom Vulkan-Verlag/Deutscher<br />
Industrieverlag, einem B2B-Informationsdienstleister<br />
von Fachinformationen für Ingenieure,<br />
Techniker und das technische Management.<br />
Beate Wynands<br />
arbeitet seit zehn Jahren für den BDS. Im April<br />
2009 begann sie beim Bundesverband Deutscher<br />
Stahlhandel (BDS) in ihrer Funktion als<br />
Assistentin Berufsbildung<br />
– ein Bereich, in<br />
dem sie inzwischen als<br />
Referentin tätig ist;<br />
Bereichsleiter ist<br />
Dr. Ludger Wolfgart.<br />
Außerdem ist die 49-<br />
Jährige gebürtige<br />
Aachenerin im BDS die<br />
Verantwortliche für alle<br />
Angelegenheiten des<br />
Qualitätsmanagements und in dieser Funktion<br />
direkt Vorstand Oliver Ellermann unterstellt.<br />
Marcus Nachbauer<br />
aus Ludwigshafen ist zum neuen Vorsitzenden<br />
der Bundesvereinigung Bauwirtschaft gewählt<br />
worden. Der 46-Jährige ist Geschäftsführender<br />
Gesellschafter der Eugen Nachbauer GmbH &<br />
Co. KG sowie der Hohenadel Gerüstbau GmbH &<br />
Co. KG. Er tritt die Nachfolge von Karl-Heinz<br />
Schneider an, der nach 12-jähriger Amtszeit<br />
nicht wieder kandidiert hatte. Zugleich ist Nachbauer<br />
Präsident des Bundesverbandes Gerüstbau<br />
e. V. Er erklärte nach seiner Wahl: „Die Interessen<br />
der mittelständischen Bauunternehmen, die<br />
Foto: ZDB<br />
Foto: Mann<br />
wir repräsentieren, stehen<br />
auch für mich im<br />
Fokus meines ehrenamtlichen<br />
Engagements.<br />
Gerade die Bauwirtschaft<br />
führt<br />
Traditionen in die<br />
Zukunft. Dazu bedarf<br />
es aber entsprechender<br />
Rahmenbedingungen.<br />
Daher geht es mir besonders um die Fachkräftesicherung,<br />
um den Arbeitsschutz sowie um<br />
die Bekämpfung der Schwarzarbeit.“ Gleichzeitig<br />
hatte die Mitgliederversammlung Karl-Heinz<br />
Schneider zu ihrem Ehrenvorsitzenden gewählt.<br />
Gudrun Mallik<br />
ist jetzt von Geschäftsführer Martin Röckenschuß<br />
für ihre 40-jährige Treue zur Gerhard<br />
Mann GmbH & Co. KG im niederbayerischen<br />
Landshut geehrt worden. Dort hatte die beruf -<br />
liche Karriere der Jubilarin am 2.4.1979<br />
begonnen, als sie in dem Unternehmen eine<br />
Ausbildung zum Bürokaufmann<br />
(die weibliche<br />
Form dieser<br />
Berufsbezeichnung gab<br />
es damals noch nicht)<br />
begann. Dort ist sie<br />
heute Chefin der<br />
Stahlsparte, nachdem<br />
ihr 1998 Handlungsvollmacht<br />
und 2000<br />
Gesamtprokura erteilt<br />
worden waren. Als Mitglied der Geschäftsleitung<br />
ist sie nicht nur für die Weiterentwicklung der<br />
von ihr betreuten Sparte, sondern zudem alleinverantwortlich<br />
für ca. 30 Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter. Eine Ehrenurkunde der IHK Niederbayern,<br />
ein Blumenstrauß sowie eine finanzielle<br />
Anerkennung für die langjährige und erfolgreiche<br />
Arbeit rundeten im Rahmen einer kleinen<br />
Feier den Dank des Unternehmens ab.<br />
Andreas Kersch<br />
hat jetzt die neue Position als Geschäftsführer<br />
Supply-Chain-Management (SCM) bei der Wuppermann<br />
Stahl GmbH übernommen. In dieser<br />
Funktion koordiniert er für das Familienunternehmen<br />
gruppenübergreifend die Versorgungskette.<br />
Der SCM-Experte berichtet direkt an<br />
Johannes Nonn, Vorstandssprecher der Wuppermann<br />
AG. Andreas Kersch hat seine gesamte<br />
berufliche Laufbahn im Bereich Supply-Chain-<br />
Management verbracht. Seit 2012 hatte der 45-<br />
Jährige fast durchgehend Positionen als<br />
Geschäftsführer inne. Fünf Jahre sammelte<br />
Kersch bei ArcelorMittal<br />
Erfahrungen in der<br />
Stahlbranche, davon<br />
die meiste Zeit in<br />
China. Insgesamt<br />
lebte der dreifache<br />
Familienvater zehn<br />
Jahre in der Volksrepublik.<br />
Die Wuppermann-Gruppe<br />
ist ein<br />
mittelständisches Unternehmen mit Sitz in<br />
Leverkusen, das seit über 145 Jahren in der<br />
Stahlverarbeitung tätig ist. Die Wuppermann-<br />
Gruppe hat derzeit fünf Produktionsstandorte<br />
und beschäftigt etwa 800 Mitarbeiter.<br />
Foto: Wuppermann<br />
Burkhard Dahmen<br />
ist neuer Präsident der METEC. Die internationale<br />
Metallurgie-Fachmesse mit Kongressen findet<br />
als Teil der Marke „The Bright World of<br />
Metals“ das nächste Mal vom 25.-29.6.19 in<br />
Düsseldorf statt. Zu dem Event gehören auch<br />
noch die Fachveranstaltungen zur GIFA, zur<br />
Thermprocess und zur NEWCAST. Der gebürtige<br />
Düsseldorfer, Vorsitzender der Geschäftsführung<br />
der SMS group GmbH, wurde Anfang April<br />
in das Präsidentenamt berufen. Diese Neubesetzung<br />
war notwendig geworden, nachdem der<br />
frühere METEC-Präsident Guido Kleinschmidt<br />
den Düsseldorfer Anlagenbauer verlassen hatte.<br />
Die im Frühsommer anstehende Großveranstaltung<br />
soll wieder die gesamte Welt der Metalle<br />
aufzeigen und dabei alle Aspekte um das weite<br />
Themenspektrum der Metallurgie, der Gießereitechnik<br />
(GIFA), der Thermoprozesstechnik und<br />
der Gussprodukte (NEWCAST) abdecken.<br />
Emilio Braghi<br />
ist neuer Vorsitzender im europäischen Aluminiumverband<br />
(EA). Der Neue, Senior Vice President<br />
und Präsident von Novelis Europe, übernahm<br />
dort für zwei Jahre zum 1.1.19 den Vorsitz<br />
von Kjetil Ebbesberg (Hydro). Darüber hinaus<br />
wählten die Mitglieder auf der EA-Generalversammlung<br />
Roberta Niboli (Raffmetal) zur stellvertretenden<br />
Vorsitzenden und Peter Basten<br />
(Constellium) zum Schatzmeister.<br />
Daniel Guinabert<br />
hat Anfang April Georges Kirps als Generaldirektor<br />
von EUROMETAL abgelöst. 15 Jahre lang<br />
hatte der Luxemburger Kirps die traditionsreiche<br />
Vertretung des europäischen Stahlhandels in<br />
seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen –<br />
von den Tradern über die Lagerhaltung bis zur<br />
Anarbeitung – repräsentiert. Der neue Mann an<br />
4 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Foto: Eurometal<br />
der Spitze des von den nationalen Organisationen<br />
getragenen Verbands, französischer Staatsbürger,<br />
hat mit seinem Amtsantritt seine bisherigen<br />
Funktionen bei ArcelorMittal Distribution<br />
Services aufgegeben. Der ausgeschiedene<br />
Generaldirektor bleibt Eurometal als Berater<br />
erhalten. Seit Ende 2017 gehört der Bundesverband<br />
deutscher Stahlhandel dem europäischen<br />
Branchenverbund nicht mehr an.<br />
Martin Reinke<br />
ist Nordwest-Hauptbereichsleiter IT & E-Business<br />
– und in dieser Funktion stolz darauf, dass<br />
die digitale Archivierung der in Dortmund ansässigen<br />
Verbundgruppe von unabhängigen Wirtschaftsprüfern<br />
nach Prüfungsstandard PS 951<br />
(Typ 2) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in<br />
Deutschland e.V. genauestens unter die Lupe<br />
genommen worden ist und wirksame Kontrollen<br />
bescheinigt werden konnten. „Das freut uns und<br />
zeigt unseren Handelspartnern, dass unsere<br />
Digitalisierungsmaßnahmen zukunftsfähig und<br />
nachhaltig organisiert sind“, so Reinke (r.). Er<br />
nahm das Zertifikat dazu stellvertretend für sein<br />
30 Personen starkes Projektteam von Martin<br />
Uebelmann entgegen, Partner für IT- & Controls-<br />
Assurance bei den unabhängigen Wirtschaftsprüfern<br />
Baker Tily.<br />
Fotos: Dirk Martin/Saarstahl AG<br />
rohstoffe und Entsorgung (bvse). An der Spitze<br />
von EuRIC steht als neu gewählte Präsidentin<br />
die Italienerin Cinzia Vezzosi. Die – neben Thomas<br />
Braun – weiteren zwei Vizepräsidenten<br />
stammen aus Spanien (Alicia Garcia-Franco)<br />
bzw. aus Frankreich (Jean Philippe Carpentier)<br />
und wurden wiedergewählt.<br />
Fotos: Dirk Martin/Saarstahl AG<br />
Reinhard Störmer und<br />
Martin Baues<br />
sind die Neuen mit wirtschaftlicher und technischer<br />
Verantwortung an der Spitze der saarländischen<br />
Stahlindustrie. Mit Reinhard Störmer<br />
wurde im März der Nachfolger des kurz zuvor<br />
verstorbenen Dr. Michael H. Müller zum Vorsitzenden<br />
des Kuratoriums der Montan-Stiftung-<br />
Saar gewählt; er gehört dem Gremium seit 2010<br />
an und war seit 2016 dessen stellvertretender<br />
Vorsitzender. Außerdem hat der Aufsichtsrat<br />
von Dillinger Martin Baues für fünf Jahre zum<br />
Mitglied des Vorstands mit technischer Verantwortung<br />
ernannt; ebenfalls für fünf Jahre ist der<br />
59-jährige Mitglied der Geschäftsführung der<br />
SHS – Stahl-Holding Saar. Unterdessen ist der<br />
56-jährige Dr. Bernd Münnich mit sofortiger Wirkung<br />
aus dem Vorstand von Dillinger sowie als<br />
SHS-Geschäftsführer ausgeschieden. Die Montan-Stiftung<br />
verfolgt das Ziel, unter dem Dach<br />
der Holding das Zusammenwachsen der Unternehmen<br />
Dillinger und Saarstahl voranzubringen.<br />
Thomas Braun<br />
ist im März auf der Generalversammlung der<br />
EuRIC – European Recycling Industries Confederation<br />
in Brüssel von den 34 nationalen Recyclingverbänden<br />
einstimmig zum Vizepräsidenten<br />
dieser europäischen Interessenvertretung der<br />
Branche gewählt worden. Braun ist Geschäftsführer<br />
im deutschen Bundesverband Sekundärdem<br />
Programm Lantek 4.0, mit dem das Unternehmen<br />
seine Führungsposition auf dem Markt<br />
festigen und sein klares Bekenntnis zur digitalen<br />
Transformation der Metallindustrie untermauern<br />
möchte. Asla Vicente hat einen Abschluss in<br />
Betriebswirtschaft und Management der Universidad<br />
de Deusto, Bilbao, und verfügt über 16<br />
Jahre Erfahrung in Leitungspositionen in<br />
Betriebsführung und Finanzen multinationaler<br />
Industrieunternehmen. Das hat die Lantek Systemtechnik<br />
GmbH in Darmstadt mitgeteilt.<br />
Alexandra und Ralf Tschorn<br />
weiten ihr Engagement zur Armutsbekämpfung<br />
in Indien aus: „Ich freue mich sehr, dass wir in<br />
Zusammenarbeit mit BREADS Bangalore nun die<br />
Möglichkeit haben, auch den ärmsten Kindern<br />
und Jugendlichen in Indien eine Chance im<br />
Leben zu geben“, sagte dazu Ralf Tschorn. Er ist<br />
Geschäftsführer der Tschorn GmbH in Urbach,<br />
die auf die Herstellung von Mess- und Spannmitteln<br />
für die zerspanende Industrie spezialisiert<br />
ist. Alexandra und Ralf Tschorn haben bereits<br />
seit über zehn Jahren Patenkinder in Indien. Auf<br />
einer der so begründeten Reisen traf Ralf<br />
Tschorn den Organisator der Hilfsorganisation<br />
Breads (Bangalore Rural Educational and Development<br />
Society), den er nach Deutschland einlud,<br />
um mit ihm Ende März in Urbach die Details<br />
der künftigen Zusammenarbeit zu besprechen.<br />
Frank Poschen<br />
hat das Zukunftskonzept der Schoeller Werk<br />
GmbH & Co. KG vorgestellt. Das Unternehmen<br />
mit Sitz in Hellenthal in der Eifel sieht sich als<br />
einer der weltweit führenden Hersteller von<br />
längsnahtgeschweißten Edelstahlrohren. Kern<br />
des Zukunftskonzepts sind umfangreiche Maßnahmen<br />
zu Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen<br />
sowie die Erschließung neuer Märkte.<br />
Foto: Nordwest<br />
Foto: Lantek<br />
Unai Asla Vicente<br />
heißt der neue Finanzdirektor von Lantek, einem<br />
spanischen Unternehmen, das sich als multinationaler<br />
Vorreiter in der digitalen Transformation<br />
der Blech- und Metallindustrie sieht. Der Neue<br />
ist zugleich Mitglied<br />
des Führungsstabs<br />
unter der Leitung von<br />
Lantek-Geschäftsführer<br />
Alberto López de<br />
Biñaspre. Die Personalie<br />
Unai Asla Vicente<br />
ist Teil der Unternehmensstrategie<br />
und<br />
steht in Einklang mit<br />
Hans-Jürgen Alfort<br />
ist im Januar 2019 nach kurzer Krankheit<br />
gestorben. Er war Ehrenvorsitzender der<br />
Qualitätsgemeinschaft für Oberflächenveredelung<br />
– GSB International. Seit der konstituierenden<br />
Sitzung der GSB im November<br />
1976 war der nun Verstorbene der Arbeit<br />
dieser Organisation eng verbunden. Sein Ziel<br />
war es, die gütegesicherte Qualität zur industriellen<br />
Farbbeschichtung von Aluminiumund<br />
Stahlbauteilen konsequent weiterzuentwickeln<br />
und stets gemäß dem Stand der<br />
Technik mit viel Energie voranzutreiben.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
5
Stahlhandel<br />
Bericht<br />
Andernach & Bleck – traditionsreicher Mittelständler und Global Player<br />
Auf dem Weg in die Zukunft<br />
Foto: Andernach & Blcek<br />
Der technologische Wandel birgt für Industrieunternehmen ein großes Potenzial, heißt es derzeit<br />
oft pauschal. Doch es sind vor allem die Akteure und mit ihnen die Märkte, die im Wandel sind. Ein<br />
erfolgreiches Industrieunternehmen in die Zukunft zu führen, verlangt neben technologischer<br />
Aufgeschlossenheit deshalb auch eine Portion „old school“ – ein fein justiertes Marktgefühl und<br />
einen guten Draht zu Kunden und Partnern. Ein Vorzeigebeispiel für diese Mischung aus Tradition und<br />
einem Gespür für veränderte Bedingungen ist der Hagener Blankstahlspezialist Andernach & Bleck.<br />
Nach großer weiter Welt<br />
klingt es nicht: Hagen. Und doch ist<br />
die Stadt nichts Geringeres als der<br />
Geburtsort eines musikalischen<br />
Ereignisses mit großer Strahlkraft:<br />
der Neuen Deutschen Welle. In der<br />
Stadt am Rande des Ruhrgebiets ist<br />
etwa Sängerin Nena groß geworden,<br />
die Bands Extrabreit und Grobschnitt<br />
haben hier ihre Wurzeln. Das war<br />
in den 1980er-Jahren und ist lange<br />
her. Auf einer anderen großen, sogar<br />
weltweiten Bühne, wenn auch mit<br />
weniger Rampenlicht, spielt ein<br />
anderes, noch viel älteres „Kind“ der<br />
Stadt: der Blankstahl-Spezialist<br />
Andernach & Bleck.<br />
Die Andernach & Bleck-Gruppe<br />
gehört zu den traditionsreichen<br />
industriellen Mittelständlern, die<br />
mit ihrer speziellen Kompetenz weltweit<br />
aktiv sind. Das inhabergeführte<br />
Unternehmen mit seinen über 200<br />
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen<br />
ist ein seit Jahrzehnten gefragter<br />
und etablierter Produzent für gezogenen<br />
Blankstahl. Vom Standardprofil<br />
bis zum Spezialprodukt — mit<br />
seinem Programm beansprucht die<br />
Andernach & Bleck GmbH & Co. KG<br />
auf dem deutschen Markt Alleinstellung.<br />
Während andere Blankstahl-Ziehereien<br />
vor allem auf rundes Material<br />
fokussieren, liegt die Stärke der<br />
Hagener Unternehmensgruppe beim<br />
kantigem Flachstahl. „Flach-Profile<br />
in den mittleren bis großen Abmessungen<br />
sind unsere Domäne. In diesem<br />
Spektrum verfügen wir über<br />
eine breite und tiefe Produktpalette,<br />
die einzigartig in Deutschland ist“,<br />
sagt Carsten Bleck, CEO und Shareholder<br />
der Andernach & Bleck GmbH<br />
& Co. KG.<br />
Insgesamt über 9.000 verschiedene<br />
Artikel bietet das Unternehmen<br />
seinen Kunden, über das gesamte<br />
Profilspektrum von flach über rund<br />
und sechskant bis hin zu individuellen<br />
Formen.<br />
Spitzenplatz in der<br />
Blankstahl-Technologie<br />
Nicht nur beim Programm sieht sich<br />
das Unternehmen in einer Spitzenposition.<br />
Die eigentliche Stärke ist<br />
vor allem die technologische Kompetenz<br />
in der gesamten Produktionskette<br />
für gezogenen Blankstahl.<br />
Dafür hat der Spezialist handfeste<br />
Argumente auf seiner Seite: Als einziges<br />
Unternehmen in Europa verfügt<br />
die Andernach & Bleck-Gruppe<br />
nach eigener Einschätzung über das<br />
Knowhow zur Wärmebehandlung<br />
von blankgezogenen Stäben zur Einstellung<br />
von magnetischen Kennwerten<br />
– unter anderem etwa für<br />
den Einsatz in der Automobilindustrie.<br />
„Diesen Prozess haben wir voll<br />
im Griff und nehmen eine starke<br />
6 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Position im Markt ein“, stellt der<br />
CEO heraus.<br />
So lautet der jüngst entwickelte<br />
neue Marken-Claim des Unternehmens<br />
quasi folgerichtig „Blankstahl<br />
ist unsere DNA“ – und hebt gleichzeitig<br />
auf die lange, bis 1903 zurückreichende<br />
Erfahrung der Gruppe in<br />
der Blankstahl-Technologie ab. Als<br />
Dipl.-Ing. der Produktionstechnik<br />
hat auch Carsten Bleck den Blankstahl<br />
sozusagen im Blut – und folglich<br />
nicht nur die betriebswirtschaftlichen<br />
Kennzahlen im Blick, sondern<br />
auch die technischen Prozesse bis<br />
ins Detail.<br />
Ein aktuelles Beispiel für das<br />
technologische Know-how wie für<br />
seine Marktkenntnis hat das Unternehmen<br />
erst Ende des letzten Jahres<br />
gezeigt – als es sein Programm um<br />
die Abmessung 550 mm x 55 mm<br />
erweitert hat – eine technische Entwicklung<br />
aus dem eigenen Haus.<br />
Das klingt nach einer „einfachen“<br />
Erweiterung des Abmessungsspektrums,<br />
denn bisher war bei 500 x<br />
50 mm Schluss, ist aber ein Alleinstellungsmerkmal<br />
im europäischen<br />
Markt. Alles darüber hinaus konnte<br />
nur gefräst hergestellt werden. Doch<br />
mit der Erweiterung des Spektrums<br />
kann Andernach & Bleck Anwendern<br />
mit einer gezogenen Variante<br />
nun eine kostengünstigere Alternative<br />
zur Verfügung stellen. „Wir<br />
haben uns das Produkt genau angesehen<br />
– und eine Möglichkeit<br />
erkannt, unseren Kunden eine<br />
attraktive Alternative zur bisherigen<br />
Materialauswahl anzubieten sowie<br />
zugleich unsere Marktposition zu<br />
stärken“, erläutert André Kieselbach,<br />
Leiter des nationalen Vertriebs. „Dieses<br />
Beispiel zeigt, dass wir als Blankstahl-Hersteller<br />
dem Bedarf nicht<br />
nur folgen, sondern mit unserem<br />
Know-how Märkte auch schaffen<br />
können“, ergänzt Ioannis Douvartzidis,<br />
CPO und Leiter des Vormaterialeinkaufs.<br />
Blankstahl-Märkte<br />
sind im Wandel<br />
Doch das Geschäft mit Commodity-<br />
Produkten lohnt sich tendenziell<br />
immer weniger. In dieser Produkt -<br />
range ist der internationale Wettbewerb,<br />
etwa aus Asien, sehr stark und<br />
drängt auch auf den deutschen und<br />
europäischen Markt. „Angesichts<br />
dieser Veränderungen ist es unser<br />
Ziel, noch tiefer in die Sonderprofile<br />
einzusteigen“, erläutert Bleck.<br />
Diese Marschrichtung liegt auf<br />
der Hand, sind doch bei Commodity-<br />
Produkten die Margen schmal. „In<br />
den letzten beiden Jahren sind die<br />
Geschäfte mit Standardprodukten<br />
dank der guten Konjunktur zwar gut<br />
gelaufen. Doch in der Tendenz gerät<br />
dieses Geschäft schon seit Jahren<br />
Produktionshalle<br />
der Andernach &<br />
Bleck GmbH & Co.<br />
KG am Standort<br />
Hagen: über 9.000<br />
Artikel hat der Blankstahl-Spezialist<br />
für<br />
seine Kunden im<br />
Programm.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
7
Stahlhandel<br />
Bericht<br />
immer mehr unter Druck", erklärt<br />
Bleck weiter. 80.000 t setzt das<br />
Unternehmen in normalen Jahren<br />
insgesamt um.<br />
Daher haben er und sein Führungsteam<br />
schon vor einigen Jahren<br />
begonnen, die Gruppe in ihrer Ausrichtung<br />
neu zu justieren. So hat sich<br />
das Verhältnis von Massengeschäft<br />
und Sonderprodukten bei dem Blankstahl-Produzenten<br />
deutlich gewandelt.<br />
Waren es früher 80 % Standardund<br />
20 % Sonderprodukte, hat sich<br />
das Verhältnis heute bei 65:35 eingependelt.<br />
„Etwa 7.000 t Commodity-<br />
Produkte sind ab Lager verfügbar,<br />
die an Händler in ganz Europa gehen.<br />
Der Rest sind Sonderprodukte und<br />
Sonderabmessungen, die auf individuellen<br />
technischen Spezifikationen<br />
der Kunden beruhen. Diese Richtung<br />
möchten wir weiter forcieren“, sagt<br />
Carsten Bleck.<br />
Zu einem reinen Anbieter für<br />
Sonderprodukte will sich der Hagener<br />
Mittelständler jedoch nicht entwickeln:<br />
„Wir benötigen beide Produktgruppen“,<br />
betont Carsten Bleck.<br />
Anders wäre die notwendige Auslastung<br />
des Maschinenparks gar<br />
nicht zu erreichen. Geht es darum,<br />
das Material vorab weiter anzuar-<br />
Das Andernach & Bleck-Programm umfasst alle Profilformen –<br />
von vierkant über rund bis sechskant und invididuelle Formen.<br />
beiten, werde der Weg weiterhin<br />
über den Handel gehen.<br />
Exportgeschäft<br />
erfolgreich aufgebaut<br />
Angesichts der Veränderungen der<br />
Blankstahl-Märkte hat sich Andernach<br />
& Bleck deutlich stärker auf<br />
internationale Märkte ausgerichtet.<br />
Während das Unternehmen mit Lieferungen<br />
in die BeNeLux-Länder,<br />
nach Österreich und in die Schweiz<br />
seit jeher grenznah aktiv ist, hat<br />
man vor etwa fünfzehn Jahren begonnen,<br />
das eigentliche internationale<br />
Geschäft voll zu entwickeln. „Wir<br />
haben auf den internationalen Märkten<br />
großes Potenzial für unsere Produkte<br />
und unser Know-how gesehen.<br />
Mit dieser Strategie sind wir sehr<br />
erfolgreich und heute weltweit vertreten“,<br />
erklärt Tobias Blankennagel,<br />
Leiter des internationalen Vertriebs.<br />
Seit 2009 gehört auch der italienische<br />
Blankstahl-Hersteller Metalli<br />
Trafilati S.R.L. zur Gruppe. Das<br />
Unternehmen nordöstlich von Mailand<br />
bedient mit seinen blankgezogenen<br />
Winkelstählen eine spezielle<br />
Nische und erweitert das Produktspektrum<br />
der Gruppe. Mit der breitesten<br />
Produktpalette Europas, die<br />
Foto: Andernach & Blcek<br />
im Norden die im Norden Italiens<br />
hergestellt werden, ist Metalli Trafilati<br />
einer von lediglich zwei Anbietern<br />
dafür in Europa – und verfügt<br />
über einen hohen Marktanteil von<br />
etwa 70 – 80 %.<br />
Gruppenweit gehen heute etwa<br />
30 bis 35 % der Produktion in das<br />
internationale Geschäft, in die europäischen<br />
Länder, aber auch beispielsweise<br />
in die USA und China. Dabei<br />
setzt Andernach & Bleck pro Land<br />
oder Region auf durchschnittlich<br />
etwa zwei bis drei Schwerpunkthändler.<br />
Daneben beliefert die Unternehmensgruppe<br />
aber auch eine<br />
Reihe von Nischenhändlern, die wiederum<br />
Kunden bedienen, die für die<br />
Gruppe oder ihre Partner aber zu<br />
spezialisiert sind, um sie wirtschaftlich<br />
sinnvoll zu erreichen.<br />
Vertriebskanäle<br />
verschieben sich<br />
Der klassische Vertriebsweg von<br />
Andernach & Bleck führt zum großen<br />
Teil über den Handel zum Endkunden.<br />
Unmittelbaren Zugang zu den<br />
regionalen Märkten in Deutschland<br />
hat der Blankstahl-Produzent mit<br />
seinen zwei eigenen Stahlhandelshäusern.<br />
Die Roland Stahl GmbH,<br />
Bremen, deckt den norddeutschen<br />
Raum ab, in Ostdeutschland beliefert<br />
die Heine & Bleck Stahlhandel<br />
GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen<br />
mit dem süddeutschen Handelshaus<br />
Heine + Beisswenger, die<br />
Verbraucher.<br />
Während der Weg über den Handel<br />
als sinnvoller, wirtschaftlicher<br />
Vertriebskanal bislang im Markt als<br />
gesetzt galt, verschieben sich die<br />
Marktverhältnisse langsam – und<br />
das nicht erst seit „Buzzwords“ wie<br />
„Industrie 4.0“ und „Digitalisierung“<br />
die Runde machen.<br />
„Viele Verbraucher sind mit<br />
ihrem Geschäft in den letzten Jahren<br />
– weltweit – stark gewachsen. Nun<br />
wächst in den betreffenden Unternehmen<br />
die dahinter stehende Organisationsstruktur<br />
nach – organisch<br />
und auf eine gesunde Weise. In dieser<br />
Situation kommen Kunden auf<br />
uns zu und möchten das im Volumen<br />
größere Geschäft nun direkt<br />
machen“, erläutert Carsten Bleck.<br />
„Die gestiegenen Mengen machen<br />
8 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
es für sie wirtschaftlich sinnvoll, das<br />
Handling selbst in die Hand zu nehmen.“<br />
Baustein des Erfolgs –<br />
langfristige Partnerschaften<br />
Für Andernach & Bleck ist das größer<br />
werdende Direktgeschäft eine<br />
Herausforderung – nicht in den Produktionsprozessen,<br />
doch die Komplexität<br />
der Logistik nimmt deutlich<br />
zu. Gleichzeitig befindet sich die<br />
Gruppe durch diese Entwicklung in<br />
einer schwierigen Sandwich-Situation:<br />
Einerseits die Tendenz, größere<br />
Mengen nicht mehr über den Handel<br />
abzuwickeln, andererseits den Handel<br />
als wichtigen Partner für den Vertrieb<br />
der Standardprodukte zu halten.<br />
„In dieser Situation kommt uns zu<br />
Gute, dass wir auch noch ein wenig<br />
‚old school‘ sind“, so André Kieselbach.<br />
Noch zählt der persönliche Kontakt<br />
zu den Ansprechpartnern sowohl<br />
bei Kunden wie bei Lieferanten, denn<br />
der persönliche Austausch ist eine<br />
wichtige Informationsquelle und<br />
zugleich ein Instrument, das gegenseitige<br />
Vertrauensverhältnis zu pflegen.<br />
„Unser Geschäft baut auf seit<br />
Jahrzehnten bestehenden Beziehungen<br />
zu unseren Kunden und Lieferanten<br />
auf“, so André Kieselbach.<br />
Doch die bestehenden, gewachsenen<br />
Verbindungen weichen mehr<br />
und mehr standardisierter Kommunikation,<br />
gleichzeitig nimmt die<br />
Geschwindigkeit der Prozesse zu.<br />
„Wir müssen auf diese Anforderungen<br />
reagieren und uns so aufstellen,<br />
dass sich unsere Kernkompetenz<br />
weiter lohnt“, sagt Carsten Bleck.<br />
Dabei ist der Handel ein wichtiger<br />
Partner für die Gruppe. „Wenn wir<br />
mit einem Händler – in welcher<br />
Region auch immer – kooperieren,<br />
werden wir nicht an ihm vorbei handeln.<br />
Es geht uns immer um eine<br />
Partnerschaft. Wir sind langfristig<br />
und nachhaltig orientiert und sehen<br />
die Zusammenarbeit als ein Vertrauensverhältnis“,<br />
so André Kieselbach.<br />
Um seine Partner in der Zusammenarbeit<br />
zu stärken, unterstützt<br />
sie das Unternehmen – etwa durch<br />
technische Beratung bei einergeplanten<br />
Programmerweiterung oder einer<br />
gemeinsamen technischen Vorort-<br />
Foto: BDS/mh<br />
Führen die Andernach & Bleck-Gruppe in die Zukunft: CEO Carsten Bleck (3.v.l.) und sein Team (v.l.),<br />
Tobias Blankennagel (COO international), André Kieselbach (COO national) und Ioannis Douvartzidis (CPO).<br />
Betreuung. „Für unsere Handelspartner<br />
gilt: Lieber Partner, wenn Du<br />
einen Kunden hast, der ein Problem<br />
hat, das Du nicht lösen kannst, komm<br />
zu uns! Wir helfen Dir“, erläutert<br />
Carsten Bleck.<br />
Foto: Andernach & Blcek<br />
Mehr Know-how<br />
in die Projekte einbringen<br />
„Uns geht es darum, für unsere Kunden<br />
noch stärker als Problemlöser<br />
zu agieren“, erläutert Carsten Bleck<br />
die Strategie. Dafür sieht er die<br />
Gruppe bestens aufgestellt. „Wir<br />
bringen alle nötigen Voraussetzungen<br />
mit: technologisches Knowhow<br />
in der Herstellung und Bearbeitung<br />
von Blankstahlprodukten, ein tiefes<br />
Verständnis des Marktes und der<br />
Bedürfnisse unserer Kunden sowie<br />
genügend Agilität in den Entscheidungsprozessen“,<br />
ist Carsten Bleck<br />
überzeugt.<br />
Agilität – das ist auch eines der<br />
Stichworte, die derzeit en vogue sind.<br />
Unternehmen sollen agil sein, schnell<br />
entscheiden und sich veränderten<br />
Anforderungen schnell anpassen<br />
können. Agilität hat in einem Industrieunternehmen,<br />
dessen Produkte<br />
einen komplexen Herstellprozess<br />
durchlaufen, zwar eine andere Bedeutung<br />
als etwa bei einem Softwareanbieter.<br />
Doch hängt die Fähigkeit,<br />
schnell entscheiden und reagieren<br />
zu können vor allem an der jeweiligen<br />
Organisation des Unternehmens.<br />
„Bei uns gibt es keine Gremien und<br />
keine langen Dienstwege. Muss<br />
etwas dringlich entschieden werden,<br />
wird direkt kommuniziert.<br />
Denn Neues entsteht in den Köpfen<br />
der Mitarbeiter", sagt Carsten<br />
Bleck. 2<br />
[ Kontakt]<br />
Andernach & Bleck<br />
GmbH & Co. KG<br />
58093 Hagen<br />
Tel. +49 2331 3530<br />
www.blankstahl.biz<br />
Blankstahl-Produktion mit langer Tradition: Am Stammsitz in Hagen<br />
stellt Andernach & Bleck seit 1903 blankgezogene Stahlprodukte her.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
9
Stahlhandel<br />
Bericht<br />
Fotos: Padersoft SE<br />
Im Stahlhandel gilt<br />
es, verschiedene<br />
Disziplinen per<br />
Warenwirtschaftssystem<br />
in Einklang<br />
zu bringen: Dazu<br />
muss auch die<br />
Unternehmensoftware<br />
ausgelegt sein.<br />
Die Ullner u. Ullner<br />
GmbH in Paderborn<br />
arbeitet jetzt mit<br />
UNITRADE.<br />
Ullner u. Ullner führt neue Handelssoftware ein<br />
Ein richtiger Schritt nach vorn<br />
Mit der Einführung der UNITRADE®-Softwaremodule beim Großhandelsunternehmen<br />
Ullner u. Ullner wurden alle Prozesse nach modernen Standards getaktet. Mit dem<br />
neuen Warenwirtschafts system der Padersoft SE ist Josef Bröckling, Geschäftsführer<br />
der Ullner u. Ullner GmbH in Paderborn, sehr zufrieden. Unter anderem lassen sich nun<br />
Dienstleistungen verschiedener Bereiche in einer Bestellung zusammenführen.<br />
[ Kontakt ]<br />
Ullner u. Ullner GmbH<br />
33098 Paderbon<br />
Tel.: +49 5251 7104-0<br />
www.ullner.de<br />
SE Padersoft<br />
GmbH & Co. KG<br />
33100 Paderborn<br />
Tel.: +49 5251 3016100<br />
www.unitrade.de<br />
Als spezialisierter Großhandelsbetrieb<br />
ist die Paderborner Ullner<br />
u. Ullner GmbH Ansprechpartnerin<br />
für Industrie und Handwerk<br />
in der Region. Mit spezifischen Sortimenten,<br />
angegliederten Dienstleistungen<br />
und fundiertem Know-how<br />
werden metallverarbeitende Produktions-<br />
und Handwerksbetriebe versorgt.<br />
Stahlprodukte sind komplex<br />
Die Zahl der Produkte und die damit<br />
verbundenen Services, wie das<br />
Zuschneiden, Anarbeiten oder Veredeln,<br />
liegt laut Geschäftsführer Josef<br />
Bröckling im oberen sechsstelligen<br />
Bereich. Um auf die vielen Produktdaten,<br />
etwa Nummern, Gruppen,<br />
Abmessungen, Gewichte, Lieferzeiten<br />
oder Stahl-Prüfzeugnisse ohne<br />
Verzögerung schnell zugreifen zu<br />
können, müssen sie entsprechend<br />
gepflegt und verwaltet werden. Das<br />
geht heute nur noch mit einem leistungsfähigen<br />
ERP-System. Gerade<br />
die Abbildung von Stahlprodukten<br />
innerhalb der Warenwirtschaft ist<br />
komplex. Für Ullner u. Ullner ist es<br />
unabdingbar, permanent eine<br />
sichere und reibungslose Bestellabwicklung<br />
– etwa mit dem E/D/E-<br />
Zentrallager – sowie auch alle vorund<br />
nachgelagerten Prozesse jederzeit<br />
verfügbar zu haben.<br />
Um zukunftsgerichtet aufgestellt<br />
zu sein, wurde die bis dato eingesetzte<br />
Anwendung nun durch die<br />
UNITRADE-Produkte der SE Padersoft<br />
GmbH & Co. KG abgelöst. „Unser<br />
Eindruck war, dass das bisher eingesetzte<br />
Warenwirtschaftsprogramm<br />
nicht in der Art weiterentwickelt<br />
werden würde, wie wir es<br />
uns für die Erfüllung unserer Ziele<br />
gewünscht hätten“, erläutert Bröckling.<br />
Dass der neue Anbieter nun<br />
ebenfalls in der Paderstadt ansässig<br />
ist: ein schöner Zufall. Doch entscheidend<br />
waren allein Leistung und<br />
Funktionen der Software – und dabei<br />
fiel die Wahl letztlich auf SE Padersoft.<br />
Für den ausschlaggebenden<br />
Impuls sorgte beim Metalllieferanten<br />
und Betriebsausstatter dessen Branchenexpertise<br />
„Stahlhandel“.<br />
Effektiv planen und steuern<br />
Insbesondere die speziellen Anforderungen<br />
im Tagesgeschäft und die<br />
Relevanz geeigneter Software für<br />
Einkauf und Controlling waren für<br />
das Unternehmen Gründe, in ein<br />
neues System zu investieren. Es<br />
schien, als ob die gewünschten Auswertungen<br />
und Statistiken mit der<br />
älteren Software nur schwer zu generieren<br />
gewesen wären, so Bröckling.<br />
Im Stahlgeschäft und auch in den<br />
10 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Der Stahlhandel erfordert<br />
eine integrierte Unternehmenssoftware,<br />
die den<br />
Datenaustausch zwischen<br />
den unterschied lichen<br />
Bereichen gewährleistet.<br />
übrigen Produktgruppen wollte das<br />
Unternehmen in der Lage sein, verschiedene<br />
Bereiche innerhalb einer<br />
Bestellung zusammenzuführen.<br />
Ordert etwa ein Handwerksbetrieb<br />
Berufsbekleidung, sollen in vielen<br />
Fällen auch das Firmenlogo und eine<br />
Personalisierung aufgebracht werden.<br />
Das Ergänzen eines „fixen“ Produkts<br />
mit einer Dienstleistung und<br />
dessen Abrechnung gehört zum<br />
Tagesgeschäft – auch im Stahlsegment,<br />
wo das Material individuell<br />
vielfach als Serviceleistung zugeschnitten<br />
wird.<br />
Dank der neuen UNITRADE-Software<br />
lassen sich solche Aufträge<br />
dem Unternehmen zufolge nun leicht<br />
abbilden und handhaben. Auch können<br />
Preisaktionen oder Rabatte<br />
selektiv individuell zugeschnitten<br />
werden.<br />
Vertrieb gestärkt<br />
Besonders das Auswertungstool<br />
„CUBE“ lobt Geschäftsführer Bröckling.<br />
Seine Vorgabe, neben aktuellen<br />
Zahlen auch auf Vergleichswerte aus<br />
der alten Umgebung zugreifen zu wollen,<br />
wurde voll erfüllt. Das Wesentliche<br />
aber sieht der Geschäftsführer darin,<br />
dass alle Vertriebskanäle, vom Ladenlokal<br />
über den Außendienst bis hin<br />
zu den elektronischen Katalogen nun<br />
deutlich besser funktionierten und<br />
zielgerichtete Ergebnisse ausgeben.<br />
Im Verkauf stehe damit ein leistungsfähiges,<br />
digitales Werkzeug zur Verfügung,<br />
das umfassende Produktinformationen<br />
auf den Punkt bereitstellt.<br />
Die neue Software soll sukzessive ausgebaut<br />
werden. Bereits in der Umsetzung<br />
befindet sich ein neuer B2B-<br />
Onlineshop, der bis Mitte des Jahres<br />
aktiviert werden soll. 2<br />
Hoberg & Driesch<br />
Bau des neuen Hochregallagers<br />
schreitet voran<br />
Seit Jahresbeginn hat sich auf der<br />
Baustelle des neuen Hochregallagers (HRL)<br />
der Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG Düsseldorf<br />
einiges getan. In der dafür errichteten<br />
Halle sind die Betonbodenplatten eingezogen,<br />
die Arbeiten an der Außenfassade so<br />
gut wie abgeschlossen und die Bedachung<br />
ist fertiggestellt. Ein weiterer großer Schritt<br />
in Richtung Fertigstellung folgte dann im<br />
April mit der Anlieferung und Montage von<br />
drei großen Brückenkranen. Per Sondergenehmigung<br />
wurden die Krane als Schwerlasttransport<br />
von Sassenberg nach Düsseldorf<br />
befördert. Sowohl die Montage der<br />
Krane als auch die der Hubwerke wurde<br />
Anlieferung und Montage an einem Tag: drei neue Brückenkrane für Hoberg & Driesch.<br />
noch am gleichen Tag vorgenommen. Ein<br />
Kran hat ein Spurmaß von 30,75 m und ein<br />
Gewicht von 23,5 t. Ein Hubwerk wiegt 2,7 t.<br />
Insgesamt bewegen sich auf den Kranschienen<br />
in Halle 11 zukünftig 3 x 28,9 t – plus<br />
die zu hebenden Lasten.<br />
Foto: Hoberg & Driesch<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
11
Stahlhandel<br />
Bericht/Nachricht<br />
Fotos: Nissen&Velten<br />
Inhaberin Rabea Hambach-Richter: „Wir haben die richtige Wahl getroffen und sind mit unserer neuen Unternehmenssoftware gut für die Zukunft aufgestellt.“<br />
August Richter setzt auf eNVenta ERP<br />
Stahlhandel und Biegerei in einer Software<br />
Der Stahlhandel August Richter setzt seit Anfang 2019 auf die Software eNVenta ERP von<br />
Nissen & Velten. Seitdem profitieren die 27 Mitarbeiter des Unternehmens, das mit Stahl,<br />
Werkzeugen, Beschlägen und Eisenwaren handelt und Bewehrungsstahl biegt, von integrierten<br />
Prozessen und modernen Benutzeroberflächen.<br />
Im kommenden Jahr steht<br />
für die August Richter, Eisen-Röhren-Eisenwaren-Großhandlung<br />
e.K.<br />
ein besonders Jubiläum an. Denn<br />
dann feiert das Stahlhandelsunternehmen<br />
aus Geseke seinen 90.<br />
Geburtstag. Anders als für uns<br />
natürliche Personen ist das für ein<br />
Unternehmen zwar eine respektable<br />
Zahl, aber kein Grund, nicht<br />
mit Tatkraft und Ideen in die<br />
Zukunft zu blicken.<br />
So hat Inhaberin Rabea Hambach-Richter,<br />
die den Stahlhandel<br />
in der dritten Generation führt, erst<br />
in jüngster Zeit das Geschäftsfeld<br />
Biegerei mit einer eigenen Produktionshalle<br />
und neuen Maschinen<br />
ausgebaut. Damit hat sie das Angebot<br />
der klassischen Stahlhandlung<br />
weiter verbreitert. An den Bau der<br />
neuen Halle schloss sich ein weite-<br />
res Projekt an: Die notwendig gewordene<br />
Einführung einer Branchensoftware<br />
für die Biegerei führte zur<br />
Suche gleich nach einem neuen ERP-<br />
System. Dies hatte sich als notwendig<br />
erwiesen, da die bestehende<br />
Unternehmenssoftware aktuellen<br />
Ansprüchen nicht mehr gerecht und<br />
auch nicht weiterentwickelt wurde.<br />
Integrierte Schnittstelle<br />
zum Einkaufsverbund<br />
Die neue Software-Lösung sollte die<br />
Branchenspezifika des Stahlhandels<br />
beherrschen und zugleich über<br />
Schnittstellen zur Verbundgruppe<br />
Nordwest verfügen. Ebenfalls sollte<br />
eine integrierte Finanzbuchhaltung<br />
Teil der Lösung sein. Die Biegereifunktionen<br />
hätte man sich in Geseke<br />
auch über eine Schnittstelle realisiert<br />
vorstellen können.<br />
Nach einer Marktrecherche von<br />
Geschäftsführerin Rabea Hambach-<br />
Richter haben drei Softwareanbieter<br />
ihre Lösungen vor Ort präsentiert,<br />
von denen zwei anschließend verworfen<br />
wurden. „Unsere neue Software<br />
sollte bei uns im Hause und<br />
nicht in der Cloud laufen und die<br />
Abhängigkeiten einer Branchenlösung<br />
auf Basis von Microsoft Navision<br />
wollten wir vermeiden“, erklärt<br />
Rabea Hambach-Richter. Schließlich<br />
war auch eine moderne, anwenderfreundliche<br />
Benutzeroberfläche der<br />
Software gefragt.<br />
Biegerei-Lösung nativ enthalten<br />
Ein Alleinstellungsmerkmal von<br />
eNVenta ERP ist hingegen die integrierte<br />
Lösung für die Biegerei. Weitere<br />
Pluspunkte sind die Möglichkeit<br />
des Zugriffs auf die Datenbank sowie<br />
12 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Augustus iocari saetosus fiducias, et syrtes libere senesceret suis. Saburre fe<br />
Aufgrund guter Nachfrage: Im vergangenen Jahr hat die Stahlhandlung<br />
August Richter in den Bau einer neuen Biegerei-Werkhalle investiert.<br />
die Option, mit der eNVenta-Entwicklungsumgebung<br />
Framework<br />
Studio eigenständig Anpassungen<br />
vornehmen zu können. So konnte<br />
die technisch versierte Geschäftsführerin<br />
mit der Software-Einführung<br />
Masken selbst anpassen, die<br />
Stammdaten aus dem alten System<br />
überprüfen und in eNVenta ERP<br />
übernehmen.<br />
Vor dem Echtstart am 1. Januar<br />
2019 wurden die Anwender von Nissen<br />
& Velten sowie von Rabea Hambach-Richter<br />
mit der neuen Software<br />
geschult. Einige Key User konnten<br />
vorab auch schon im Testsystem mit<br />
eNVenta arbeiten. Nach kleineren<br />
Anpassungen in den ersten Praxiswochen<br />
sind heute die Branchenlösungen<br />
Technischer Handel, Stahlhandel und<br />
Biegerei in Geseke im Einsatz. Zudem<br />
wird das eNVenta-Modul Kasse im<br />
Thekengeschäft genutzt.<br />
Biegerei-Pläne<br />
mit eNVenta erfassen<br />
Bereits im vergangenen Jahr hatte<br />
das Unternehmen August Richter<br />
aufgrund der großen Nachfrage eine<br />
neue Produktionshalle für den Biegereibetrieb<br />
gebaut – in der Bügelautomaten<br />
sowie Mattenschneideund<br />
Mattenbiegemaschinen eingesetzt<br />
werden. Die Biegepläne der<br />
Kunden werden heute von den Mitarbeitern<br />
im Büro in eNVenta erfasst.<br />
Anschließend werden die Biege-Etiketten<br />
mit Barcodes und die Stahlliste<br />
in der Produktionshalle ausgedruckt.<br />
Die Barcodes werden an den<br />
Maschinen eingelesen und die Fertigstellung<br />
der Aufträge anschließend<br />
an das ERP-System zurückgemeldet.<br />
Die Auslieferung erfolgt<br />
dann mit den fünf eigenen Lkw des<br />
Unternehmens.<br />
Als sehr komfortabel werde im<br />
Bereich Stahlhandel die Verwaltung<br />
von Stangenmaterial und die automatische<br />
Berechnung von Längen<br />
und Gewichten bewertet. Die Stückverwaltung<br />
von eNVenta Stahl wird<br />
bei August Richter für Träger und<br />
U-Stahl verwendet. Bereichsübergreifend<br />
verfüge das westfälische<br />
Unternehmen heute über bessere<br />
und einfacher zugängliche statistische<br />
Auswertungen. Geschätzt werden<br />
auch die automatische Buchung<br />
der Kontoauszüge sowie die Funktion<br />
der automatischen Lieferzuteilung,<br />
welche die Einlagerung von<br />
ankommenden Artikeln erspart, die<br />
sofort an einen Kunden ausgeliefert<br />
werden sollen. Die Schnittstellen zu<br />
Nordwest Handel werden vor allem<br />
für Bestellungen aus dem Nordwest<br />
Zentrallager verwendet.<br />
„Sehr schön ist auch“, sagt Rabea<br />
Hambach-Richter, „dass ich alle<br />
Dokumente die ich jemals im ERP-<br />
System erzeugt habe, seien es Angebote<br />
oder Rechnungen, auch später<br />
so sehen kann, wie der Kunde sie<br />
bekommen hat. Das heißt, bei Bedarf<br />
kann ich sie jederzeit zum Beispiel<br />
per Mail noch einmal an den Kunden<br />
schicken.“ 2<br />
[ Kontakt ]<br />
August Richter, Eisen-<br />
Röhren-Eisenwaren-<br />
Großhandlung e.K.<br />
59590 Geseke<br />
Tel. +49 2942 97870<br />
www.august-richter.de<br />
Nissen & Velten<br />
Software GmbH<br />
78333 Stockach<br />
Tel. +49 7771 8790<br />
www.nissen-velten.de<br />
Eisen Wagner in<br />
Österreich geschlossen<br />
ArcelorMittal hat die österreichische Eisen<br />
Wagner Gesellschaft m.b.H. geschlossen.<br />
Der weltweit größte Stahlkonzern hatte das<br />
Unternehmen am Standort Ried im Innkreis<br />
2008 übernommen und eigenen Angaben<br />
zufolge jahrelang versucht, auf die Erfolgsspur<br />
zu bringen. Seit der Übernahme haben<br />
sich österreichischen Medien zufolge<br />
jedoch 20 Mio. € Verlust angehäuft. Vor<br />
diesem Hintergrund entschloss sich Arcelor-<br />
Mittal, das Unternehmen zu schließen. An<br />
dem Standort waren knapp über 80 Mitarbeiter<br />
tätig.<br />
Weitere Standorte wie die Lasercenter in<br />
Hohenzell und Timelkam sowie die Betonstahl-Biegereien<br />
in Ried und Wöllersdorf sollen<br />
verkauft werden. Die Abteilung Dach<br />
und Wand wird innerhalb des ArcelorMittal-<br />
Konzerns weitergeführt. Das Stahlservice-<br />
Center Metex in Wien soll erhalten bleiben,<br />
den Vertrieb übernehme Frankstahl, hieß<br />
es. ArcelorMittal plant, den österreichischen<br />
Markt nun von Bayern aus zu<br />
beliefern. Als Grund für die Schließung<br />
gelten Überkapazitäten am Markt.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
13
Stahlproduktion<br />
Bericht<br />
Projekt zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion<br />
Wasserstoff statt Kohle<br />
thyssenkrupp Steel hat am Standort Duisburg ein Projekt für die klimafreundliche Stahlproduktion<br />
gestartet. Bei der Herstellung von Stahl will das Unternehmen künftig statt Kohle mehr Wasserstoff<br />
eingesetzen. Der Produzent verfolgt damit das langfristige Ziel, die bislang anfallenden CO 2 -Emissionen<br />
bis 2050 um mindestens 80 % zu verringern. Gefördert wird das Projekt im Rahmen der von der<br />
NRW-Landesregierung gestarteten Initiative IN4climate.NRW. Im April übergab NRW-Wirtschaftsund<br />
Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart den Förderbescheid.<br />
„Es ist mir eine besondere<br />
Freude, heute den Förderbescheid<br />
für das erste Projekt der Initiative<br />
IN4climate.NRW übergeben zu können“,<br />
sagte Wirtschafts- und Digitalminister<br />
Prof. Dr. Andreas Pinkwart<br />
bei der Überreichung im April.<br />
Damit gehe man einen wichtigen<br />
Schritt in Richtung einer klimaneutralen<br />
Industrie. Neben der thyssenkrupp<br />
Steel AG sind auch Air<br />
Liquide, ein weltweit agierendes<br />
Unternehmen für Industriegase,<br />
sowie die gemeinnüztige Düsseldorfer<br />
VDEh Betriebsforschungsinstitut<br />
GmbH an dem Projekt beteiligt.<br />
Meilenstein Wasserstoffprojekt<br />
Bei der Umstellung seiner Stahlproduktion<br />
geht thyssenkrupp Steel<br />
technologieoffen vor und nutzt verschiedene,<br />
sich ergänzende Ansätze.<br />
So können mit dem bereits erfolgreich<br />
gestarteten Projekt<br />
Carbon2Chem in der Stahlproduktion<br />
entstehende Treibhausgase in<br />
Chemieprodukte umgewandelt werden<br />
und sind so als wertvolle Rohstoffe<br />
nutzbar.<br />
Das Wasserstoffprojekt am Hochofen<br />
beschreitet einen weiteren Technologiepfad:<br />
Hier wird vermieden,<br />
dass schädliche Treibausgase überhaupt<br />
entstehen. Dies geschieht<br />
dadurch, dass ein Teil des im Hochofen<br />
als Reduktionsmittel eingesetzten<br />
Kohlenstaubes durch das Einblasen<br />
von Wasserstoff ersetzt wird.<br />
„Mit dem Einsatz von Wasserstoff<br />
an unserem Hochofen 9 arbeiten wir<br />
weiter konsequent an der Umstellung<br />
unserer Produktionsprozesse.<br />
Unser Ziel ist eine nahezu CO 2 -neutrale<br />
Stahlerzeugung. Dies wird ein<br />
langer und kostenintensiver Prozess,<br />
auf dem wir heute einen weiteren<br />
Schritt vorangehen“, erläuterte Arnd<br />
Köfler, Produktionsvorstand von<br />
thyssenkrupp Steel Europe. „Wie<br />
testen in dieser ersten Projektphase<br />
in den nächsten Monaten zunächst<br />
den Einsatz von Wasserstoff an einer<br />
von 28 Blasformen eines Hochofens.<br />
Das ist ein Novum und so bislang in<br />
der Industrie noch nicht umgesetzt<br />
worden. Wir werden die Ergebnisse<br />
dieser Testphase genau analysieren<br />
und wollen dann in einer zweiten<br />
Projektphase den gesamten Hochofen<br />
auf diese Weise umstellen,“<br />
ergänzte Köfler. „Theoretisch ist so<br />
ein Einsparpotenzial von rund 20 %<br />
CO 2 an dieser Stelle des Produktionsprozesses<br />
möglich. Wir sind sehr<br />
dankbar, dass die Landesregierung<br />
uns hier mit einer Förderung im Rah-<br />
Koks<br />
Auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Stahlproduktion testet<br />
thyssenkrupp Steel den Einsatz von Wasserstoff an einem bestehenden<br />
Hochofen. Die Grundidee besteht darin, die Menge der<br />
benötigten Einblaskohle zu reduzieren und durch Wasserstoff (H 2 )<br />
zu ersetzen, um so den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren.<br />
Erz<br />
Mengenreduktion<br />
CO 2<br />
-Reduktion<br />
Kohlenstaub<br />
Hochofen<br />
Stahlwerk<br />
Rohstahl<br />
Grafik: thyssenkrupp Steel AG<br />
H 2<br />
Wasserstoff<br />
14 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Stahl ∙ Edelstahl ∙ Anschlagrohre ∙ Bauelemente<br />
100 % Leistung<br />
bis zum Anschlag!<br />
Foto: thyssenkrupp Steel<br />
Gemeinschaftsprojekt mit dem Ziel einer klimafreundlichen Stahlproduktion. Von links:<br />
Michael Hensmann (BFI); Robert van Nielen, Geschäftsführer Large Industries bei Air<br />
Liquide; Premal Desai, Finanzvorstand thyssenkrupp Steel; Prof. Dr. Andreas Pinkwart,<br />
NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie; Dr. Arnd Köfler,<br />
Produktionsvorstand thyssenkrupp Steel; Gilles Le Van, Geschäftsführer Air Liquide<br />
Deutschland.<br />
men von IN4climate.NRW unterstützt.<br />
Mit Air Liquide für die Wasserstoffversorgung<br />
und dem BFI als<br />
wissenschaftlichen Begleiter des Projekts,<br />
haben wir genau die richtigen<br />
Partner an unserer Seite.“<br />
Wasserstoff: Schlüssel zu einer<br />
klimafreundlichen Zukunft<br />
Wasserstoff ist ein zentraler Treiber<br />
für die Erreichung von Klimaambitionen,<br />
da er am Einsatzort keine<br />
klimaschädlichen Emissionen verursacht.<br />
Er kann in flüssiger oder<br />
gasförmiger Form mit hoher Energiedichte<br />
gespeichert und transportiert<br />
werden und bietet so viele Einsatzmöglichkeiten.<br />
Aufgrund seiner<br />
Vielseitigkeit spielt Wasserstoff eine<br />
Schlüsselrolle beim Übergang zu<br />
einem sauberen, kohlenstoffarmen<br />
Energiesystem. In der Stahlherstellung<br />
kann Wasserstoff als emissionsfreies<br />
Reduktionsmittel für das<br />
Eisenerz verwendet werden.<br />
das wasserstoff-projekt im Detail<br />
z Projektdauer: 14 Monate<br />
z Projektbudget: 2,7 Mio. €<br />
z Förderung durch das Land in Höhe von 40 %<br />
Air Liquide, Projektpartner für das<br />
nun beginnende Wasserstoffprojekt<br />
bei thyssenkrupp Steel, verfügt<br />
über Expertise in der gesamten<br />
Wasserstoff-Wertschöpfungskette<br />
von der Produktion über die Speicherung<br />
bis hin zur Entwicklung<br />
von Endverbraucheranwendungen.<br />
Gilles Le Van, Vorsitzender der<br />
Geschäftsführung von Air Liquide<br />
Deutschland, sagte: „Hier in Duisburg<br />
wird nun ein bedeutendes<br />
Kapitel der industriellen Entwicklung<br />
aufgeschlagen: die schrittweise<br />
und nachhaltige Dekarbonisierung<br />
der Stahlerzeugung. Wir<br />
freuen uns sehr, an diesem Vorhaben<br />
mitzuwirken – zuerst im Testbetrieb,<br />
später im größeren Maßstab.<br />
Unser langjähriger Kunde und<br />
Partner thyssenkrupp Steel stellt<br />
wiederholt unter Beweis, wie eine<br />
innovative Industrie erfolgreich mit<br />
Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz<br />
einhergehen kann.“ 2<br />
z Einblasen von 25.000 Nm³ h bei einer Tagesproduktion von 4.600 t<br />
z 11,7 kg (131 m³) Wasserstoff je Tonne Roheisen<br />
z Einsparung von bis zu 19 % CO 2 je Tonne Roheisen<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
15<br />
Standard, Systeme, Anschlagrohre<br />
aus Edelstahl und das<br />
volle Zubehörprogramm.<br />
Bundesweit und immer zu<br />
mindestens 90 % auf Lager.<br />
Metallbau<br />
Stahlbau<br />
Fahrzeug- / Landmaschinen- /<br />
<br />
Maschinenschutzeinrichtung<br />
Maschinenbau und Anlagenbau<br />
Regalbau und Lagersysteme<br />
Containerbau<br />
Möbel- / Laden- / Innenausbau<br />
Klima- und Solartechnik<br />
Peter Drösser GmbH<br />
Ackerstraße 144<br />
51065 Köln<br />
Fon +49 221 6789-0<br />
info@droesser.de<br />
www.droesser.de
Stahlproduktion<br />
Bericht/Nachricht<br />
Arcelor-Mittal-Werk<br />
in Hamburg.<br />
Der weltgrößte<br />
Stahl hersteller<br />
plant dort eine<br />
Wasserstoff-<br />
Versuchsanlage.<br />
Foto: ArcelorMittal Germany<br />
ArcelorMittal-Anlage in Hambuger Werk<br />
Pilotanlage zur Direktreduktion geplant<br />
Um CO 2 -Emissionen dauerhaft zu senken, plant ArcelorMittal den Start eines Projekts<br />
im Hamburger ArcelorMittal-Werk, bei dem erstmals Wasserstoff großtechnisch<br />
bei der Direktreduktion von Eisenerz im Stahlproduktionsprozess eingesetzt wird.<br />
Eine Pilotanlage soll in den kommenden Jahren errichtet werden.<br />
Bereits heute hat das Hamburger<br />
Werk auf Grund des Einsatzes<br />
von Erdgas in einer Direktreduktionsanlage<br />
(DRI) eines der<br />
effizientesten Produktionsverfahren<br />
der ArcelorMittal-Gruppe. Ziel des<br />
neuen wasserstoffbasierten Verfahrens<br />
ist es, Stahl mit geringsten CO 2 -<br />
Emissionen herstellen zu können.<br />
Die Projektkosten betragen rund 65<br />
Mio. €. Außerdem ist eine Kooperationsvereinbarung<br />
mit der Universität<br />
Freiberg geplant, um das Verfahren<br />
in den kommenden Jahren<br />
auf dem Hamburger Werksgelände<br />
zu testen. Dabei soll die wasserstoffbasierte<br />
Reduktion von Eisenerz<br />
zunächst im Demonstrationsmaßstab<br />
mit einer Jahresproduktion von<br />
100.000 t stattfinden.<br />
„Unser Hamburger Werk bietet optimale<br />
Voraussetzungen für dieses<br />
innovative Vorhaben. Ein Elektrolichtbogenofen<br />
mit DRI-Anlage und<br />
Eisenerzpellets-Lager sind ebenso<br />
vorhanden wie jahrzehntelanges<br />
Knowhow in diesem Bereich. In<br />
einem neuen Schachtofen soll nun<br />
der Einsatz von Wasserstoff als<br />
Reduktionsmittel getestet werden“,<br />
kommentiert Frank Schulz, CEO von<br />
ArcelorMittal Germany.<br />
Druckwechseladsorption<br />
In dem Verfahren soll die Abtrennung<br />
von H 2 mit einer Reinheit von<br />
mehr als 95 % aus dem Gichtgas der<br />
Bestandsanlage durch so genannte<br />
Druckwechseladsorption erreicht<br />
werden. Das Verfahren wird<br />
zunächst mit grauem Wasserstoff<br />
(erzeugt bei Gastrennung) geprüft,<br />
um einen wirtschaftlichen Betrieb<br />
zu ermöglichen. In Zukunft soll die<br />
Anlage ebenso mit grünem Wasserstoff<br />
(erzeugt aus regenerativen<br />
Quellen) betrieben werden können,<br />
wenn dieser in ausreichenden Mengen<br />
zur Verfügung steht.<br />
Mit dem Hamburger Wasserstoffprojekt<br />
entwickelt ArcelorMittal<br />
Technologien für die direkte CO 2 -<br />
Vermeidung (CDA) als einen der<br />
möglichen Wege für eine emissionsarme<br />
Stahlerzeugung. Der Konzern<br />
investiert bereits mehr als 250 Mio. €<br />
in verschiedene Technologien zur<br />
Verringerung der CO 2 -Emissionen,<br />
beispielsweise in Gent, wo Kohlendioxidabgase<br />
zur Herstellung alter-<br />
16 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
nativer Kraftstoffe genutzt oder in chemischen Produkten<br />
verwendet werden. Ebenso werden Verfahren getestet,<br />
in denen Biokohle aus Restholz anstatt von Kokskohle<br />
als Reduktionsmittel im Hochofen verwendet wird.<br />
Mit dem Multi-Technologie-Ansatz will der Konzern<br />
einen aktiven Beitrag zur Erreichung der ambitionierten<br />
klima- und energiepolitischen Ziele des Pariers<br />
Abkommens leisten und ermitteln, welche Technologien<br />
technisch und wirtschaftlich machbar sind, um<br />
CO 2 -Emissionen zu reduzieren, zu erfassen oder zu<br />
vermeiden. 2<br />
Saarstahl-Bilanz<br />
Erfolgreiches 2018<br />
Der Saarstahl-Konzern blickt auf ein erfolgreiches<br />
Geschäftsjahr 2018 zurück, das von einem Anstieg der<br />
Umsatzerlöse und von guten Ergebniszahlen gekennzeichnet<br />
ist. „Dank einer guten Nachfrage in unseren<br />
Kernsegmenten Stab und Draht ist der Konzernumsatz<br />
trotz leicht rückläufiger Versandmengen aufgrund einer<br />
guten Erlösentwicklung gegenüber dem Vorjahr auf<br />
Rekordhöhe gestiegen“, erläuterte Tim Hartmann, Vorstandsvorsitzender<br />
und Finanzvorstand der SHS – Stahl-<br />
Holding-Saar GmbH & Co. KGaA, Vorsitzender des Vorstands<br />
der AG der Dillinger Hüttenwerke und der<br />
Saarstahl AG, die Jahreszahlen. „In den letzten Monaten<br />
des Jahres ging die Nachfrage konjunkturbedingt zurück,<br />
allerdings blieb der Absatz über das gesamte Jahr hinweg<br />
auf hohem Niveau.“<br />
FÜR EINE<br />
WELT DER<br />
VIELFALT.<br />
Der für den Stahlkonzern relevante Stahlmarkt für Drahtund<br />
Stabprodukte sei nach wie vor durch Überkapazitäten<br />
geprägt, so dass der Mengen- und Preisdruck weiterhin<br />
groß sei, so der Stahlhersteller. Die Rohstahlproduktion<br />
des Konzerns blieb auf unverändert sehr hohem<br />
Niveau und erreichte 2,782 Mio. t gegenüber 2,785 Mio. t<br />
im Vorjahr. Die Absatzmenge der Saarstahl AG (Drahtund<br />
Stab) ging um 4 % auf 2,431 Mio. t zurück (Vorjahr:<br />
2,532 Mio. t). Der Konzern-Umsatz konnte dank höherer<br />
Durchschnittserlöse um 3,6 % gesteigert werden und<br />
belief sich auf 2,528 Mrd. € – ein Rekord bei Draht und<br />
Stab – (Vorjahr: 2,440 Mrd. €).<br />
Die globale Stahlnachfrage werde sich in 2019 nur<br />
geringfügig positiv entwickeln und auch für die EU rechnet<br />
der Hersteller mit einer deutlichen Abschwächung der<br />
Stahlnachfrage.<br />
Saarstahl erwartet entsprechend ein herausforderndes<br />
Geschäftsjahr 2019. „Wir rechnen für 2019 mit einem<br />
leicht schwächeren Konzern-Umsatz und unter der Maßgabe<br />
von konsequenten Anstrengungen auf der Kostenseite<br />
mit einem wiederum positiven Konzernergebnis“,<br />
sagte Tim Hartmann.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
17<br />
Mehr als 8.000 Artikel und über<br />
10.000 Tonnen Stahl und<br />
Aluminium gibt’s innerhalb<br />
von 24 Stunden bei:<br />
VOSS-EDELSTAHL.COM
Anarbeitung<br />
und Logistik<br />
Bericht<br />
Foto: BAM AG<br />
Durch Verwendung von BAMTEC-Bewehrungselementen kann bei Bauprojekten die Gesamtbauzeit reduziert werden.<br />
progress Maschinen & Automation<br />
Starker Partner für die<br />
BAMTEC-Bewehrungstechnologie<br />
Die BAMTEC-Bewehrungstechnologie steht weltweit für ein höchst effizientes Verfahren zur Planung,<br />
Herstellung und den Einbau von Flächenbewehrungen für Stahlbetondecken, Stahlbetonbodenplatten<br />
und -wänden, so die BAM AG, die das Konzept entwickelt hat. Statt der herkömmlichen Bewehrung<br />
werden dabei sogenannte BAMTEC-Elemente verwendet. Die Hauptvorteile gegenüber einer<br />
herkömmlichen Bewehrung sind dem Unternehmen zufolge eine Betonstahlersparnis sowie eine<br />
reduzierte Verlegezeit von 80 bis 90% – bei gleichzeitig verbesserter Qualität.<br />
Bei der BAMTEC-Technologie,<br />
die von der BAM AG in St. Gallen,<br />
Schweiz, lizenziert wird, werden<br />
statt herkömmlicher Bewehrungselemente<br />
spezielle BAMTEC-Elemente<br />
verwendet. Diese enthalten<br />
ausschließlich einachsig verlegte<br />
Rundstähle, die mit querlaufenden<br />
Tragbändern zu einer Montageeinheit<br />
verbunden sind. Die Wirtschaftlichkeit<br />
des Verfahrens resultiert<br />
dabei aus der durchgängigen Verwendung<br />
von elektronischen Daten<br />
in Planung und Fertigung, aus einer<br />
maximalen Materialeffizienz sowie<br />
einer Ressourcenoptimierung bei<br />
jedem Arbeitsschritt.<br />
progress-Anlagen zur Herstellung<br />
von BAMTEC-Elemeten<br />
Als starker Partner bei der Herstellung<br />
von BAMTEC-Bewehrungs -<br />
elementen hat sich die progress<br />
Maschinen & Automation AG<br />
positioniert – ein Unternehmen der<br />
PROGRESS GROUP. Das Unternehmen,<br />
das sich auf innovative Anlagen<br />
in der Betonstahlverarbeitung fokussiert<br />
hat, ist ebenso ein Spezialist<br />
für vollautomatische Produktionsanlagen<br />
zur Herstellung der<br />
BAMTEC-Bewehrungslemente. Die<br />
progress Maschinen & Automation<br />
AG beliefert Biegebetriebe, Betonfertigteilwerke,<br />
Stahlhändler sowie<br />
Baustoffhändler – und setzt hohe<br />
Maßstäbe sowohl bei der Qualität<br />
ihrer Maschinen und Anlagen wie<br />
auch beim Kundendienst.<br />
Für das Herstellen von Bewehrungselementen<br />
nach dem lizenzierten<br />
Verfahren ist die Anlage<br />
„BAMTEC Evolution“ aus dem Hause<br />
progress ausgelegt. Sie besteht aus<br />
einer Richt- und Schneidanlage zur<br />
vollautomatischen Stabproduktion<br />
vom Coil sowie einer Schweißanlage,<br />
die gerichtete Stäbe zu einem<br />
BAMTEC-Bewehrungselement verschweißt.<br />
Das Richten der Stäbe übernimmt<br />
die Richt- und Schneidanlage.<br />
18 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
BAMTEC Evolution – eine Anlage der progress Maschinen & Automation zur Produktion von BAMTEC-Elementen<br />
Fotos: progress & Automation<br />
Diese verfügt über die progress-Rotor-<br />
Richttechnik, basierend auf eigenen<br />
Vorschubeinheiten für jede Produktionslinie<br />
für den Drahttransport<br />
und Schnitteinheiten für jeden Rotor.<br />
Der Drahtdurchmesserwechsel<br />
erfolgt vollautomatisch durch das<br />
Abrufen der jeweilig gewählten<br />
Drahtsorte bei 0-Rüstzeit.<br />
Der Schneidvorgang erfolgt elektromechanisch.<br />
Jede Produktionslinie<br />
verfügt dabei über ein eigenes<br />
Abschneidemeser und eigene elektronische<br />
Messeinrichtungen zum<br />
Auslösen des Schneidvorgangs. Mittels<br />
einer Greif- und Positioniereinheit<br />
werden die so produzierten Stäbe<br />
der BAMTEC-Schweißanlage zugeführt.<br />
Die einzelnen Stahldrähte werden<br />
mittels Punktschweißverfahren<br />
in beliebigem Abstand auf bis zu<br />
zehn Stahlbändern verschweißt.<br />
Auf Ein-Mann-Betrieb ausgelegt<br />
Die Anlage schweißt die Stäbe in<br />
den berechneten Abständen und<br />
Positionen auf die Montagebänder<br />
und fertigt so ein maßgenaues<br />
Bewehrungselement. Hierbei werden<br />
Stäbe von Ø 8 mm bis Ø 20 mm vom<br />
Coil verarbeitet. Alle dickeren Stäbe<br />
bis Ø 36 mm werden manuell vom<br />
Rundstahl verarbeitet. Unmittelbar<br />
nach dem Schweißvorgang wird das<br />
BAMTEC-Element zu einer Rolle aufgerollt.<br />
Die BAMTEC Anlage ist auf<br />
einen Ein-Mann-Betrieb ausgelegt.<br />
Auch die Montage der BAMTEC<br />
Elemente ist denkbar einfach, so<br />
progress Maschinen & Automation:<br />
Die aufgerollten Elemente werden<br />
zu den Baustellen transportiert und<br />
dort mit dem Kran an ihre Ausgangspunkte<br />
befördert. Durch die minimale<br />
Anzahl an Bewehrungselementen<br />
und das schnelle Ausrollen<br />
werde die Verlegung extrem be -<br />
schleunigt und vereinfacht – was<br />
dann zu einer Reduktion der Gesamtbauzeit<br />
führen kann, so das Unternehmen.<br />
Die Bewehrungslagen werden<br />
jeweils individuell für den jeweiligen<br />
Grundriss und die jeweilige Beanspruchung<br />
just-in-time gefertigt.<br />
Durch die Nutzung der BAMTEC-<br />
Software werden im Vorfeld die Lage,<br />
Länge und der Stabdurchmesser<br />
aller Stäbe für die benötigten Elemente<br />
berechnet. Auch Aussparungen<br />
und Zulageeisen können dabei<br />
berücksichtigt werden. Dies sorgt<br />
für optimalen Materialeinsatz und<br />
Einsparungen beim Betonstahl.<br />
Positives Fazit<br />
Die BAM AG zieht ein sehr positives<br />
Fazit der Partnerschaft mit progress.<br />
„Nach der Ankündigung des Wechsels<br />
zu progress Maschinen & Automation<br />
konnten wir bereits nach nur<br />
15 Monaten die neu entwickelte<br />
Anlage BAMTEC Evolution präsentieren,<br />
ein Meilenstein in der<br />
BAMTEC-Bewehrungstechnologie“,<br />
resümiert Franz Häussler, Geschäftsführer<br />
BAM AG. 2<br />
[ Kontakt]<br />
progress Maschinen & Automation AG<br />
Julius-Durst-Straße 100<br />
39042 Brixen, Italien<br />
Tel. + 39 0472 979100<br />
info@progress-m.com<br />
www.progress-m.com<br />
BAM AG<br />
Neugasse 43<br />
9000 St. Gallen, Schweiz<br />
Tel. +41 71 222 20 61<br />
info@bamtec.com<br />
www.bamtec.com<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
19
Anarbeitung<br />
und Logistik<br />
Nachrichten<br />
Innovative Strahlanpassung der Laserquelle:<br />
die Laserschneidanlage ENSIS-AJ des<br />
japanischen Herstellers Amada<br />
Foto: Amada<br />
61. Masuda-Award für innovative Blechbearbeitung<br />
Amada-Laserschneidmaschine ausgezeichnet<br />
Der von Nikkan Kogyo Shimbun, einem Fachmagazin für industrielle Produktion,<br />
ausgelobte Award ehrt jedes Jahr Firmen mit besonders innovativen Produkten. Im Frühjahr<br />
2019 nahmen 63 Firmen mit jeweils einem ausgewählten Produkt an dem Wettbewerb<br />
teil, von denen nur zehn Unternehmen einen Preis in ihrer eigenen Kategorie mit nach<br />
Hause nehmen durften. AMADA wurde mit ihrer Laserschneidanlage ENSIS-AJ ausgezeichnet.<br />
Der Faserlaser mit 9 kW überzeugte die Jury mit seinem patentierten Verfahren der<br />
variablen Strahlanpassung sowie der neuen Kollimationseinheit zur Erzeugung eines parallelen<br />
Strahlenverlaufs, die für maximale Flexibilität in der Bearbeitung unterschiedlichster<br />
Materialien sorgen. Die neue Ausbaustufe bewältigt dem Hersteller zufolge mit ihren 9 kW<br />
selbst hohes Arbeitsvolumen mühelos und schneidet Bleche bis zu 25 mm. Mit der Steuerung<br />
der neuesten Generation ist die ENSIS-AJ 9 kW, wie alle Modelle der Serie, netzwerkfähig<br />
im Sinne des IoT bzw. Industrie 4.0. Überdies lasse sich die ENSIS-AJ 9 kW perfekt<br />
vollautomatisiert einsetzen, um Rüstzeiten maximal zu verkürzen und einen Maschinenbetrieb<br />
rund um die Uhr zu gewährleisten, so Amada.<br />
Bomar-Bandsäge zur Rohrtrennung bis 120 mm<br />
Effiziente Schnittleistung<br />
BOMAR, Spezialist für voll- und halbautomatische<br />
Bandsägen hat mit der mobilen<br />
Metallbandsäge Pulldown 120 RB eine<br />
Anlage zur effizienten Rohrtrennung im Programm.<br />
Die manuellen Bandsägen der Baureihe<br />
Pulldown gehören zu den kleinsten<br />
Sägen im Rahmen der Angebotspalette des<br />
tschechischen Sägeanlagen-Herstellers.<br />
Diese transportablen Bandsägen zeichnen<br />
sich dem Unternehmen nach durch ihren<br />
geringen Platzbedarf und die einfache Bedienung<br />
insbesondere bei der Trennung von kleinen<br />
bis mittleren Materialdimensionen aus.<br />
Die Bandsäge Pulldown 120 RB ist für einen<br />
maximalen Rohrdurchmesser von 120 mm<br />
ausgelegt. Zu ihrer Mobilität trägt das relativ<br />
geringe Gewicht von 38 kg bei. Zudem<br />
besteht die Ausführung des Sägearms aus<br />
einer Aluminium-Gusslegierung. Die stabile<br />
Konstruktion und Flexibilität dieser Sägen<br />
sowie die problemlose Bedienung bieten eine<br />
effiziente Schnittleistung, so das Unternehmen.<br />
Dabei werde eine hohe Schnittpräzision<br />
durch Sägebandführungen aus Hartmetall<br />
und entsprechende Führungsrollen erzielt.<br />
Zwei wählbare Motordrehzahlen – 30 bzw.<br />
70 m/min – ermöglichen auch an Edelstähle<br />
angepasste Schnittgeschwindigkeiten. Der<br />
Die mobilen Metallbandsägen<br />
Pulldown<br />
vom Typ RB eignen<br />
sich für die flexible<br />
Trennung kleinerer<br />
Rohrmengen.<br />
Sägevorschub erfolgt manuell durch Betätigung<br />
des Handführungshebels. Zur Materialspannung<br />
dient eine komfortable Schnellspanneinrichtung.<br />
Die Bandsäge Pulldown 120 RB wird standardmäßig<br />
ohne Sockel und Kühlung<br />
geliefert, diese können aber als Zubehör<br />
zugekauft werden. Verschiedene Rollenbahnlängen<br />
und Anschlagsysteme ermöglichen<br />
eine optimale Anpassung an die Materialausgangslängen.<br />
Generell lassen sich die<br />
Bandsägen von BOMAR mit optionaler Ausstattung<br />
an die jeweiligen individuellen<br />
Anforderungen vor Ort anpassen.<br />
Foto: Bomar<br />
Stahlbau4 jetzt<br />
Stahlservice24<br />
Die Stahlbau24 GmbH hat ihren Namen<br />
geändert und firmiert seit dem 1.4.2019<br />
unter stahlservice24 GmbH. Mit der<br />
Umfirmierung wurden ebenfalls der<br />
Domain-Name des Webauftritts sowie die<br />
Email-Adresse geändert, teilte das Unternehmen<br />
von Maschinenbau-Ingenieur<br />
Valentin Kaltenbach mit. Die allgemeinen<br />
Geschäftsbedingungen sowie die postalische<br />
Anschrift des Online-Portals bleiben<br />
unverändert. Die Namensänderung sei<br />
notwendig geworden, um dem Anspruch<br />
als Dienstleister webbasierter Services<br />
gerecht zu werden, teilte Inhaber und<br />
Geschäftsführer Valentin Kaltenbach mit.<br />
Mit stahlservice24.online erhalten Unternehmen<br />
dem Anbieter zolge effiziente<br />
Steuerungsmöglichkeiten, um die Verfügbarkeit<br />
ihrer Maschinen messbar zu<br />
machen und effizienter zu gestalten.<br />
[ info ]<br />
Die neue Webadresse der stahlservice24<br />
GmbH lautet nun www.stahlservice24.online.<br />
Die Mailadressen enden nun auf<br />
@stahlservice24.online<br />
Fertigungstechniches<br />
Kolloquium 2019<br />
Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik<br />
und Automatisierung IPA lädt am<br />
8. und 9. Oktober 2019 zum Stuttgarter<br />
Fertigungstechnischen Kolloquium ins<br />
Haus der Wirtschaft, Stuttgart, ein. Ziel<br />
der Fachveranstaltung ist, Anwendern,<br />
Kunden und Zulieferern der Fertigungstechnik<br />
einen Blick in die technologische<br />
Zukunft der Branche und – in diesem Jahr<br />
insbesondere – in die Prozessketten zwischen<br />
Umformen und Zerspanen zu<br />
ermöglichen. Teil des Programms sind<br />
neben Fachvorträgen und Diskussionen<br />
auch Firmenbesichtigungen, eine begleitende<br />
Fachausstellung sowie eine Abendveranstaltung.<br />
[ info ]<br />
Veranstaltung: Stuttgarter Fertigungstechnisches<br />
Kolloquium<br />
Wann: 8./9.10.2019<br />
Wo: Haus der Wirtschaft, Stuttgart<br />
Weitere Infos und Anmeldung:<br />
www.ftk-2019.de<br />
20 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
metec.de<br />
tbwom.de<br />
Gemeinschaftstagung<br />
digitales Planen und Bauen<br />
Zur 4. Gemeinschaftstagung Digitales Planen und Bauen lädt am<br />
27. Juni 2019 der bauforumstahl e.V. nach Darmstadt. Themen<br />
der Veranstaltung sind unter anderem die Standardisierung, der<br />
Stufenplan des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur,<br />
BIM im Planungsprozess der Honorarordnung für Architekten<br />
und Ingenieure sowie die Datenmodelle IFC und IDM. Weiterhin<br />
geht es um die digitale Planung aus Sicht des Stahlbauers<br />
als Subunternehmer. Zielgruppe der Veranstaltung sind unter<br />
anderem Bauherren, Generalunternehmer sowie Behörden, Stahlund<br />
Metallbauer, Stahlerzeuger und der Stahlhandel. Für Mitglieder<br />
des bauforumstahl kostet die Fachveranstaltung 450 €, die<br />
Teilnahme für Nichtmitglieder liegt bei 695 €.<br />
10. INTERNATIONALE MET ALLURGIE-<br />
FACHMESSE MIT KONG<br />
GRESSEN<br />
[ info ]<br />
Veranstaltung: 4. Gemeinschaftstagung Digitales Planen und Bauen<br />
Wann: 27.6.2019<br />
Wo: Maritim-Hotel, Darmstadt<br />
Weitere Infos und Anmeldung: www.bauforumstahl.de<br />
Voortman-Technologietage Twente<br />
Am 15. und 16. Mai lädt der niederländische Hersteller von Blechbearbeitungsanlagen<br />
Voortman zur dritten Auflage seiner Technologietage<br />
in sein Experience Center nach Rijssen. Den Schwerpunkt<br />
der kostenlosen Expertenveranstaltung legt das<br />
Unternehmen dabei erneut auf den Wissenstransfer, insbesondere<br />
mit Blick auf die „Blechbearbeitung von Morgen“. Die Technologietage<br />
Twente richten sich an Teilnehmer der gesamten<br />
blechverarbeitenden Industrie. Am 15. Mai finden die Vorträge<br />
und die Diskussion in Niederländisch statt, am 16. Mai heißt das<br />
Unternehmen deutsche Teilnehmer willkommen.<br />
[ info ]<br />
Veranstaltung: Technologietage Twente<br />
Wann: 15.5.2019 (niederländische Teilnehmer)/16.5.2019<br />
(deutsche Teilnehmer)<br />
Wo: Voortman Experience Center, Rijssen<br />
Weitere Infos und Anmeldung: www.voortman.net<br />
Metals<br />
EFFICIENT PROCESS SOLUTIONS<br />
1. Berufsfachmesse Stahlbau<br />
Der bauforumstahl e.V. lädt am 23.11.2019 zur 1. Berufsfachmesse<br />
Stahlbau nach Düsseldorf ein. Auf dieser Fachmesse zeigen<br />
voraussichtlich etwa 20 Unternehmen der Stahlbaubranche<br />
jungen Interessenten die beruflichen Perspektiven der Branche<br />
auf. Im Rahmen einer großen Fachausstellung und einer begleitenden<br />
Vortragsreihe können sich die Nachwuchskräfte in spe vom<br />
Abiturienten bis zum Absolventen detailliert über den Stahlbau als<br />
Arbeitgeber informieren. „Die Zukunft gehört unserem Nachwuchs<br />
und genau hier setzt diese Veranstaltung an“, so Reiner Temme,<br />
Geschäftsführer der Temme Stahl- und Industriebau GmbH und<br />
Präsident des Deutschen Stahlbauverbandes.<br />
[ info ]<br />
Veranstaltung: 1. Berufsfachmesse Stahlbau<br />
Wann: 23.11.2019<br />
Wo: Areal Böhler, Düsseldorf<br />
Weitere Infos: www.bauforumstahl.de<br />
S chlüs<br />
seltechnologi<br />
e Metallurgie<br />
Die METEC mit dem Bereich Schmiedetechnik<br />
ist das global führende Event für die Herstellung<br />
und<br />
Verarbeitung von Roheisen-, Stahl- und NE-Metallen.<br />
Theoriee trifft Praxis<br />
Rahmenveranstaltungen wie<br />
die 4th European Steel<br />
Technology and Application Days (ESTAD) sind<br />
Diskussionsforen für neue Stahltechnologien und<br />
-anwendungen auf weltweit höchstem Niveau.<br />
Willkom<br />
mmen in Düss<br />
eldorf!<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
21<br />
P<br />
Tel. +<br />
10 1 06 _ 4000<br />
1 45 _<br />
.m<br />
o rf GmbH<br />
orf any<br />
49 21<br />
or<br />
e
Werkstoffe<br />
Bericht<br />
Studie im Auftrag von voestalpine<br />
Stahl in der Elektromobilität<br />
Mit dem Trend zum Leichtbau haben sich Werkstoffe wie Aluminium und Kunststoffe in der<br />
Automobilindustrie etabliert und behalten im Wandel vom Verbrennungs- hin zum Elektromotor als<br />
Alternativwerkstoffe zu Stahl wohl auch weiterhin ihre Berechtigung. Für Stahl ist dennoch im<br />
weltweit wachsenden Industriezweig der Elektromobilität mit gleichbleibender oder gar steigender<br />
Nachfrage zu rechnen. Dies geht aus einer Studie des Handelsblatt Research Institutes (HRI) im<br />
Auftrag der voestalpine hervor.<br />
Die Entwicklung innovativer hoch- und ultrahochfester<br />
Sorten sichert auch langfristig die Zukunft von<br />
Stahl in der Automobilindustrie. Zu diesem Ergebnis<br />
kommt die Studie „Die Rolle von Stahl in der Elektromobilität“<br />
des Handelsblatt Research Institutes im Auftrag<br />
des österreichischen Stahlherstellers voestalpine, die im<br />
Rahmen der Handelsblatt Jahrestagung 2019 „Zukunft<br />
Stahl“ in Düsseldorf vorgestellt wurde. Zukunftschancen<br />
habe der Werkstoff, da er gleichermaßen leicht und fest,<br />
dabei aber bestens verarbeitbar, recyclingfähig und wirtschaftlich<br />
sei.<br />
„Leichter um jeden Preis“ ist vorbei<br />
Vorteil für Stahl: Bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen<br />
sei der Trend zur Gewichtseinsparung um jeden<br />
Preis vorbei. Gerade die kohlenstoffverstärkten Kunststoffe<br />
(Carbon), die leichter, fester, aber auch deutlich teurer<br />
sind als Stahl, scheinen sich laut der Studie nicht weiter<br />
durchzusetzen. Hintergrund für diese Erkenntnis sind<br />
einerseits die Kosten und die schlechte Recyclingfähigkeit<br />
von Carbon im Vergleich zu Stahl und andererseits die<br />
permanenten Innovationen in Sachen Festigkeit und<br />
Gewicht in der Stahlentwicklung. „Für den Einsatz von<br />
Stahl in der Elektromobilität sprechen nicht nur wirtschaftliche<br />
Gründe, sondern auch eine vergleichbar gute<br />
Ökobilanz und Sicherheitsaspekte“, fasst Jan Kleibrink,<br />
Head of Economic Analysis vom Handelsblatt Research<br />
Institute, die Kernbotschaft zusammen.<br />
Anteil hochfester Stähle im Fahrzeugbau wächst<br />
Beispiel BMW: Während der i3 weitgehend aus Carbon<br />
bestand, wird der i5 ab 2021 aus Stahl und Leichtmetall<br />
konstruiert, so die Studie. Auch Tesla fährt in seinem<br />
Model 3 die Anteile von Aluminium und Titan zugunsten<br />
von Stahl zurück. Inzwischen liefert die europäische Stahlindustrie<br />
ultrafeste und zugleich leichte und gut formbare<br />
Stähle. Sie punkten mit einfacher Verarbeitung, homogenen<br />
Oberflächen für die Lackierung, hoher Rohstoffverfügbarkeit<br />
und guter Kombinationsfähigkeit mit anderen<br />
Werkstoffen. „Der Anteil hochfester Stähle im<br />
Fahrzeugbau wird von derzeit 18 auf 30 % der genutzten<br />
Stahlsorten steigen“, zitiert Jan Kleibrink vom Handelsblatt<br />
Research Institute aus den Vorarbeiten des Posco Research<br />
Instituts. Um 25 bis 39 % ließe sich so nach Angaben des<br />
22 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Weltstahlverbands worldsteel das<br />
Gewicht eines Fahrzeugs reduzieren.<br />
Über die Lebensdauer eines Fahrzeugs<br />
könnte dies 3 bis 4,5 t Treibhausgasemissionen<br />
sparen. Statt unverhältnismäßig<br />
teurer Gewichtsreduktion<br />
geht der Trend zu einer Balance zwischen<br />
Gewicht und Kosten durch<br />
einen Mix verschiedener Stahlsorten<br />
mit Aluminium- und Kunststoffflächen.<br />
Unabhängig vom Werkstoff hat<br />
die Sicherheit der Karosserie bei<br />
einem Unfall absolute Priorität. Bislang<br />
kam daher eine Kombination aus<br />
Aluminium und Stahl zum Einsatz.<br />
Neueste Stahlsorten sind drei- bis<br />
viermal zugfester als herkömmliche<br />
Stähle und eignen sich so hervorragend<br />
gerade für sicherheitsrelevante<br />
Bereiche, wie die Studie darlegt.<br />
Stahlerzeugnisse im E-Motor und<br />
-Antrieb<br />
In der HRI-Studie wurde auch das<br />
Thema Elektromotor und Werkstoffauswahl<br />
untersucht. Ergebnis ist, dass<br />
Stahl rund um Motor und Antrieb<br />
ebenfalls eine zentrale Rolle zukommt.<br />
In Elektromotoren wird sogenanntes<br />
nicht-kornorientiertes Elektroband<br />
eingesetzt – für ein reines Elektrofahrzeug<br />
zwischen 40 und 100 kg.<br />
Damit könnte der Bedarf für diesen<br />
weichmagnetischen Werkstoff allein<br />
in Europa auf über 1 Mio. t jährlich<br />
steigen. Stahlhersteller konzentrieren<br />
sich darauf, diese Elektrobleche fester<br />
und dünner zu machen und so das<br />
Gewicht des Motors zu reduzieren.<br />
Da hier die physikalischen Grenzen<br />
fast erreicht sind, können sie sich<br />
künftig vor allem durch ihre Kompetenz<br />
bei Klebe-, Füge- und Umformtechniken<br />
differenzieren.<br />
Batterie-Schutz: Attraktives<br />
Betätigungsfeld für europäische<br />
Stahlhersteller<br />
Drei Viertel der Batterien werden derzeit<br />
in Asien gefertigt, wird in der<br />
vorgestellten Studie bekräftigt. Aus<br />
europäischer Sicht fehlen damit<br />
Know-how und der Zugang zu ausreichend<br />
etablierten Wertschöpfungsketten.<br />
Anders beim Gehäuse: Die<br />
Batterie-Elemente benötigen einen<br />
entsprechend großen Behälter, der<br />
ausreichend Schutz bei crashbeding-<br />
ten Höchstbelastungen bietet und verhindert,<br />
dass Substanzen bei einem<br />
Unfall austreten. Der Batteriekasten<br />
ist ein neues Betätigungsfeld für europäische<br />
Werkstoffhersteller. Da das<br />
gesamte Batteriemodul bis zu 40 %<br />
des Fahrzeuggewichts ausmachen<br />
kann, geht es bei der Wahl des Werkstoffes<br />
abgesehen vom Sicherheitsaspekt<br />
um Gewicht, Wirtschaftlichkeit<br />
und Nachhaltigkeit. Anders als Aluminium,<br />
Titan und Faserverbund -<br />
stoffe hat Stahl den Vorteil, besonders<br />
resistent gegenüber Verformungen<br />
bei Unfällen zu sein.<br />
Vorteile von Stahl für den<br />
Klimaschutz<br />
Klimaschutz ist der wichtigste Treiber<br />
für Elektromobilität. Werden fossile<br />
Brennstoffe für die Herstellung von<br />
Aluminium oder Carbon verwendet<br />
und stammt der Strom an den Ladestationen<br />
nicht aus erneuerbaren<br />
Energien, bleibt die Klimabilanz auch<br />
eines E-Fahrzeugs völlig unbefriedigend.<br />
Ökologisch gesehen hängt der<br />
Erfolg der Elektromobilität vom Gelingen<br />
der Energiewende ab. Die eingesetzten<br />
Werkstoffe dürfen dabei nicht<br />
ausgeblendet werden. Im Vergleich<br />
zu Aluminium oder Carbon hat Stahl<br />
hier besondere Vorteile, weil er von<br />
vornherein mit geringerer Energie<br />
erzeugt sowie in der Folge weiterverarbeitet<br />
und schließlich ohne Qualitätsverlust<br />
recycelt werden kann.<br />
Elektromobilität als dynamisch<br />
wachsender Markt<br />
In der EU wird Elektromobilität direkt<br />
durch Kaufanreize für Elektrofahrzeuge<br />
und indirekt durch schärfere<br />
Auflagen zum Schadstoffausstoß konventioneller<br />
Antriebe gefördert, fasst<br />
die Studie zusammen. Bislang halten<br />
die geringe Reichweite und die vergleichsweise<br />
hohen Anschaffungskosten<br />
viele Verbraucher vom Kauf<br />
eines Elektrofahrzeugs ab. „Diese<br />
negativen Faktoren schwächen sich<br />
ab, da die Entwicklungen bei der<br />
Akku-Technik bis 2025 die Reichweiten-Nachteile<br />
ausgleichen und die Batteriekosten<br />
auf ein Drittel der aktuellen<br />
Kosten fallen werden“, sagt<br />
Kleibrink. Bis 2025 könnten bereits<br />
mehr als 14 Mio. Elektrofahrzeuge in<br />
der EU verkauft werden. 2<br />
Grafiken: voestalpine<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
23
Messen<br />
und Märkte<br />
Schwerpunkt Konjunktur<br />
Auftragseingang<br />
stetig gestiegen: Im<br />
vergangenen Jahr hat<br />
die deutsche Bauwirtschaft<br />
im Durchschnitt<br />
stetig<br />
steigende Auftragseingänge<br />
verzeichnet.<br />
Während auch im<br />
Januar 2019 ein Plus<br />
gegenüber Januar<br />
2018 erzielt wurde,<br />
lag der Auftragseingang<br />
im Februar leicht<br />
unter dem Vormonat.<br />
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe<br />
Grafik: Destatis<br />
Auftragsbestände mit höchstem Niveau seit Wiedervereinigung<br />
Bauwirtschaft stützt Konjunktur<br />
Trotz Unsicherheiten am sonstigen Konjunkturhorizont: Die Bauwirtschaft in Deutschland meldet<br />
weiterhin positive Zahlen. So lagen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Unternehmen<br />
mit 20 und mehr tätigen Personen im Januar 2019 nominal mit rund 5,9 Mrd. € um 18,2 % höher<br />
als ein Jahr zuvor – und kamen damit auf den höchsten jemals gemessenen Stand in einem Januar<br />
in Deutschland. Ein Rekord auch bei den Auftragsbeständen insgesamt: Diese erreichten zum<br />
Jahresanfang mit über 46 Mrd. € das höchste Niveau seit der Wiedervereinigung.<br />
Mit dem Rekord bei den Auftragsbeständen<br />
im Januar haben die<br />
Unternehmen der Bauwirtschaft<br />
gegenüber dem guten Quartal 2018,<br />
in dem bereits eine außerordentliche<br />
Leistungssteigerung erzielt wurde,<br />
sogar noch einmal zugelegt. Das sind<br />
gute Aussichten für die Entwicklung<br />
in 2019: „Die Bauwirtschaft wird die<br />
Konjunkturentwicklung in Deutschland<br />
in diesem Jahr wesentlich stützen“,<br />
kommentierte Felix Pakleppa,<br />
Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands<br />
Deutsches Baugewerbe<br />
(ZDB), im März die Konjunkturdaten<br />
für das Bauhauptgewerbe.<br />
Positive Erwartungen<br />
Die Geschäftslage wird im Wohnungsbau<br />
und im Gewerbebau laut<br />
Konjunkturumfrage des ZDB weiter<br />
als „Gut“ beschrieben. Im öffentlichen<br />
Hoch- und Straßenbau blieben<br />
die Urteile saisonbedingt noch etwas<br />
verhaltener.<br />
Die Unternehmen berichteten<br />
weiter über eine unverändert hohe<br />
Nachfrage nach Bauleistungen;<br />
sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau.<br />
So liegen die Auftragsbestände im<br />
Hochbau im Februar bei einer Reichweite<br />
von vier Monaten, im Tiefbau<br />
legten sie auf drei Monate zu (Vormonat<br />
2,5 Monate).<br />
Auch die kurzfristigen Erwartungen<br />
an die Geschäftsentwicklung<br />
bleiben laut ZDB-Umfrage aufwärtsgerichtet.<br />
Die anhaltend hohe Nachfrage,<br />
bei bereits hoher Kapazitätsauslastung,<br />
erzeugt weiter eine große<br />
Investitionsbereitschaft, die überwiegend<br />
von Ersatzbeschaffungen<br />
geprägt ist. Aber auch über Rationalisierungs-<br />
und Erweiterungsinvestitionen<br />
wird berichtet.<br />
Plus bei Umsatz<br />
und Beschäftigten<br />
Zuwächse verzeichnete die Branche<br />
auch bei den Umsätzen sowie der<br />
Zahl der Beschäftigten: Nach Daten<br />
des Statistischen Bundesamtes<br />
haben die Unternehmen der Bauwirtschaft<br />
im Januar 2019 einen<br />
Umsatz von 4,2 Mrd. € erzielt. Das<br />
waren ca. 10 % mehr als im Januar<br />
2018.<br />
Die Zahl der Beschäftigten lag<br />
mit ca. 476.500 um etwa 10.000 über<br />
dem Wert vom Dezember 2018.<br />
24 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Damit verzeichneten die Unternehmen<br />
einen für den Jahresbeginn<br />
außerordentlich hohen Beschäftigungsstand.<br />
Dennoch fehlen der<br />
Branche weitere Fachkräfte, etwa<br />
Bauingenieure. Der Fachkräftemangel<br />
hindere die Bauwirtschaft, die<br />
positive Entwicklung noch auszubauen,<br />
so der ZDB.<br />
Dämpfer bei Auftragseingang<br />
im Januar<br />
Einen Dämpfer bei den saison-,<br />
arbeitstäglich- und preisbereinigten<br />
Auftragseingängen gab es nach Angaben<br />
des Statistischen Bundesamtes<br />
(Destatis) im Januar 2019: Im ersten<br />
Monat des neuen Jahres lagen diese<br />
um 7,9 % niedriger als im Dezember<br />
2018. Dieser Rückgang sei insbesondere<br />
auf den durch Großaufträge<br />
bedingten hohen Auftragseingang<br />
des Vormonats zurückzuführen, so<br />
Destatis. Im weniger schwankungsanfälligen<br />
Dreimonatsvergleich stieg<br />
das Volumen der saison-, arbeitstäglich-<br />
und preisbereinigten Auftragseingänge<br />
von No vember 2018 bis<br />
Januar 2019 gegenüber August bis<br />
Oktober 2018 allerdings um 11,5 %.<br />
Im Vorjahresvergleich war der<br />
arbeitstäglich- und preisbereinigte<br />
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe<br />
im Januar 2019 um 11,6 %<br />
höher.<br />
Mildes Wetter kommt<br />
Baunachfrage zugute<br />
Dank der milden Witterung im<br />
Februar konnten die Bauunternehmen<br />
die Auftragsbestände ohne<br />
größere Unterbrechungen weiter<br />
umsetzen. Das geht aus der monatlichen<br />
Konjunkturumfrage des<br />
ZDB bei seinen Mitgliedsunternehmen<br />
hervor.<br />
So stieg die Geräteauslastung im<br />
Hochbau im Februar bereits wieder<br />
über 70 % (Januar 70 %). Auch im<br />
Tiefbau wurde mit 60 % der Wert<br />
des Vormonats (55 %) deutlich übertroffen.<br />
Die Preise für den Neubau konventionell<br />
gefertigter Wohngebäude<br />
in Deutschland sind nach Angaben<br />
des Statistischen Bundesamts im<br />
Februar 2019 im Vergleich zum Vorjahr<br />
um 4,8 % gestiegen, nach einem<br />
Plus von 4,4 % im Durchschnitt des<br />
Jahres 2018. Im Straßenbau hätten<br />
die Neubaupreise im Februar sogar<br />
um 7,5 % über dem vergleichbaren<br />
Vorjahresniveau gelegen.<br />
„Für die aktuellen Baupreissteigerungen<br />
sind nach wie vor zu einem<br />
großen Teil die gestiegenen Baumaterialkosten<br />
sowie die deutliche Tariflohnerhöhung<br />
des vergangenen Jahres<br />
verantwortlich. Aber auch der<br />
Staat selbst hat mit gestiegenen technischen<br />
Anforderungen zur Preissteigerung<br />
beigetragen“, kommentierte<br />
der Hauptgeschäftsführer des<br />
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,<br />
Dieter Babiel, die aktuelle<br />
Baupreisentwicklung.<br />
Als „gutes Instrument zum fairen<br />
Umgang miteinander“ empfahl der<br />
Verbandschef die „konsequente Vereinbarung<br />
von Preisgleitklauseln in<br />
Bauverträgen“. Risiken aus Preisschwankungen<br />
bei weltweit gehandelten<br />
Bauprodukten könnten damit<br />
abgefedert werden. 2<br />
Kfw-Ifo-Mittelstandsbarometer<br />
Mittelständisches Geschäftsklima fängt sich etwas<br />
Angesichts unsicherer Konjunkturperspektiven<br />
glänzen die deutschen Mittelständler<br />
laut der Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
(KfW) mit einer positiven Nachricht.<br />
Ihr Geschäftsklima ist im März um 1,5 Zähler<br />
auf 8,1 Saldenpunkte gestiegen, wie das<br />
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer berichtet.<br />
Damit endete zugleich eine Serie von zuvor<br />
fünf Stimmungsrückgängen in Folge.<br />
Ihre aktuellen Geschäfte beurteilten die Mittelständler<br />
mit 22,7 Saldenpunkten um 1,4<br />
Zähler besser als im Vormonat. Die mittelständischen<br />
Geschäftserwartungen für die<br />
kommenden sechs Monate zogen um 1,7<br />
Zähler auf nun -5,2 Saldenpunkte an.<br />
Auch in den Großunternehmen präsentiert<br />
sich die Stimmung zu Frühlingsbeginn nicht<br />
mehr ganz so unterkühlt wie noch im Februar.<br />
Die großen Firmen revidierten sowohl ihre<br />
Geschäftslageurteile (+1,4 Zähler auf 8,3<br />
Saldenpunkte) als auch ihre Geschäftser-<br />
wartungen (+0,5 Zähler auf -10,4 Saldenpunkte)<br />
etwas nach oben. Mit -1,5 Saldenpunkten<br />
(+0,9 Saldenpunkte) blieb das<br />
Geschäftsklima der Großunternehmen<br />
jedoch weiter im negativen Bereich und der<br />
Rückstand gegenüber dem Mittelstand vergrößerte<br />
sich erneut.<br />
Der Blick in die Branchen zeigte eine zunehmend<br />
gespaltene Stimmung in den Binnenbranchen<br />
(Bau, Handel, Dienstleistungen)<br />
einerseits und dem exportorientierten Verarbeitenden<br />
Gewerbe andererseits. Das<br />
Verarbeitende Gewerbe ist der einzige Wirtschaftsbereich,<br />
in dem das Klima erneut<br />
deutlich fiel und unter die Nulllinie rutschte<br />
(Mittelstand: -2,2 Zähler auf -1,2 Saldenpunkte;<br />
Großunternehmen: -2,9 Zähler auf<br />
-8,9 Saldenpunkte).<br />
„Das März-Ergebnis des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers<br />
bestätigt das bekannte<br />
Bild: Die Außenwirtschaft macht sich Sorgen,<br />
die Binnenwirtschaft hält dagegen und<br />
Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW<br />
stabilisiert die deutsche Konjunktur“, sagte<br />
Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW.<br />
[info]<br />
Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist<br />
abrufbar unter www.kfw.de/mittelstandsbarometer<br />
Foto: KfW<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
25
Messen<br />
und Märkte<br />
Schwerpunkt Konjunktur<br />
Geschäftsklima Zulieferindustrie Deutschland April 2018<br />
Saldo der positiven und negativen Meldungen<br />
Aktuelle Lage<br />
Zukunftserwartungen<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
-50<br />
-60<br />
Quelle: ArGeZ<br />
-70<br />
Jan. 06 Jan. 07 Jan. 08 Jan. 09 Jan. 10 Jan. 11 Jan. 12 Jan. 13 Jan. 14 Jan. 15 Jan. 16 Jan. 17 Jan. 18 Jan. 19 Jan. 20<br />
Zulieferer mit verhaltenem Start in 2019<br />
Politische Stabilität bereitet Sorge<br />
Die deutsche Zulieferindustrie sieht sich für das Jahr 2019 „wetterfest aufgestellt“. Das sagte der<br />
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Zuliefererindustrie ArGeZ, Christian Vietmeyer, zu Beginn der<br />
Hannover Messe. Sorge bereiten den Zuliefererbranchen „instabile handelspolitische Leitplanken“<br />
sowie „EU-spezifische Unsicherheiten“.<br />
Das vergangene Jahr 2018 ist<br />
für die deutsche Zulieferindustrie<br />
mit einem Umsatzplus von ca. 3 %<br />
auf 264 Mrd. € positiv verlaufen. Die<br />
Lieferungen an ausländische Kunden<br />
legten bei einer Exportquote von<br />
rund 39 % in ähnlicher Dynamik auf<br />
103 Mrd. € zu.<br />
Das internationale Geschäft hat<br />
für die Zuliefererbranchen der<br />
ArGeZ, zu denen neben der Stahlund<br />
Metallverarbeitung, der Giesserei-Industrie<br />
sowie der Aluminiumindustrie<br />
unter anderem auch<br />
die Kunststoff- und Kautschuk -<br />
industrie gehören, eine große Bedeutung.<br />
„Die Stabilität nicht nur der<br />
internationalen Wertschöpfungsketten,<br />
sondern der globalen Märkte<br />
grundsätzlich, ist für die deutschen<br />
Zulieferer essentiell“, so die ArGeZ.<br />
Zusätzlich zu direkten Ausfuhren<br />
landen darüber hinaus Dreivier-<br />
tel der im Inland abgesetzten Komponenten<br />
und Aggregate zur Endverwendung<br />
im Ausland. Da die<br />
wichtigste Kundengruppe der Zulieferer,<br />
die Automobilhersteller, ihre<br />
Produktion im Inland reduziert<br />
haben, sind diese indirekten Exporte<br />
der ArGeZ zufolge ein wichtiger Treiber<br />
für das Wachstum der Zuliefererbranche.<br />
Hohe Auslastung dank<br />
bestehender Aufträge<br />
Die Kapazitätsauslastung der Zuliefer-Unternehmen<br />
ist im Verlauf des<br />
Jahres 2018 gegenüber dem schon<br />
hohen Niveau aus dem Vorjahr nochmals<br />
gestiegen (87 %). Auch für das<br />
erste Quartal 2019 hat sich die hohe<br />
Auslastung stabil gezeigt, sagte Vietmeyer.<br />
Dies sei allerdings überwiegend<br />
auf alte Auftragsbestände<br />
zurückzuführen. Neue Impulse zeigten<br />
sich nur vereinzelt. Vor dem Hintergrund<br />
des hohen Auslastungsniveaus<br />
haben die Zulieferer ihre<br />
Belegschaften im Vorjahresvergleich<br />
nochmals um 3 % aufgestockt: Die<br />
Zahl der Beschäftigten ist Stand Ende<br />
2018, der ArGeZ zufolge auf ca. 1,2<br />
Mio. Beschäftigte gestiegen.<br />
Drohende Handelsbarrieren<br />
verunsichern die Branche<br />
Zuliefererunternehmen investieren<br />
zur Zeit vor allem in strukturelle<br />
Anpassungen, in die Integration von<br />
Automatisierungs- und Digitalisierungsmöglichkeiten<br />
sowie in die<br />
Erweiterung und Optimierung der<br />
Angebotspalette, so Vietmeyer.<br />
Zwar bewertet die Branche die<br />
aktuelle Lage beim Geschäftsklima<br />
derzeit immer noch positiv (siehe<br />
Grafik, blaue Linie). Auf Sicht des<br />
Jahresverlaufs sehen sich die Zulie-<br />
26 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
ferer, zum Beispiel beim Brexit oder<br />
den Spannungen zwischen der EU<br />
und der US-Administration, einer<br />
Fülle an Unwägbarkeiten gegenüber,<br />
die ihre Perspektiven unter Druck<br />
setzen (Grafik, braune Linie). Hier<br />
seien vor allem die politischen<br />
Akteure auf der handelspolitischen<br />
Bühne gefordert.<br />
Automobil-Hersteller verschieben<br />
Produktion ins Ausland<br />
Bei der Pkw-Produktion bestätigt<br />
sich aus Sicht der ArGeZ ein schon<br />
länger andauernder Trend, nämlich<br />
der Verlagerung von Inlandsproduktion<br />
ins Ausland. Zu beobachten<br />
seien weiterhin Modellverlagerungen<br />
ins Nicht-EU-Ausland bei einigen<br />
deutschen Automobilherstellern. Das<br />
führe zwar zu einer rückläufigen<br />
Automobilproduktion im Inland und<br />
zum Wachstum im Ausland. Da die<br />
Zulieferer aber weltweit aktiv sind,<br />
sehen sie sich hier gut gewappnet.<br />
Innerhalb der EU zeigten sich<br />
bei der Pkw-Produktion tendenziell<br />
Seitwärtsbewegungen. Die im dritten<br />
und vierten Quartal 2018 aufgetretenen<br />
Produktionsrückgänge wegen<br />
der Umstellung auf das neue Abgas-<br />
Prüfverfahren WLPT (Worldwide<br />
Harmonized Light-Duty Vehicles<br />
Test Procedure) für die Fahrzeuge<br />
seien nur noch als „Nachwehen“<br />
spürbar.<br />
Zulieferer mahnen Fair Play an<br />
Die im März von BMW geforderten<br />
deutlichen Sparanstrengungen bei<br />
den Zulieferern sehen diese sehr kritisch,<br />
so die ArGeZ. Sie kämen zu<br />
einer Zeit, in der die Automobilbauer<br />
und ihre Zulieferer mehr denn je forschen<br />
müssten, um zukunftsfähig<br />
zu bleiben. „Emissionsfreie Antriebe,<br />
autonomes Fahren etc. sind die technologischen<br />
Herausforderungen, bei<br />
der die gesamte Wertschöpfungskette<br />
vom OEM über die Tier-Unternehmen<br />
bis zum Grundstoffhersteller<br />
jetzt liefern muss. Da passt es<br />
gar nicht, wenn ein massiver einseitiger<br />
Kostendruck vom OEM aufgebaut<br />
wird“, so Christian Vietmeyer,<br />
Sprecher der ArGeZ. 2<br />
Geschäftsklimaindex Zulieferindustrie<br />
Der Geschäftsklimaindex Zulieferindustrie wird von der ArGeZ in Zusammenarbeit<br />
mit dem Ifo-Institut, München, ermittelt. Er beruht auf der<br />
Befragung von rund 600 Unternehmen und deckt die in der Arbeitsgemeinschaft<br />
Zulieferindustrie zusammengeschlossenen Branchen Gießerei-Industrie,<br />
Aluminiumindustrie, Kunststoffverarbeitung, Stahl- und<br />
Metallverarbeitung, NE-Metall-Industrie, Kautschukindustrie sowie Technische<br />
Textilien ab.<br />
US-Handelskonflikt mit China<br />
belastet stärker als Zölle<br />
Die Unsicherheit durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China<br />
belastet die Wirtschaft stärker als die bereits eingeführten Zölle. Zu diesem<br />
Schluss kommt eine aktuelle Analyse des Kreditversicherers Euler Hermes.<br />
2018 habe der Konflikt demnach bereits zu erheblichen Einbußen geführt.<br />
Das Wachstum des Welthandels ist 2018 auf +3,8% geschrumpft von +5,2%<br />
im Vorjahr, so der Warenkreditversicherer. „Die Zölle sind dabei noch nicht<br />
einmal das größte Problem. Die Unsicherheit kostet im schwelenden Handelskonflikt<br />
wesentlich mehr Wachstum als die Zölle“, sagt Ludovic Subran, Chefvolkswirt<br />
der Euler Hermes-Gruppe und stellvertretender Chefvolkswirt der<br />
Allianz.<br />
Foto: Daimler<br />
Montage im Mercedes-Benz-Werk Rastatt<br />
Deutsche Automobilindustrie<br />
Marktniveau bleibt hoch<br />
Während die Produktionsbilanz für<br />
die Automobilindustrie in der zweiten<br />
Hälfte des vergangenen Jahres mit -1 %<br />
deutlich negativ ausgefiel, kann die Branche<br />
zumindest für das erste Quartal 2019<br />
wieder etwas aufatmen: Nach Zahlen des<br />
Verbands der Automobilindustrie (VDA)<br />
wurden in den ersten drei Monaten<br />
880.200 Pkw neu zugelassen. Das ist das<br />
höchste Volumen in einem ersten Quartal<br />
seit dem Jahr 2000. Im März 2019 wurden<br />
345.600 Pkw neu zugelassen (-1 %).<br />
Der Auftragseingang aus dem Inland lag<br />
im 1. Quartal um 7 % höher als im Vorjahreszeitraum.<br />
Nach zwei starken ersten<br />
Monaten unterschritt der inländische Auftragseingang<br />
im März den Vorjahreswert<br />
um 10 %. Der Auftragseingang aus dem<br />
Ausland ging im 1. Quartal 2019 um 8 %<br />
zurück. Auch im März betrug das Minus<br />
8 %.<br />
Die deutschen Pkw-Hersteller haben im<br />
1. Quartal knapp 1,3 Mio. Einheiten produziert<br />
(-11 %). Im März wurden 451.400<br />
Pkw hergestellt (-14 %). Ähnlich lief es im<br />
Exportgeschäft: Im März wurden 343.300<br />
Pkw an Kunden in aller Welt ausgeliefert<br />
(-9 %). Bis März wurden mit 975.300 Fahrzeugen<br />
nahezu eine Mio. Autos exportiert<br />
(-10 %). „Das Zulassungsniveau im<br />
gewerblichen Bereich und sehr gute Verkäufe<br />
bei den leichten und schweren<br />
Nutzfahrzeugen sind gute Indikatoren für<br />
eine Beibehaltung des hohen Marktniveaus“,<br />
sagte der Präsident des Verbands<br />
der Internationalen Kraftfahrzeughersteller<br />
(VDIK )Reinhard Zirpel.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
27
Messen<br />
und Märkte<br />
Schwerpunkt Konjunktur<br />
Einkaufsmanager-Index<br />
Industrieproduktion auf Talfahrt<br />
Am Ende des ersten Quartals ist das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland noch tiefer in die<br />
Schrumpfungszone gerutscht. Wie die jüngsten Umfrageergebnisse zum IHS Markit/BME-Einkaufsmanager-Index<br />
(EMI) zeigen, gingen Produktion, Neuaufträge und Exportorder abermals stärker zurück.<br />
Darüber hinaus wirkten sich<br />
die schleppende Nachfrage sowie der<br />
unsichere Geschäftsausblick auf die<br />
Einstellungspolitik der Unternehmen<br />
aus. Denn erstmals seit drei Jahren<br />
verzeichnete der EMI bei der Beschäftigung<br />
einen leichten Rückgang. Der<br />
saisonbereinigte EMI gab im März<br />
erneut deutlich nach und notierte bei<br />
44,1 Punkten nach 47,6 im Februar.<br />
Dies markiert den niedrigsten Wert<br />
seit Juli 2012 als der Euroraum unter<br />
Staatsschuldenkrise und drohender<br />
Rezession litt.<br />
„Nachdem der EMI bereits<br />
den dritten Monat in Folge<br />
unter die magische 50-Punkte-<br />
Schwelle gerutscht ist, müssen<br />
wir uns auf den beginnenden<br />
Abschwung einstellen,<br />
betonte Dr. Silvius Grobosch,<br />
Hauptgeschäftsführer des<br />
Bundesverbandes Materialwirtschaft,<br />
Einkauf und Logistik e.V.<br />
(BME).<br />
Laut EMI hat sich die Stimmung<br />
in der deutschen Industrie im März<br />
noch einmal verschlechtert. „Gemessen<br />
an historischen Erfahrungen sollte<br />
damit der Tiefpunkt erreicht sein“,<br />
„Positiv stimmt uns, dass die durchschnittlichen<br />
Einkaufspreise im März<br />
kaum angestiegen sind. Sinkende<br />
Industriemetallpreise scheinen<br />
hier zur Kostensenkung wesentlich<br />
beigetragen zu haben.“<br />
Dr. Silvius Grobosch, Hauptgeschäftsführer BME e.V.<br />
kommentierte Dr. Gertrud R. Traud,<br />
Chefvolkswirtin der Helaba Landesbank<br />
Hessen-Thüringen, auf BME-<br />
Anfrage die aktuellen EMI-Daten. Die<br />
Chancen für eine baldige Erholung<br />
seien hoch.<br />
Zur jüngsten Entwicklung des EMI-<br />
Teilindex Einkaufspreise sagte Dr.<br />
Heinz-Jürgen Büchner, Managing<br />
Director Industrials, Automotive & Services<br />
der IKB Deutsche Industriebank<br />
AG dem BME: „Obwohl sich die Zeichen<br />
für eine konjunkturelle Abschwächung<br />
mehren, tendierten die Rohstoffpreise<br />
zuletzt fester. Bei Rohöl<br />
belastet die Krise in Venezuela, während<br />
sich die Förderung im Iran stabilisiert<br />
hat. Die Eisenerzpreise haben<br />
sich nach dem Dammbruch in Brasilien<br />
auf dem erreichten Niveau seitwärts<br />
bewegt. Die Schrottpreise zogen infolge<br />
knappen Angebots an. Dadurch entsteht<br />
Druck auf die Rohstahlpreise,<br />
der mittelfristig Preisanhebungen zur<br />
Folge haben dürfte.“<br />
Industrieproduktion<br />
Im März ist die Leistung des Verarbeitenden<br />
Gewerbes dem EMI zufolge<br />
geschrumpft. Der Rückgang fiel so<br />
deutlich aus wie seit Juli 2012 nicht<br />
mehr. Alle drei von der<br />
Umfrage erfassten Teilbereiche<br />
verzeichneten demnach<br />
niedrigere Produktionsraten.<br />
Dabei schnitten die Hersteller<br />
von Vorleistungsgütern am<br />
schlechtesten ab, gefolgt von<br />
den Produzenten von Konsumgütern.<br />
Wie die jüngsten<br />
Umfrageergebnisse zum IHS<br />
Markit/BME-Einkaufsmanager-Index<br />
(EMI) zeigen, gingen Produktion,<br />
Neuaufträge und Exportorder<br />
abermals stärker zurück.<br />
Auftragseingang insgesamt/Export<br />
Das Abwärtstempo beim Auftragseingang<br />
hat sich laut EMI sowohl bei Groß-<br />
28 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Über den EMI<br />
Der IHS Markit/BME-Einkaufsmanager-Index<br />
(EMI) gibt einen Überblick<br />
über die konjunkturelle Lage<br />
in der deutschen Industrie. Der<br />
Index erscheint seit 1996 unter<br />
Schirmherrschaft des BME. Er<br />
wird von IHS Markit mit Hauptsitz<br />
in London erstellt und beruht auf<br />
der Befragung von 500 Einkaufsleitern/Geschäftsführern<br />
der verarbeitenden<br />
Industrie in Deutschland<br />
(nach Branche, Größe,<br />
Region repräsentativ für die deutsche<br />
Wirtschaft ausgewählt). Der<br />
EMI orientiert sich am Vorbild des<br />
US-Purchasing Manager’s Index<br />
(Markit U.S.-PMI).<br />
unternehmen als auch bei Klein- und<br />
Mittelbetrieben abermals verschärft.<br />
So rutschte der Teilindex noch weiter<br />
unter die Wachstumsschwelle von 50,0<br />
Punkten und notierte auf dem tiefsten<br />
Stand seit April 2009. Die Produzenten<br />
von Vorleistungsgütern und Konsumgütern<br />
verzeichneten besonders starke<br />
Abnahmen ihrer Neuaufträge. Dies lag<br />
vor allem an der anhaltenden Unsicherheit<br />
in der Branche, die sich auf<br />
die Umsätze auswirkte sowie an der<br />
nach wie vor schleppenden Nachfrage<br />
in der Automobilindustrie.<br />
Der Rückgang des Gesamt-Auftragseingangs<br />
spiegelte zumindest teilweise<br />
die erneute Schrumpfung der<br />
Auslandsnachfrage wider. Damit<br />
wurde im März das siebte Minus beim<br />
Export hintereinander verzeichnet,<br />
welches zudem so stark ausfiel wie<br />
seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr.<br />
Überall dort, wo eine Schrumpfung<br />
verzeichnet wurde (fast ein Drittel der<br />
Umfrageteilnehmer), wurde dies niedrigeren<br />
Umsätzen in Großbritannien,<br />
Kontinentaleuropa und Asien zugeschrieben.<br />
Einkaufs-/Verkaufspreise<br />
Die durchschnittlichen Einkaufspreise<br />
stiegen dem EMI zufolge im März<br />
kaum an. Bereits zum fünften Mal hintereinander<br />
schwächte sich demnach<br />
die Inflationsrate ab und fiel so gering<br />
aus wie seit über zweieinhalb Jahren<br />
nicht mehr. Ein Teil der Befragten gab<br />
an für einige Elektronikteile und rohölbasierte<br />
Produkte mehr bezahlt zu<br />
haben. Zur Reduzierung der Kosten<br />
führten jedoch vor allem die billigeren<br />
Metallpreise und hier insbesondere<br />
Stahl.<br />
Jahresausblick<br />
Der Pessimismus der Einkaufsmanager<br />
hinsichtlich der Produktionsaussichten<br />
binnen Jahresfrist hat sich im März<br />
erneut vergrößert. So fiel der Teilindex<br />
noch tiefer in den Negativbereich auf den<br />
tiefsten Stand seit November 2012. Nach<br />
wie vor sorgen vor allem der Konjunkturabschwung,<br />
die Unsicherheiten beim<br />
Brexit und den zukünftigen Handelsbeziehungen<br />
sowie die anhaltenden Probleme<br />
im Automobilsektor für Kopfzerbrechen<br />
in den Führungsetagen der<br />
Industrieunternehmen.<br />
Der IHS Markit/BME-Einkaufsmanager-Index<br />
(EMI) gibt einen allgemeinen<br />
Überblick über die konjunkturelle Lage<br />
in der deutschen Industrie. Der Index<br />
erscheint seit 1996 unter Schirmherrschaft<br />
des BME. Er wird vom Anbieter<br />
von Unternehmens-, Finanz- und Wirtschaftsinformationen<br />
IHS Markit mit<br />
Hauptsitz in London erstellt und beruht<br />
auf der Befragung von 500 Einkaufsleitern/Geschäftsführern<br />
der verarbeitenden<br />
Industrie in Deutschland (nach Branche,<br />
Größe, Region repräsentativ für die<br />
deutsche Wirtschaft ausgewählt). Der<br />
EMI orientiert sich am Vorbild des US-<br />
Purchasing Manager’s Index (Markit U.S.-<br />
PMI). 2<br />
Auftragseingang im Maschinenbau im Februar<br />
Ausland zieht Bestellungen ins Minus<br />
Der Auftragseingang im Maschinenbau<br />
hat im Februar an Fahrt verloren. Die<br />
Bestellungen der Branche verfehlten ihr Vorjahresniveau<br />
um real 10 %, teilte der Verband<br />
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau<br />
e.V. (VDMA) mit. Dem Verband zufolge<br />
war das der dritte monatliche Rückgang in<br />
Folge. „Die Konjunktur im Maschinenbau<br />
schwächt sich ab, die vielen politischen<br />
Belastungen insbesondere im internationalen<br />
Geschäft zeigen Wirkung“, sagte VDMA-<br />
Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers.<br />
Ursache für das Minus sei ein starker Rückgang<br />
der Bestellungen aus dem Ausland um<br />
16 % gewesen. Aus dem Euroraum kamen<br />
14 % weniger Aufträge, die Nicht-Euro-Länder<br />
lagen um 16 % unter dem Vorjahr. „Das<br />
Orderplus von 2 % im Inland konnte die Auslandsschwäche<br />
nicht kompensieren, weil<br />
auch hier die Belastungen steigen, etwa<br />
durch die Strukturänderungen in der Autoin-<br />
dustrie“, erläuterte Wiechers.<br />
Im Drei-Monats-Vergleich Dezember 2018<br />
bis Februar 2019 lagen die Bestellungen<br />
insgesamt um real 10 % unter dem Vorjahreswert.<br />
Während die Inlandsorders um 2 %<br />
sanken, gingen die Auftragseingänge aus<br />
dem Ausland um 13 % zurück. Die Bestellungen<br />
aus dem Euro-Raum gaben um 19 %<br />
nach, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen<br />
11 % weniger Aufträge.<br />
Das vergangene Jahr 2018 schloss die Branche<br />
in Deutschland nach Angaben des<br />
VDMA mit Umsatzvolumen von 297 Mrd. €<br />
– ein Plus von 4 % im Vorjahresvergleich.<br />
Damit belegt Deutschland wie seit 2013<br />
Platz 3 auf der weltweiten Rangliste hinter<br />
China und den USA. Der Baden-Württembergische<br />
Maschinenbau, eine der stärksten<br />
Regionen der Branche in Deutschland, hat<br />
seinen Umsatz im vergangenen Jahr ebenfalls<br />
um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr<br />
Foto: VDMA/Janto Teppe<br />
Rundgang auf der Hannover Messe mit<br />
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (3.v.l.)<br />
und VDMA-Präsident Carl Martin Welcker<br />
gesteigert – und den Umsatz auf den<br />
Rekordwert von 85,4 Mrd. € gesteigert.<br />
Gemessen am Gesamtumsatz kommt nach<br />
Zahlen des VDMA fast jede dritte Maschine<br />
aus dem Südwest-Maschinenbau.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
29
Messen<br />
und Märkte<br />
Schwerpunkt Konjunktur<br />
Reales Bruttoinlandsprodukt in Deutschland<br />
Saison- und kalenderbereinigter Verlauf<br />
Verkettete Volumenangaben in Mrd. Euro<br />
Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %<br />
810<br />
Prognose<br />
2,0<br />
Volumen (linke Skala)<br />
laufende Rate (rechte Skala)<br />
Jahresdurchschnitt (linke Skala)<br />
770<br />
1,8<br />
1,0<br />
1,4<br />
0,8<br />
730<br />
2,2<br />
2,2<br />
0,0<br />
1,7<br />
Quelle: ArGeZ<br />
690<br />
2015 2016 2017 2018 2019 2020<br />
-1 ,0<br />
Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungs-Institute<br />
Konjunktur deutlich abgekühlt<br />
Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum<br />
im Jahr 2019 deutlich gesenkt – auf ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von nur noch<br />
0,8 %. Das ist mehr als 1 % weniger als im Herbst 2018, als man noch mit 1,9%rechnete. Hingegen<br />
bestätigen die Institute ihre vorherige Prognose für das Jahr 2020: Das Bruttoinlandsprodukt dürfte<br />
dann um 1,8 % zunehmen. Das geht aus dem Frühjahrsgutachten der Gemeinschaftsdiagnose hervor,<br />
das Anfang April in Berlin vorgestellt wurde.<br />
„Der langjährige Aufschwung<br />
der deutschen Wirtschaft ist zu<br />
Ende“, sagte Oliver Holtemöller, Leiter<br />
der Abteilung Makroökonomik<br />
und stellvertretender Präsident des<br />
Leibniz-Instituts für Wirtschafts -<br />
forschung Halle (IWH). Wegen<br />
politischer Risiken hätten sich die<br />
weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
weiter eingetrübt. Aber der<br />
Konjunktureinbruch in der zweiten<br />
Jahreshälfte 2018 sei vor allem auf<br />
Produktionshemmnisse in der<br />
Industrie zurückzuführen. „Die<br />
Gefahr einer ausgeprägten Rezession<br />
halten wir jedoch bislang für<br />
gering“, ergänzte Holtemöller. Die<br />
Prognose wurde bereits Ende März<br />
2019 abgeschlossen, als eine Vermeidung<br />
eines harten Brexit noch<br />
möglich schien. Dies ist mittlerweile<br />
zwar weniger wahrscheinlich<br />
geworden, aber noch nicht ausgeschlossen.<br />
Kommt es zu einem No-<br />
DealBrexit, dürfte das Wirtschaftswachstum<br />
in diesem und im<br />
kommenden Jahr sogar deutlich<br />
niedriger ausfallen als in dieser<br />
Prognose ausgewiesen.<br />
Risiken und Gefahren<br />
Die Risiken für die deutsche und die<br />
weltweite Konjunktur haben sich<br />
gegenüber dem Herbst 2018 vergrößert.<br />
Auf internationaler Ebene liegen<br />
Gefahren im Handelsstreit zwischen<br />
den USA und China sowie im<br />
weiterhin ungeklärten Brexit-Verfahren.<br />
National belasten der Fachkräftemangel,<br />
Lieferengpässe sowie<br />
Schwierigkeiten in der Autoindustrie<br />
die Konjunktur.<br />
Ein Lichtblick sind unter anderem<br />
die Bauinvestitionen, die im Jahr<br />
2018 um 2,4% expandierten.<br />
Die dynamische Baukonjunktur<br />
werde sich angesichts prall gefüllter<br />
Auftragsbücher und einer anhaltend<br />
hohen Nachfrage nach Wohnraum<br />
wohl fortsetzen, schlossen die Forscher.<br />
Die Gemeinschaftsdiagnose<br />
wird erarbeitet vom DIW in Berlin,<br />
vom ifo Institut in München, vom<br />
IfW in Kiel, vom IWH in Halle und<br />
vom RWI in Essen. 2<br />
[ Info ]<br />
Die Langfassung des Gutachtens ist auf<br />
www.gemeinschaftsdiagnose.de/<br />
category/gutachten kostenlos abrufbar.<br />
30 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Salzgitter AG auf der Hannover Messe<br />
Virtuell durchs Hüttenwerk<br />
In einer Welturaufführung hat der<br />
Salzgitter-Konzern auf der Hannover<br />
Messe einen Rundgang durch die CO 2 -<br />
arme Stahlproduktion der Zukunft präsentiert.<br />
Mittels Virtual Reality wurden<br />
die technische Neuerung sowie die<br />
daraus folgenden Veränderungen der<br />
Anlagenkonfiguration des integrierten<br />
Hüttenwerks in Salzgitter erlebbar.<br />
Foto: Deutsche Messe AG<br />
Wen interessieren Roboter? Kanzlerinnen-Besuch auf Hannover Messe 2019<br />
Hannover Messe 2019<br />
Eine Show der Industrietechnologie von morgen<br />
215.000 Besucher nutzten die<br />
HANNOVER MESSE, um sich über neue<br />
Technologien und den aktuellen Stand bei<br />
der industriellen Produktion zu informieren.<br />
Die diesjährige Auflage der Hannover<br />
Messe hat sich vor allem auf Anwendungsszenarien,<br />
Potenziale und das Zusammenspiel<br />
von Industrie 4.0, Künstlicher Intelligenz,<br />
5G und Energielösungen<br />
konzentriert.<br />
Rund 6.500 Aussteller aus aller Welt präsentierten<br />
dabei Lösungen für die Industrieproduktion<br />
von morgen. Darunter<br />
waren mehr als 500 Beispiele für den Einsatz<br />
Künstlicher Intelligenz in der industriellen<br />
Fertigung, 5G-Anwendungen sowie<br />
Lösungen für die Energie- und Mobilitätswende.<br />
Auch die Robotik stand besonders<br />
im Fokus des Besucherinteresses. Die führenden<br />
Roboterhersteller und Robotik-<br />
Startups zeigten Anwendungsbeispiele für<br />
sämtliche Industriebranchen. „Die Maschinenbauer<br />
sind die Vorreiter in der Vernetzung<br />
der Produktion und das große Interesse<br />
der Messebesucher an der<br />
Machine-to-machine-Kommunikation sowie<br />
an der ‚Weltmaschinensprache‘ OPC UA<br />
zeigt, dass unsere Firmen ganz vorne mit<br />
dabei sind. Industrie 4.0 ist eine über viele<br />
Jahre reichende Entwicklung und die<br />
Messe hat gerade in diesem Jahr gezeigt,<br />
was schon alles erreicht ist“, sagte VDMA-<br />
Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann.<br />
Ein Schwerpunkt war das Projekt<br />
SALCOS ® (SAlzgitter Low CO 2 Steelmaking),<br />
das auf die direkte CO 2 -Vermeidung<br />
durch eine neuartige Stahlproduktion<br />
mittels Wasserstoff und<br />
erneuerbarer elektrischer Energie setzt.<br />
In einer Cave (Raum zur Projektion virtueller<br />
Realität) konnten die Besucher hautnah<br />
miterleben, wie neue Elektrolyseanlagen<br />
zur Wasserstoffproduktion, eine<br />
mehr als 100 m hohe Direktreduktionsanlage<br />
und ein Elektrolichtbogenofen entstehen.<br />
Der Salzgitter-Konzern ist eigenen<br />
Angaben zufolge gemeinsam mit<br />
Technologiepartnern als erstes Unternehmen<br />
in der Lage, eine echte Werkstopographie<br />
und tatsächliche Konstruktionsdaten<br />
als Virtual Reality zu zeigen.<br />
Einen weiteren konkreten Schritt zu einer<br />
zukunftsorientierten, klimafreundlichen<br />
Stahlproduktion haben die Salzgitter AG<br />
und Tenova auf der Hannover Messe<br />
bekanntgegeben. Mit der Unterzeichnung<br />
eines Memorandum of Understanding<br />
(MoU) bekräftigen die beiden Unternehmen<br />
ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit<br />
bei der Realisierung von SALCOS ®<br />
(SAlzgitter Low CO 2 Steelmaking).<br />
Fraunhofer-Gesellschaft auf der Hannover Messe<br />
Produkte in der Prozesskette eindeutig identifizieren<br />
Die Fraunhofer-Gesellschaft hat auf der Hannover Messe auf einem Gemeinschaftsstand<br />
ihrer Institute die Bandbreite ihrer aktuellen Forschungsprojekte gezeigt. Unter anderem<br />
ging es in einem Projekt des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik<br />
FIT darum, die Blockchain-Technologie für die Verfolgbarkeit und eindeutige Identifizierung<br />
von Produkten einzusetzen – etwa von Stahlträgern.<br />
In dem Projekt plant@Hand des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenanalyse werden<br />
Produktions- und Maschinendaten visualisiert. Ziel ist es, Prozessabläufe von Unternehmen<br />
weiter zu optimieren. Weitere Projekte entwickeln 3D-Messtechnik für die Mensch-<br />
Maschine-Interaktion sowie smarte Verbindungsstoffe für CFK (Carbonfaser) und Metall.<br />
Salzgitter AG und Tenova unterzeichnen das Memorandum<br />
of Understanding (v. l.): Dr. Volker Hille,<br />
Corporate Technology Salzgitter AG; Dr. Markus<br />
Dorndorf, Product Manager Melt Shops Tenova;<br />
Ulrich Grethe, Mitglied der Konzerngeschäftsleitung<br />
Salzgitter AG; Paolo Argenta, Executive Vice-President<br />
Upstream Tenova; Christian Schrade, Managing<br />
Director of Tenova Metals Deutschland GmbH;<br />
Dr. Alexander Redenius, Hauptabteilungsleiter Salzgitter<br />
Mannesmann Forschung GmbH.<br />
Foto: Salzgitter AG, Carsten Brand<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
31
Messen<br />
und Märkte<br />
Bericht/Nachrichten<br />
Düsseldorfer Edelstahltage<br />
2019<br />
Foto: BDS/mh<br />
Düsseldorfer Edelstahltage 2019<br />
Ambivalenter Ausblick<br />
Alle zwei Jahre trifft sich die Rostfrei-Branche zu den Düsseldorfer Edelstahltagen. Nun war es<br />
im vergangenen März wieder soweit. Im Fokus der etablierten Veranstaltung standen wie<br />
immer das Networking und aktuelle Marktinformationen. Markus Moll, Managing Director des<br />
Branchen-Informationsdienstes SMR GmbH, gab ambivalente Ausblicke auf den weiteren<br />
Konjunkturverlauf für die Rostfrei-Branche.<br />
Der Edelstahl ist hohe jährliche Wachstumsraten<br />
gewohnt – zumindest im langfristigen Durchschnitt<br />
und auf die weltweite Produktion bezogen. Das hob<br />
Markus Moll, Managing Director des spezialisierten<br />
Informationsdienstleisters und Beratungsunternehmens<br />
SMR GmbH, auf den Düsseldorfer Edelstahltagen hervor.<br />
Da der „Wachstumsmotor“ China, seit den 1990er-<br />
Jahren der treibende Faktor für den stetigen Aufwärtstrend<br />
der Branche, nun fehle, werde diese hohe Wachstumsrate<br />
auf die nächsten zehn Jahre gesehen<br />
voraussichtlich nicht mehr erreicht werden, so der österreichische<br />
Edelstahl-Experte. Während in den vergangenen<br />
drei Jahren (für 2018 mit der Einschränkung<br />
„voraussichtlich“) die EBIT-Margen entlang der gesamten<br />
Wertschöpfungskette bei der Distribution im Wesentlichen<br />
stabil geblieben sind und zwischen 13 % (2016)<br />
und 15 % (2018, voraussichtlich) lagen, unterlagen die<br />
Margen der Produzenten ewtas größeren Schwankungen<br />
(zwischen 14 % und 21 %). Dabei haben sich Moll zufolge<br />
die Kräfteverhältnisse zwischen Rohstofflieferanten,<br />
Produzenten, Handel und Verbraucher im Laufe der<br />
letzten zehn Jahre von einer überproportional hohen<br />
Marktmacht der Rohstoffseite zu einer gleichmäßigeren<br />
Verteilung zugunsten der Produzenten und des Handels<br />
verschoben – wobei die Rohstoffseite mit 46 % Marge<br />
in 2018 (voraussichtlich immer noch Löwenanteil verbucht).<br />
Für das laufende Jahr erwartete der Experte auf den<br />
deutschen Markt bezogen eher schwierigere Verhältnisse:<br />
„Erwarten Sie nicht, dass der Tiefpunkt schon<br />
erreicht ist, zumindest was die Mengen betrifft“, so<br />
Markus Moll.<br />
Neben dem Marktausblick von Markus Moll standen<br />
auf den gemeinsam vom Verlag Focus Rostfrei, der Edelstahlhandelsvereinigung<br />
(EHV) und der Informationsstelle<br />
Edelstahl Rostfrei organisierten Veranstaltung<br />
unter anderem ein Ausblick auf innovative Technologien<br />
wie dem 3D-Druck sowie der Umgang mit dem angesichts<br />
des demografischen Wandels dringlicher werdenden<br />
Personalmanagement auf dem Programm. 2<br />
Rostfreiverbrauch nach Produktform<br />
Produkt 2017 2018p Veränderung<br />
2018p zu 2017<br />
[1.000 Tonnen] [%]<br />
Cold Rolled Coils 1,190 1,218 2.3%<br />
Hot Rolled Coils 158 163 3.3%<br />
Plate Mill Plate 83 79 -4.1%<br />
Flat Products* 1,431 1,461 2.1%<br />
Welded Tube & Pipe 214 218 2.2%<br />
Seamless Tube & Pipe 15 16 9.7%<br />
Tubes & Pipes 228 234 2.7%<br />
Hot Rolled Bars 132 141 7.0%<br />
Cold Finished Bars 167 181 8.3%<br />
Forged Bars 50 52 5.1%<br />
Profiles 2 2 0.0%<br />
Wire Rod 118 128 8.7%<br />
Wire 57 59 2.3%<br />
Long Products** 409 435 6.6%<br />
TOTAL*** 1,839 1,896 3.1%<br />
*excl. CRR<br />
**excl. Wire Rod<br />
***excl. CRR, Wire Rod, Tubes & Pipe<br />
Chart Markus Moll, SMR GmbH, auf den Düsseldorfer Edelstahltagen 2019, 21. März 2019<br />
32 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Stainless 2019<br />
Internationale Edelstahlausstellung in Brünn<br />
Am 15. und 16. Mai 2019 treffen<br />
sich Edelstahlproduzenten, -händler und -<br />
anwender sowie Lieferanten von Verarbeitungsmaschinen<br />
und Verbrauchsmaterialien<br />
auf der Stainless 2019 – der Internationalen<br />
Edelstahlausstellung in Brünn in der<br />
Tschechischen Republik. Mit ihrer sehr<br />
guten nationalen und internationalen Verkehrsanbindung<br />
ist die Messestadt Brünn<br />
ein Tor zu den wachsenden Märkten Mittelund<br />
Osteuropas. Die Internationale Edelstahlausstellung<br />
– Stainless lt als eine der<br />
wichtigsten Veranstaltungen der Edelstahlindustrie.<br />
Dieses internationale Branchentreffen<br />
biete Ausstellern und Besuchern, die<br />
sich für den tschechischen und polnischen<br />
Edelstahlmarkt sowie für Märkte in angrenzenden<br />
Ländern interessieren, eine ideale<br />
Plattform für Präsentation und Kommunikation,<br />
so die Organisatoren der Stainless, die<br />
Messe Brünn und die Verlag Focus Rostfrei<br />
GmbH.<br />
Eine historische Schönheit: die Messestadt Brünn<br />
worldsteel rechnet mit<br />
steigender Nachfrage<br />
Der Weltstahlverband worldsteel geht für<br />
2019 und 2020 von einer moderat<br />
steigenden weltweiten Stahlnachfrage<br />
aus. So prognostiziert der im April<br />
veröffentlichte Short Range Outlook<br />
(SRO) für das Jahr 2019 eine Nachfrage<br />
von 1.735 Mio. t, was einem Anstieg um<br />
1,3% gegenüber 2018 entspricht. 2020<br />
soll die Nachfrage dem Verband zufolge<br />
voraussichtlich um 1,0 % auf 1.752 Mio. t<br />
steigen.<br />
[ info ]<br />
Der worldsteel-Short Range Outlook ist unter<br />
www.worldsteel.org (Media Center/Press<br />
Releases/2019) kostenlos abrufbar.<br />
Rohstahlproduktion im<br />
Februar<br />
Die Rohstahlproduktion in Deutschland<br />
lag nach Zahlen der Wirtschaftsvereinigung<br />
Stahl in den ersten zwei Monaten<br />
2019 rund 5 % unter dem Vorjahreszeitraum.<br />
Im Februar hat sich der Rückgang<br />
auf 4 % abgeschwächt. Der verhaltene<br />
Jahresstart spiegele auch die gedrückte<br />
allgemeine konjunkturelle Lage wider,<br />
so der Düsseldorfer Interessenverband.
BDS<br />
Research<br />
Neueste Zahlen aus dem Bereich Research<br />
Unterschiedliche Stimmungslagen<br />
Das Jahr 2018 ist für die deutsche Stahldistribution positiv verlaufen – doch die weltweiten<br />
Konjunkturerwartungen haben sich seit einiger Zeit eingetrübt. Handelskriege und die ungeklärten<br />
Fragen zum Brexit führen zu Unsicherheiten. Viele stahlverarbeitende Branchen in Europa sind<br />
jedoch weiterhin gut beschäftigt und erwarten auch für 2019 Wachstum. Sorgen bereitet allerdings<br />
die Situation bei den Automobilherstellern.<br />
Foto: privat<br />
Jörg Feger, Bereichsleiter<br />
Research im<br />
Bundesverband<br />
Deutscher Stahlhandel<br />
(BDS), berichtet<br />
zusammenfassend<br />
angesichts der ihm<br />
bis einschließlich<br />
Februar 2019<br />
vorliegenden Zahlen.<br />
Lagerabsatz<br />
Der Lagerabsatz verlief im Jahr 2018<br />
recht erfreulich. Insgesamt wurden<br />
bei Walzstahlfertigerzeugnissen 11,2<br />
Mio. t abgesetzt. Dies ist der beste<br />
Wert seit dem Jahr 2012. Im Vergleich<br />
zum Vorjahr wurde 1,4 %<br />
mehr Menge erreicht. Bei Rohren<br />
wurden sogar deutlichere Zuwächse<br />
verzeichnet. Auch das Jahr 2019 ist<br />
für die deutsche Stahldistribution<br />
mengenmäßig recht ordentlich<br />
gestartet. Insgesamt wurden im<br />
Januar etwas über 950.000 t Walzstahlfertigerzeugnisse,<br />
im Februar<br />
908.000 t abgesetzt. Das sind über<br />
beide Monate betrachtet 2,5 % weniger<br />
als im sehr starken Vorjahreszeitraum.<br />
Besonders der Absatz von<br />
Flachprodukten zeigte sich schwächer<br />
als zum Jahresstart 2018. Im<br />
Vergleich zu 2016 und 2017 konnte<br />
die Menge jedoch gesteigert werden.<br />
Lagerbestand<br />
Im vergangenen Jahr wurde der Jahreshöchstbestand<br />
im Sommer er -<br />
reicht. Ende Juli wurden 2,56 Mio. t<br />
Bestand gemeldet. Ab Herbst setzte<br />
dann ein deutlicher Bestandsabbau<br />
ein. Im Dezember beliefen sich die<br />
bundesweiten Lagerbestände auf<br />
2,22 Mio. t. Dabei lag der branchenweite<br />
Bestand im Vergleich zum Vorjahresmonat<br />
um knapp 5 % höher.<br />
Zum Jahresstart 2019 setzte der übliche<br />
Lageraufbau ein. Ende Februar<br />
wurden 2,44 Mio. t Bestand gemeldet.<br />
Das sind 0,6 % mehr als Ende<br />
Februar 2018 bevorratet wurden.<br />
Lagerreichweite<br />
Bei recht ordentlichen Absätzen und<br />
steigenden Beständen lag die durchschnittliche<br />
Lagerreichweite bei<br />
Walzstahlfertigerzeugnissen im Februar<br />
bei 2,7 Monaten bzw. 81 Tagen.<br />
Dies sind rund 3 % mehr als im Vorjahresmonat<br />
(vgl. Abbildung 1).<br />
Lagerverkaufspreise<br />
Den Angaben des BDS-Marktinformationsverfahrens<br />
für durchschnittliche<br />
Verkaufspreise im kleinlosigen<br />
Bereich zufolge setzte sich der teilweise<br />
recht starke Preisanstieg, der<br />
im Jahr 2016 angefangen hatte, im<br />
Jahr 2017 fort. Auch in den ersten<br />
beiden Monaten des Jahres 2018<br />
konnten bei fast allen Produkten<br />
Preissteigerungen festgestellt werden.<br />
Zwischen März und Mai gestaltete<br />
sich das Bild differenzierter.<br />
Große Veränderungen wurden dabei<br />
jedoch nicht festgestellt. In den Monaten<br />
Juni bis September waren die<br />
Preise bei fast allen Produkten wieder<br />
im Aufwärtstrend. Der Oktober,<br />
November und Dezember zeigten<br />
sich uneinheitlich. Mitunter wurden<br />
auch sinkende Preise beobachtet.<br />
Auch zum Jahresstart 2019 wurde<br />
tendenziell von fallenden Verkaufspreisen<br />
berichtet. (vgl. Abbildungen<br />
2 und 3). 2<br />
[ Info ]<br />
Fragen zu den genannten statistischen<br />
Größen beantwortet im Bundesverband<br />
Deutscher Stahlhandel (BDS) Jörg Feger,<br />
Bereichsleiter Research:<br />
Feger-BDS@stahlhandel.com<br />
34 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Quelle Bild 2 u. 3: BDS Quelle: Statistisches Bundesamt/BDS<br />
lagerAbsatz und Lagerreichweite der Stahldistribution Abb. 1<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Preisentwicklung bei Langprodukten Abb. 2<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
Index (Januar 2010 = 100)<br />
Formstahl Breitflanschträger Stabstahl Betonstahl in Stäben Betonstahlmatten<br />
Preisentwicklung bei Flachprodukten und Rohren Abb. 3<br />
Index (Januar 2010 = 100)<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
n Absatzindex (2007 = 100)<br />
n Lagerreichweite in Tagen<br />
200<br />
180<br />
160<br />
92<br />
97 94<br />
90 93<br />
99<br />
101<br />
96 95 100<br />
101<br />
96<br />
96<br />
90<br />
95 140<br />
89<br />
91<br />
120<br />
100<br />
55<br />
80<br />
78 78 75 81 78 78 78 75 75 72 78 78 84 75 72 123 75 81<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Ø<br />
2015<br />
Ø<br />
2016<br />
Ø<br />
2017<br />
Ø<br />
2018<br />
Ø<br />
2019<br />
Feb.<br />
2018<br />
Mär.<br />
2018<br />
Apr.<br />
2018<br />
Mai<br />
2018<br />
Juni<br />
2018<br />
Juli<br />
2018<br />
Aug.<br />
2018<br />
Sep.<br />
2018<br />
Okt.<br />
2018<br />
Nov.<br />
2018<br />
Dez.<br />
2018<br />
Jan.<br />
2019<br />
Feb.<br />
2019<br />
1. Q. 2010<br />
2. Q. 2010<br />
3. Q. 2010<br />
4. Q. 2010<br />
1. Q. 2011<br />
2. Q. 2011<br />
3. Q. 2011<br />
4. Q. 2011<br />
1. Q. 2012<br />
2. Q. 2012<br />
3. Q. 2012<br />
4. Q. 2012<br />
1. Q. 2013<br />
2. Q. 2013<br />
3. Q. 2013<br />
4. Q. 2013<br />
1. Q. 2014<br />
2. Q. 2014<br />
3. Q. 2014<br />
4. Q. 2014<br />
1. Q. 2015<br />
2. Q. 2015<br />
3. Q. 2015<br />
4. Q. 2015<br />
1. Q. 2016<br />
2. Q. 2016<br />
3. Q. 2016<br />
4. Q. 2016<br />
1. Q. 2017<br />
2. Q. 2017<br />
3. Q. 2017<br />
4. Q. 2017<br />
1. Q. 2018<br />
2. Q. 2018<br />
3. Q. 2018<br />
4. Q. 2018<br />
1. Q. 2019<br />
1. Q. 2010<br />
2. Q. 2010<br />
3. Q. 2010<br />
4. Q. 2010<br />
1. Q. 2011<br />
2. Q. 2011<br />
3. Q. 2011<br />
4. Q. 2011<br />
1. Q. 2012<br />
2. Q. 2012<br />
3. Q. 2012<br />
4. Q. 2012<br />
1. Q. 2013<br />
2. Q. 2013<br />
3. Q. 2013<br />
4. Q. 2013<br />
1. Q. 2014<br />
2. Q. 2014<br />
3. Q. 2014<br />
4. Q. 2014<br />
1. Q. 2015<br />
2. Q. 2015<br />
3. Q. 2015<br />
4. Q. 2015<br />
1. Q. 2016<br />
2. Q. 2016<br />
3. Q. 2016<br />
4. Q. 2016<br />
1. Q. 2017<br />
2. Q. 2017<br />
3. Q. 2017<br />
4. Q. 2017<br />
1. Q. 2018<br />
2. Q. 2018<br />
3. Q. 2018<br />
4. Q. 2018<br />
1. Q. 2019<br />
Quartoblech Bandblech Kaltgewalztes Blech OV Blech Quad. & RE-Rohr Nahtloses Rohr<br />
Absatz und Lagerreichweite<br />
der<br />
Stahldistribution<br />
Preisentwicklung<br />
bei Langprodukten<br />
Preisentwicklung bei<br />
Flachprodukten und<br />
Rohren<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
35
Quelle: BDS<br />
XXXXXXXXXX<br />
BDS<br />
XXXXX Berufsbildung A XXXXX<br />
Neuer Jahrgang startet zum Juli<br />
Fernstudium<br />
Unabhängig von den Querelen um die offizielle Einordnung in den DQR (vgl.<br />
Bericht auf der Folgeseite) setzt der BDS seine Vorbereitungen für den Start<br />
des Jahrgangs 2019 im verbandlichen Fernstudium fort, das dreijährig berufs -<br />
begleitend und mit einem Abschluss als Betriebswirt/-in angeboten wird.<br />
Die neuen Fernstudentinnen und -studenten starten diesen Teil ihrer beruflichen<br />
Bildungskarriere Ende Juni/Anfang Juli 2019 mit einer Präsenzveranstaltung im<br />
niedersächsischen Soltau.<br />
Sie bringen<br />
Motivation mit?<br />
Wir liefern das<br />
Know-how!<br />
Machen Sie berufliche Karriere durch ein<br />
berufsbegleitendes Fernstudium<br />
fern-studium<br />
Betriebswirt Stahlhandel (BDS)<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Mit diesem Flyer<br />
wirbt der Bundesverband<br />
Deutscher<br />
Stahlhandel (BDS)<br />
für den neuen<br />
Jahrgang seines<br />
Fernstudiums.<br />
Die künftigen Betriebswirte<br />
Stahlhandel BDS sollen nach drei<br />
Jahren Blended-Learning, also des<br />
in gemischten Formen stattfindenden<br />
Studierens, in der Lage sein,<br />
neue und komplexe Aufgaben ihres<br />
beruflichen Umfelds zu lösen, entsprechende<br />
Prozesse in Wertschöpfungsketten<br />
zu steuern sowie mit<br />
den häufigen und unvorhersehbaren<br />
Veränderungen umzugehen.<br />
Ziele und Inhalte<br />
Mit diesem Studienziel, das der Stufe<br />
7 des achtteiligen Deutschen Qualifikationsrahmens<br />
(DQR) entspricht,<br />
werden sich die Lernenden mit<br />
einem Fächerkanon aus technischen,<br />
wirtschaftlichen und methodischen<br />
Themen beschäftigen – von der<br />
Material- und Produktkunde sowie<br />
Anarbeitungsfragen über kaufmännische<br />
Grundlagen und Aspekte der<br />
Unternehmensführung bis hin zu<br />
den methodischen Gesichtspunkten,<br />
die sich in der Ausbildereignung<br />
manifestiert, die seit zwei Jahren in<br />
das Angebot integriert ist.<br />
Die Vermittlung von Wissen und<br />
Know-how erfolgt im Fernstudium<br />
des Bundesverbands Deutscher<br />
Stahlhandel dreistufig und muss<br />
unterrichtsbegleitend in zahlreichen<br />
Prüfungen nachgewiesen werden:<br />
z Die Präsenzveranstaltungen in<br />
einer Größenordnung von durchschnittlich<br />
fünf bis sechs Tagen<br />
pro Jahr dienen dem Aufbau von<br />
Lerngruppen sowie der Vorstellung<br />
der inhaltlichen, methodischen und<br />
organisatorischen Herausforderungen.<br />
z Die Vermittlung der Informationen<br />
in den drei Fachbereichen Technik,<br />
Wirtschaft und Methoden erfolgt<br />
über insgesamt etwa 60 Module,<br />
die gemäß Studienordnung im<br />
Fernunterricht zur Verfügung<br />
gestellt und<br />
z durch virtuelle Seminare begleitet<br />
werden, die auf die jeweiligen Prüfungsaufgaben<br />
vorbereiten. Dazu<br />
nutzt der BDS die elektronische<br />
Lernplattform openOLAT sowie die<br />
Seminarsoftware vitero. Entsprechende<br />
Leistungen sind in den<br />
quartalsmäßig zu entrichtenden<br />
Studiengebühren enthalten.<br />
Die auf drei Jahre verteilten Prüfungsleistungen<br />
werden gemäß Prüfungsordnung<br />
für das Abschlusszeugnis<br />
der Betriebswirtinnen und<br />
Betriebswirte Stahlhandel in fünf<br />
Zensuren verdichtet: Technik, Wirtschaft,<br />
Methoden sowie der Bewertung<br />
der anzufertigenden Studienarbeit<br />
und der Leistungen in Sachen<br />
Ausbildereignung.<br />
Rahmen und Organisation<br />
Studien- und Prüfungsordnung für<br />
den Jahrgang 2019 werden derzeit<br />
noch einmal aktualisiert und in ihren<br />
endgültigen Fassungen der neuen<br />
Studentengruppe im Rahmen der<br />
Präsenzveranstaltung vom 29.6. bis<br />
2.7.19 in Soltau vorgestellt. Bereits<br />
jetzt steht fest, dass die zweite Anwesenheitspflicht<br />
für diese Gruppe vom<br />
10.-13.1.20 in Rösrath bei Köln<br />
besteht.<br />
Der zu vergebende Abschlusstitel<br />
(„Betriebswirtin Stahlhandel<br />
BDS“/“Betriebswirt Stahlhandel<br />
BDS“) ist markenrechtlich geschützt,<br />
das gesamte Fernstudium durch die<br />
Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht<br />
(ZFU) zugelassen. Außerdem<br />
unterliegt der anbietende Berufsbildungsbereich<br />
des BDS dem Qualitätsmanagement<br />
nach ISO<br />
9001:2015.<br />
Voraussetzungen für eine Zulassung<br />
zum BDS-Fernstudium sind<br />
eine abgeschlossene Ausbildung,<br />
zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung<br />
mindestens fünf Jahre Berufserfahrung<br />
sowie eine studienbegleitende<br />
Anstellung im Werkstoffgroßhandel.<br />
Aus den bisher 20 abgeschlossenen<br />
Jahrgängen ergibt sich eine Community<br />
von rund 500 Absolventen,<br />
die immer noch in den Unternehmen<br />
insbesondere der Stahldistribution<br />
engagiert, teilweise selber als Referenten,<br />
Autoren bzw. Prüfer in die<br />
Aus- und Weiterbildung ihrer Unternehmen<br />
oder auch in das BDS-Fernstudium<br />
eingestiegen sind, vor allem<br />
aber dafür sorgen, dass in der Branche<br />
ein Qualifizierungssystem nach<br />
DQR angeboten werden kann – von<br />
der Ausbildung auf Stufe 4 über die<br />
Lernteams (5) und die Seminare (6)<br />
bis hin zum Abschluss auf Stufe 7.<br />
Begleitet werden soll diese Entwicklung<br />
in Zukunft noch intensiver<br />
durch die Aktivitäten der Stiftung<br />
des Deutschen Stahlhandels, die im<br />
Sinne einer Stahlhandelsakademie<br />
auch für die Zielgruppe der Absolventinnen<br />
und Absolventen lebenslanges<br />
Lernen auf hohem Niveau<br />
ermöglichen will. 2<br />
[ Info ]<br />
Für Auskünfte und Anmeldungen zuständig<br />
ist der BDS mit Sitz in Düsseldorf:<br />
Telefon 0211 86497-0. E-Mail:<br />
Wolfgart-BDS@stahlhandel com<br />
Wynands-BDS@stahlhandel.com<br />
36 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Berufsbildpositionen zur Ausbildung sind in der Diskussion<br />
Standards und Branchenausprägungen<br />
Derzeit wird nicht nur die Neuordnung des Ausbildungsberufs für angehende Kaufleute<br />
im Groß- und Außenhandel beraten, überarbeitet werden gegenwärtig auch die<br />
Standardberufsbildpositionen. Dabei mitreden und -bestimmen kann allerdings nur,<br />
wer in den entsprechenden Gremien durch einen der Sozialpartner vertreten ist.<br />
Seit dem vergangenen Jahr<br />
planen das Bundesbildungsministerium<br />
und das Bundeswirtschaftsministerium<br />
in Zusammenarbeit mit<br />
dem Bundesinstitut für Berufsbildung<br />
eine Modernisierung der Standardberufsbildpositionen.<br />
Dabei handelt<br />
es sich um Festlegungen, die in<br />
sämtlichen Ausbildungsordnungen<br />
verbindlich abgebildet sind und von<br />
allen ausbildenden Unternehmen<br />
während der Ausbildung vermittelt<br />
werden müssen.<br />
In den aktuellen Diskussionen<br />
der Sozialpartner, die in einer<br />
Arbeitsgruppe aus Arbeitgebern<br />
sowie Arbeitnehmern und Ländervertretern<br />
zusammenwirken, geht<br />
es beispielsweise darum,<br />
z ggf. die bisherigen Standardberufsbildpositionen<br />
„Berufsausbildung,<br />
Arbeits- und Tarifrecht“ sowie „Aufbau<br />
und Organisation des Ausbildungsbetriebes“<br />
zu der neuen Standardberufsbildposition<br />
„Organisation des Ausbildungsbetriebes,<br />
Berufsbildung sowie der<br />
für den Arbeitsplatz wesentlichen<br />
Rechtsvorschriften, insbesondere<br />
des Arbeits- und Tarifrechts“<br />
zusammenzuführen.<br />
z Außerdem könnte die aktuelle<br />
Standardberufsbildposition<br />
„Umweltschutz“ unter der Überschrift<br />
„Nachhaltigkeit“ weiterentwickelt<br />
werden.<br />
z Darüber hinaus gibt es Bestrebungen,<br />
eine ganz neue Standardberufsbildposition<br />
„Datenschutz und<br />
Datensicherheit; Digitalisierung“<br />
zu schaffen.<br />
z In Sachen der Standardberufsbildposition<br />
„Sicherheit und Gesundheitsschutz“<br />
dürften die Festlegungen<br />
im Wesentlichen unverändert<br />
bleiben.<br />
Die anstehenden Reformthemen sind<br />
regelmäßig auch Gegenstand der<br />
Beratungen im Berufsbildungsausschuss<br />
des Groß- und Außenhandels.<br />
In dem Gremium ist Dr. Ludger Wolfgart<br />
persönliches Mitglied. Im Bundesverband<br />
Deutscher Stahlhandel<br />
(BDS) ist er für Brancheninformationen<br />
und Berufsbildung zuständig.<br />
2<br />
BDS kämpft für die Einordnung seines Fernstudiums<br />
DQR und kein Ende<br />
Auf formale Gründe bezieht sich die Absage des BMBF, die zum Jahreswechsel 2018/19<br />
vom FDL beantragte Zuordnung von Fernkursen in den DQR vorzunehmen. Unter den<br />
eingereichten Angeboten befindet sich auch das Fernstudium des BDS, der sich nun um<br />
so intensiver an den Gesprächen über das weitere Vorgehen beteiligen wird.<br />
Im Mittelpunkt des Streits<br />
steht die Frage, ob nur nach klassischen<br />
Kriterien formale Bildungsabschlüsse<br />
in den Deutschen Qualifikationsrahmen<br />
(DQR) offiziell<br />
eingestuft werden können/dürfen.<br />
Der DQR ist ein achtstufiges Schema,<br />
in das alle schulischen, akademischen<br />
und beruflichen Bildungsangebote<br />
eingeordnet und damit vergleichbar<br />
(nicht gleich) gemacht werden können.<br />
Der Bundesverband Deutscher<br />
Stahlhandel (BDS) sieht in der Verweigerung<br />
einer Einordnung beispielsweise<br />
seines Fernstudienangebots<br />
und weitere sogenannter<br />
non-formaler Abschlüsse eine wettbewerbsverzerrende<br />
Diskriminierung.<br />
Unter ihr haben insbesondere<br />
auch die Absolventen zu leiden, die<br />
in dem durchlässigen DQR-System<br />
zu weiteren Qualifikationsangeboten<br />
wechseln wollen. Der BDS bleibt deshalb<br />
bis zu einer inhaltlichen Entscheidung<br />
der zuständigen Stellen<br />
dabei, sein dreijähriges Betriebswirtschafts-Fernstudium<br />
nach transparenten<br />
Kriterien auch weiterhin selbst<br />
einzuschätzen – auf DQR-Stufe 7.<br />
Weitere Beratungen<br />
Der BDS hat angekündigt, noch im<br />
Laufe des April unter dem Dach des<br />
Fernlernverbandes Forum DistancE-<br />
Learning (FDL) an den Beratungen<br />
über notwendige Reaktionen auf die<br />
Ablehnung aus dem Bundesministerium<br />
für Forschung und Entwicklung<br />
(BMBF) mit zu beraten. Dazu<br />
gab es im Rahmen einer speziellen<br />
Council-Sitzung Gelegenheit, aber<br />
auch bei einem Treffen des Vorstands,<br />
der ebenfalls in der Woche<br />
nach Ostern gekommen ist. Der BDS<br />
ist seit einigen Jahren Mitglied im<br />
FDL. Dr. Ludger Wolfgart ist als BDS-<br />
Bereichsleiter Berufsbildung gewählter<br />
Sprecher der Fachgruppe der<br />
etwa 60 darin vertretenen Fernunterrichtsanbieter<br />
und damit auch im<br />
FDL-Vorstand vertreten. 2<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
37
Verbände<br />
XXXXXXXXXX<br />
und Politik<br />
Berichte/Nachrichten<br />
Vielfältigste Aktivitäten des BME<br />
Digitalisierung und Beschaffung<br />
Was die Digitalisierung für die Beschaffung bedeutet, das interessiert den BME in besonderer Weise. Der Einkaufsverband<br />
versucht deshalb in letzter Zeit verstärkt sowie vielfältig, zu diesem Thema Informationen zu generieren und für seine<br />
Klientel attraktiv aufzubereiten. Das ist auch für die Martktpartner auf der anderen Seite des Tisches wichtig.<br />
So dominierten Ergebnisse<br />
einer Umfrage die BME-Tage im März<br />
in Düsseldorf, wo auch ein neuer Service<br />
für die Verbandsmitglieder vorgestellt<br />
wurde. Und Ende des Monats<br />
gab es in Mannheim traditionelle Preisverleihungen.<br />
Umfrageergebnisse<br />
„Digitalisierung in Supply Chains“<br />
hieß eine gemeinsame Online-Erhebung<br />
des Bundesverbandes Materialwirtschaft,<br />
Einkauf und Logistik e.V.<br />
(BME) und der Hochschule Fulda.<br />
Angesprochen worden waren 251 Supply<br />
Chain-Manager und Führungskräfte<br />
in angrenzenden Bereichen wie<br />
IT, Logistik, Produktion oder Materialfluss.<br />
Gefragt wurde, wie intensiv<br />
elektronische Lösungen wie beispielsweise<br />
Blockchain, Cloud Computing,<br />
3D-Druck oder künstliche Intelligenz<br />
für die Digitalisierung der Lieferketten<br />
genutzt werden.<br />
„Die Umfrage-Ergebnisse haben<br />
uns überrascht“, sagte Carsten Knauer,<br />
BME-Leiter Sektion Logistik/SCM, Referent<br />
Fachgruppen, Mitte März auf den<br />
10. BME-eLÖSUNGSTAGEN in Düsseldorf.<br />
So seien viele der aktuellen Digitalisierungstechnologien<br />
wie Roboter<br />
und Automatisierung oder selbstfahrende<br />
Fahrzeuge den befragten Supply<br />
Chain Managern zwar bekannt. Dennoch<br />
gebe es weitere elektronische<br />
Lösungen, die von ihnen kaum oder<br />
gar nicht genutzt würden. Knauer appelliert<br />
deshalb an die Entscheidungsträger,<br />
bestehende Wissenslücken schnell<br />
zu schließen. Ansonsten bestehe insbesondere<br />
für KMU die Gefahr, den<br />
Digitalisierungszug zu verpassen. Darüber<br />
hinaus müsse das Berufsbild des<br />
Supply Chain-Managers künftig einen<br />
stärkeren Bezug zum industriellen<br />
Internet der Dinge als bisher haben.<br />
Lösungstage<br />
Die fortschreitende Digitalisierung der<br />
Wirtschaft hat gravierende Auswirkungen<br />
auf den Einkauf. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
digitaler elektronischer<br />
Lösungen sind unbegrenzt. So identifizieren<br />
intelligente Suchalgorithmen<br />
und Big Data Analytics schon heute<br />
Versorgungsrisiken und automatisierte<br />
Lieferantenbewertungen in Echtzeit.<br />
Das sind weitere zentrale Ergebnisse<br />
der 10. Lösungstage.<br />
Rund 1.400 teilnehmende Einkaufs-,<br />
Logistik- und Supply Chain<br />
Manager sowie knapp 100 Aussteller<br />
und Partner hatten sich zweitägig in<br />
acht Fachforen, 14 Round Tables, 14<br />
Solution Foren und zehn Workshops<br />
das Rüstzeug für die Digitalisierung<br />
ihrer Geschäftsprozesse zu holen versucht.<br />
Der jährlich stattfindende Kongress<br />
für elektronische Beschaffung<br />
stand 2019 unter dem Motto „Fit für<br />
die Zukunft: eLösungen konsequent<br />
ausrollen“.<br />
Neuer Service<br />
Als neuen Service für seine Mitglieder<br />
und andere interessierte Unternehmen<br />
hat der BME unterdessen eine Online-<br />
Recherche-Plattform für Einkaufssoftware<br />
eingerichtet. Firmen, die sich<br />
erstmals mit der Anschaffung einer<br />
eProcurement-Lösung befassen oder<br />
auch Alternativen zur eingesetzten<br />
Lösung evaluieren wollen, können dies<br />
ab sofort kostenlos über den BME-eProcurement-Matchmaker<br />
(www.bme.de/epromm) tun.<br />
Das Projekt hat der Verband mit<br />
zwei Partnern umgesetzt: Die Trovarit<br />
AG, Aachen, ein Spin-off des FIR e.V.<br />
an der RWTH Aachen und einer der<br />
führenden unabhängigen Marktanalysten<br />
für Business-Software, ist für<br />
die technische Plattform verantwortlich.<br />
Für die Entwicklung und ständige<br />
Optimierung der inhaltlichen Struktur<br />
arbeitet der BME mit der amcGroup<br />
zusammen, einer Einkaufsberatung<br />
mit dem Fokus auf ganzheitlicher<br />
Transformation und Digitalisierung<br />
des Einkaufs.<br />
Was bietet der BME-eProcurement-<br />
Matchmaker?<br />
Durch den Matchmaker soll der Einkaufsleiter<br />
oder verantwortliche IT-<br />
38 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Experte online mit 150 Lösungen<br />
einen nahezu kompletten Marktüberblick<br />
über die möglichen Lösungen<br />
finden. Entsprechend kann er nach<br />
den wichtigsten Software-Modulen<br />
recherchieren, die sich an den Prozessen<br />
des strategischen und operativen<br />
Einkaufs orientieren. Zudem hat<br />
der Nutzer die Möglichkeit, bei derzeit<br />
über 40 Lösungen sein individuelles<br />
Anforderungsprofil einzugeben, um<br />
auf Knopfdruck die geeignetsten Einkaufslösungen<br />
für seine Anforderungen<br />
zu finden.<br />
Preisverleihungen<br />
Etwas klassischer mutete in diesem<br />
Jahr die Verleihung des BME-Wissenschafts-<br />
und des -Hochschulpreises<br />
an. Der Gewinner des „BME-Wissenschaftspreises<br />
2019“ ist Dr. Jörg Ralf<br />
Rottenburger, WHU – Otto Beisheim<br />
School of Management. In seiner englischsprachigen<br />
Arbeit untersuchte er<br />
die Bedeutung von Täuschungen in<br />
Einkaufsverhandlungen.<br />
Im Wettbewerb „BME-Hochschulpreis<br />
2019“ konnten sich bei den „Uni-<br />
Abschlussarbeiten“ Maria Beranek,<br />
Technische Universität Dresden, mit<br />
dem Thema „Preis- und Qualitätsentscheidungen<br />
in einer Closed-Loop Supply<br />
Chain mit imperfekter Produktion“<br />
und in der Kategorie „FH-Abschlussarbeiten“<br />
Aline Albersmann, Fachhochschule<br />
Münster, mit dem Thema<br />
„Critical Parts Management – Optimize<br />
preventive and reactive approaches to<br />
manage supply shortages at the Hella<br />
Group“ durchsetzen.<br />
Die BME-Preise wurden im Rahmen<br />
des 12. Wissenschaftlichen Symposiums<br />
„Supply Management“ des<br />
BME in Mannheim (25.-26. März 2019)<br />
verliehen. Studierende, Absolventen,<br />
Wissenschaftler und Praktiker trafen<br />
sich zum fachlichen Austausch an der<br />
Universität Mannheim. 2<br />
Klima- und Umweltschutz<br />
BDI und Partner loben Innovationspreis aus<br />
Der BDI, Fraunhofer ISI sowie das Bundesumweltministerium haben für 2020 als<br />
gemeinsame Veranstalter den Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt (IKU) ausgelobt.<br />
Mit dem IKU zeichnen das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und<br />
nukleare Sicherheit sowie der Bundesverband der Deutschen Industrie traditionell alle zwei<br />
Jahre Ideen aus, die im Bereich Klima- und Umweltschutz neue Wege aufzeigen. In sieben<br />
Kategorien werden innovative Technologien, Techniken, Verfahren, Prozesse, Produkte,<br />
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle für den Klima- und Umweltschutz prämiert. Mit der<br />
Auszeichnung wollen die Veranstalter das Engagement von Wirtschaft und Forschung für<br />
Klima- und Umweltschutz würdigen. In diesen Zusammenhängen steht das Fraunhofer-<br />
Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe für die Analysen zur Entstehung<br />
und zu Auswirkungen von Neuerungen.<br />
Die Kategorien sind:<br />
z Prozessinnovationen für den Klimaschutz,<br />
z Produkt- und Dienstleistungsinnovationen für den Klimaschutz,<br />
z umweltfreundliche Technologien,<br />
z umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen,<br />
z Klima- und Umweltschutz-Technologietransfer in Entwicklungs- und Schwellenländer und<br />
in Staaten Osteuropas,<br />
z Innovationen und biologische Vielfalt,<br />
z Nutzung des digitalen Wandels für klima- und umweltfreundliche Innovationen.<br />
Bis zum 28.6.19 können deutsche Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Einzelpersonen<br />
ihre Bewerbungen einreichen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Rahmen<br />
einer feierlichen Preisverleihung im März 2020 geehrt. Jeder Gewinner erhält eine persönliche<br />
Auszeichnung sowie ein Preisgeld in Höhe von 25.000 €.<br />
[ Info ]<br />
Auf der Website des IKU (www.iku-innovationspreis.de) sind die Bewerbungsunterlagen<br />
sowie weitere Informationen zu dem Wettbewerb zu finden.<br />
Foto: BGA<br />
„Wachsender Dienstleistungssektor“,<br />
BGA-Präsident Dr. Holger Bingmann<br />
Deutlicher Dienstleister<br />
BGA zur Wirtschaftsentwicklung<br />
Im Zuge aktueller Konjunkturberichterstattung<br />
hat der BGA ein gewichtiges<br />
Argument für die eigene Bedeutung<br />
entdeckt und deutlich formuliert: die<br />
wachsende Rolle der Dienstleistungen.<br />
„Deutschland entwickelt sich zu einem<br />
führenden Dienstleistungsstandort. Services<br />
rund um Unternehmen, um Produkte<br />
und Technologien werden immer<br />
wichtiger für den Erfolg unserer Volkswirtschaft.<br />
Innerhalb von zehn Jahren<br />
sind Umsätze und Beschäftigung um ein<br />
Drittel gestiegen.“ Dies erklärte Dr. Holger<br />
Bingmann, Präsident des Bundesverbandes<br />
Großhandel, Außenhandel,<br />
Dienstleistungen (BGA).<br />
Mit diesem neuen Gewicht formulierte<br />
der Verbandschef im März auch gleich<br />
zwei wichtige Kritikpunkte:<br />
z Dass die EU sich bei einem so wichtigen<br />
Zukunftsthema wie einer Digitalsteuer<br />
nicht einigen könne, zeige die wahren<br />
Probleme der Gemeinschaft auf. Ziel<br />
müsse es sein, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit<br />
Europas zu stärken –<br />
nicht zuletzt, um auch künftig weiter auf<br />
Augenhöhe mit China und den USA<br />
sprechen zu können.<br />
z Die Vorstellungen für eine deutsche<br />
Industriepolitik führten ebenfalls in die<br />
falsche Richtung. „So wichtig auch für<br />
unsere B2B-Dienstleister die Industrie<br />
als Auftraggeber ist; das Rückgrat bilden<br />
die weit über 1.000 meist unbekannten,<br />
mittelständischen Weltmarktführer<br />
– sie bedürfen einer<br />
Aufmerksamkeit durch die Politik<br />
anstatt einer Vorgabe von Zielwerten.“<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
39
Verbände<br />
XXXXXXXXXX<br />
und Politik<br />
Berichte<br />
Foto: Werkzeug Weber GmbH<br />
Neue Ansätze im Produktionsverbindungshandel<br />
Start-up gegründet<br />
Die Digitalisierung stellt auch den Produktionsverbindungshandel vor große Herausforderungen und Chancen.<br />
Deshalb haben fünf Unternehmen und das E/D/E kürzlich eine neue Firma gegründet, die als Start-up den<br />
technologisch getriebenen Wandel in der Branche aktiv angehen will – u.a. zum 3D-Druck und zur Künstlichen<br />
Intelligenz. Entstanden war die Idee bereits vor zwei Jahren in einem kleinen Industrie-Loft in San Francisco.<br />
Beim Notartermin zur<br />
Gründung der PVH<br />
FUTURE LAB GmbH<br />
(v.l.): Dr. Andreas<br />
Trautwein, Norman<br />
Koerschulte, Vanessa<br />
Weber, Thilo Broksch,<br />
Andreas Schröter,<br />
Frederik Diergarten,<br />
Elena Fendt-Zehetbauer<br />
und Karl Grohe.<br />
Bereits im Frühsommer 2017<br />
hatte sich eine Gruppe von 25 Jungunternehmern<br />
zusammen mit E/D/E-<br />
Verantwortlichen auf den Weg ins Silicon<br />
Valley und nach San Francisco<br />
gemacht. Dort waren die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer eine Woche<br />
lang bei Big Playern wie Google, Salesforce<br />
oder AirBnB zu Gast – genauso<br />
wie bei zahlreichen Start-ups, Universitäten<br />
und weiteren Partnern. Dabei<br />
war schnell klar: Diese Eindrücke und<br />
Erfahrungen, aber auch das Kontaktnetzwerk<br />
waren für die Teilnehmer<br />
so wertvoll, dass daraus für die Zukunft<br />
sozusagen unter dem Dach des Einkaufsbüros<br />
Deutscher Eisenhändler<br />
(E/D/E) etwas Produktives entstehen<br />
musste: die PVH FUTURE LAB GmbH.<br />
Die Vision ist klar: „Wir wollen das<br />
Leben der Endkunden jeden Tag ein<br />
wenig besser machen und dadurch den<br />
einzelnen Händler im PVH bei seiner<br />
Zukunftsgestaltung aktiv unterstützen“,<br />
erläutert Christina Fendt als eine<br />
von sieben Gründern. Thilo Brocksch,<br />
der als Geschäftsbereichsleiter Mitgliederentwicklung<br />
und Prokurist im<br />
E/D/E die neue Firma mitbegründet<br />
hat und dort Geschäftsführer ist,<br />
ergänzt: „Die Gründung eines Startups<br />
in dieser Konstellation ist einzigartig<br />
in der Geschichte der E/D/E-<br />
Gruppe sowie deren Händler und zeigt<br />
die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege<br />
einzuschlagen.<br />
Folgende Unternehmen und Jungunternehmer<br />
haben sich mit dem<br />
E/D/E, das mit über 960 angeschlossenen<br />
mittelständischen Handelsunternehmen<br />
im PVH und rund 250 weiteren<br />
Einzelhändlern als größter<br />
europäischer Einkaufs- und Marketingverbund<br />
gilt, in der nun gegründeten<br />
neuen Einheit zusammengeschlossen:<br />
z Christina Fendt (Eisen-Fendt GmbH<br />
aus Marktoberdorf),<br />
zKarl Grohe (P. Grohe GmbH aus Bruneck<br />
in Italien),<br />
z Norman Koerschulte (Karl Koerschulte<br />
GmbH aus Lüdenscheid),<br />
z Andreas Schröter (HUG Technik und<br />
Sicherheit GmbH aus Ergolding) und<br />
z Vanessa Weber (Werkzeug-Weber<br />
GmbH & Co. KG aus Aschaffenburg).<br />
Als Geschäftsführer wurde neben Thilo<br />
Brocksch auch Frederik Diergarten<br />
bestellt, der als Verantwortlicher für<br />
das Business NETZWERK im E/D/E<br />
das Vorhaben ebenfalls von Anfang<br />
an begleitet hatte.<br />
3D-Druck und<br />
Künstliche Intelligenz<br />
Im Mittelpunkt aller Aktivitäten der<br />
Beteiligten steht – wie durch Christina<br />
Fendt formuliert – die Frage, wie für<br />
Kunden technologisch getriebene<br />
Mehrwerte geschaffen und, wie diese<br />
dadurch begeistert werden können.<br />
Dies gelinge aktuell mit dem ersten<br />
Projekt: Rapid3D. So hieß es jetzt aus<br />
Wuppertal.<br />
Bereits 25 E/D/E-Händler nutzen<br />
dieses neue Geschäftsmodell für professionellen<br />
3D-Druck in Kunststoff<br />
und Metall. Die Lizenznehmer erhalten<br />
dabei von dem neuen Unternehmen<br />
alle Komponenten, die benötigt werden.<br />
Dazu gehören u.a. die Prozessplattform,<br />
das entsprechende Produzenten-Netzwerk,<br />
ein Marketing- und<br />
Trainingspaket sowie ein umfassendes<br />
zweistufiges Supportkonzept.<br />
Ebenso beschäftigt man sich in<br />
dem Start-up mit Prototypen für die<br />
Nutzbarmachung von Machine Learning/Künstlicher<br />
Intelligenz. Die Verknüpfung<br />
intelligenter, speziell auf<br />
den PVH angepasster Analysesysteme<br />
mit Produkt- und Verkaufsdaten zur<br />
Steigerung der Verkaufserfolgsquote<br />
beim Kunden soll den beteiligten<br />
Händlern bereits 2019 direkten Mehrumsatz<br />
ermöglichen. Ebenso gebe es<br />
bereits die ersten Prototypen von sogenannten<br />
Chatbots (lernende Text- und<br />
Sprach-Dialogsysteme) für unterschiedliche<br />
Anwendungsgebiete in<br />
der Branche.<br />
„Diese Gruppe junger Unternehmerinnen<br />
und Unternehmer schafft<br />
mit authentischer Leidenschaft,<br />
Begeisterung für digitale Zukunftsthemen<br />
und einer innovativen Form<br />
der Zusammenarbeit Raum für Neues.<br />
Es ist faszinierend, was daraus entsteht.<br />
Wir als E/D/E und ich persönlich<br />
sind stolz darauf und wollen diese Initiative<br />
weiter nachhaltig fördern“,<br />
betonte Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender<br />
der E/D/E-Geschäftsführung,<br />
in diesen Zusammenhängen. 2<br />
40 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
FDL-Fachforum in Berlin<br />
Künstliche Intelligenz<br />
Einmal im Jahr lädt der FDL zum FachForum nach Berlin ein, der themenspezifischen Fachtagung der<br />
Fernunterrichts- und Fernstudienbranche, in diesem Jahr am 4.11. zum Thema KI. (Vgl. 4/19, S. 39)<br />
Im Rahmen der Veranstaltung werden aktuelle Trends in der Weiterbildung – speziell im mediengestützten<br />
Lernen – aus wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, bildungspolitischen und<br />
praxisorientierten Perspektiven beleuchtet.<br />
In Anlehnung an das Wissenschaftsjahr 2019<br />
widmet das Forum DistancE-Learning (FDL) seine Jahrestagung<br />
dem Thema KI und fragt unter dem Titel<br />
„Künstliche Intelligenz und Bildung – Chancen für DistancE-Learning“,<br />
welche Herausforderungen und Perspektiven<br />
aktuelle sowie zukünftige Entwicklungen für<br />
Fernstudien- und -unterrichtsmodelle bereithalten.<br />
Mit der Wahl von namhaften Referenten und Workshopleitern<br />
soll die Fachtagung dazu beitragen, sich<br />
über realistische Szenarien zu verständigen, zukunftsweisende<br />
Fragestellungen zu identifizieren und erste<br />
Antworten aufzuzeigen. Den Teilnehmern soll die Möglichkeit<br />
geboten werden, sich intensiv mit den Entwicklungsperspektiven,<br />
betrieblichen IT-Organisationsstrukturen,<br />
unternehmenskulturellen Herausforderungen<br />
und didaktischen Fragen sowie den Zukunftsaussichten<br />
in der Branche zu beschäftigen.<br />
In den Diskurs sollen auch konkrete Erfahrungen<br />
aus der Praxis und aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft<br />
einfließen, welche die Digitalisierung und<br />
Anwendung von KI in der Weiterbildung betreffen und<br />
einen spannenden Chancen-Pool für das mediengestützte<br />
Lernen bieten können.<br />
Durch eine abwechslungsreiche Abfolge von Fachvorträgen,<br />
Workshops und einer Podiumsdiskussion<br />
will die Veranstaltung den Teilnehmern während des<br />
ganzen Tages einen gleich hohen Spannungsbogen bieten.<br />
2<br />
[ Info ]<br />
Eine Anmeldung<br />
zum diesjährigen<br />
Fachforum des FDL<br />
ist bereits jetzt möglich.<br />
Die Programm -<br />
übersicht und erste<br />
Angaben zu den diesjährigen<br />
Referenten<br />
finden sich auf<br />
www.fachforumdistance-learning.de.<br />
VDW will Werkzeugmaschinen voranbringen<br />
Entwicklung einer Standardschnittstelle<br />
Auf dem Weg von umati zu einer international anerkannten Standardschnittstelle für die<br />
Kommunikation von Werkzeugmaschinen mit übergeordneten IT-Systemen gibt es Fortschritte:<br />
Eine Arbeitsgruppe hat ihre Tätigkeit aufgenommen, und weitere Steuerungshersteller sind dabei.<br />
Das hat der VDW mitgeteilt und dabei auch auf die EMO verwiesen.<br />
“Nicht nur, dass unsere neu<br />
gegründete OPC UA Joint Working<br />
Group (JWG) Mitte Februar die<br />
Arbeit aufgenommen hat, es ist auch<br />
gelungen, zwei weitere namhafte<br />
Steuerungshersteller für die Mitarbeit<br />
zu gewinnen: B&R Automation<br />
aus Österreich und Mitsubishi Electric<br />
aus Japan“, sagte Dr. Alexander<br />
Broos, Leiter Forschung und Entwicklung<br />
im VDW (Verein Deutscher<br />
Werkzeugmaschinenfabriken).<br />
Außerdem werde umati (universal<br />
machine tool interface) von Beckhoff,<br />
Bosch Rexroth, Fanuc, Heidenhain<br />
und Siemens aus der<br />
Steuerungswelt unterstützt. „Damit<br />
haben wir alle wichtigen Anbieter<br />
von CNC-Steuerungen für Werkzeugmaschinen<br />
bei umati mit an Bord“,<br />
freute sich Götz Görisch, umati-Projektleiter<br />
im VDW.<br />
Für die Steuerungshersteller sei die<br />
Beteiligung und Unterstützung nur<br />
folgerichtig, denn ihre Kunden fragten<br />
bereits immer häufiger nach<br />
einem herstellerübergreifenden<br />
Standard, um ihre Daten auslesen<br />
und in einem einheitlichen Datenformat<br />
verarbeiten zu können, hat<br />
man beim VDW beobachtet.<br />
Gemeinsam mit acht namhaften<br />
Werkzeugmaschinenherstellern<br />
hatte der VDW umati 2017 als Projekt<br />
„Konnektivität für Industrie 4.0“<br />
aus der Taufe gehoben. Auf der<br />
nächsten Metallbearbeitungsmesse<br />
EMO in Hannover (16.-21.9.19) ist<br />
eine große Demoinstallation mit<br />
internationaler Beteiligung geplant.<br />
„Bis dahin gibt es noch viel zu tun“,<br />
sagte Görisch: Zum einen soll die<br />
OPC UA Spezifikation für Werkzeugmaschinen<br />
stehen, zum anderen<br />
müssen in den Maschinen und<br />
Steuerungen der Teilnehmer die notwendigen<br />
Voraussetzungen und<br />
Anpassungen geschaffen werden.<br />
In Hannover sollen dann die ersten<br />
Use Cases im Mittelpunkt stehen.<br />
Inzwischen haben sich 130 Mitarbeiter<br />
aus 60 Firmen in zwölf Ländern<br />
für die Mitarbeit in der JWG<br />
registriert. 2<br />
Dr. Alexander Broos,<br />
Leiter für Forschung<br />
und Entwicklung im<br />
VDW<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
41
Verbände<br />
XXXXXXXXXX<br />
und Politik<br />
Berichte/Nachrichten<br />
„hub.berlin“ als neues<br />
Veranstaltungsmuster<br />
Digitale Welt<br />
Mit über 8.000 Besuchern hat die<br />
hub.berlin in diesem Jahr, in dem die<br />
Computermesse CeBIT mangels<br />
Interesse abgesagt werden musste,<br />
ihre Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt<br />
und einen neuen Teilnehmerrekord<br />
verzeichnet. Außerdem gab es<br />
Preise.<br />
Das hat der Digitalverband Bitkom<br />
gemeldet, dem bei diesem innovativen und<br />
messeähnlichen Veranstaltungsmuster zur<br />
digitalen Welt in der Hauptstadt eine Schlüsselrolle<br />
zukommt. Unter den Rednern waren<br />
die Bundesministerinnen Katarina Barley<br />
(Justiz und Verbraucherschutz) sowie Anja<br />
Karliczek (Bildung und Forschung), Bundeswirtschaftsminister<br />
Peter Altmaier, Telekom-Chef<br />
Timotheus Höttges und der EnBW-<br />
CEO Frank Mastiaux, ferner zahlreiche<br />
Startup-Gründer. Insgesamt traten auf den<br />
elf Bühnen mehr als 350 Sprecher auf.<br />
„Wir brauchen in Deutschland Digitalisierung<br />
zum Anfassen. Die hub.berlin hat<br />
gezeigt, was mit neuen Technologien wie KI<br />
oder Blockchain heute schon möglich ist und<br />
wohin die Reise morgen geht“, sagte Achim<br />
Berg, Präsident im Bundesverband Informationswirtschaft,<br />
Telekommunikation und<br />
neue Medien e. V. (Bitkom).<br />
„Um Deutschland fit zu machen für die<br />
Digitalisierung, müssen wir Startups, Mittelständler<br />
und große Unternehmen viel<br />
enger zusammenbringen. Die hub.berlin<br />
schafft diesen Brückenschlag an nur zwei<br />
Tagen und entwickelt sich zu einer wichtigen<br />
internationalen Dialog-Plattform rund um<br />
das Thema Digitalisierung.“ So lobte Bundeswirtschaftsminister<br />
Peter Altmaier.<br />
Zu den thematischen Schwerpunkten<br />
der diesjährigen Veranstaltung zählten u.a.<br />
Künstliche Intelligenz, Internet of Things<br />
und Blockchain sowie die Digitalisierung<br />
des Gesundheitswesens und vernetzte Mobilität.<br />
Im Digital Arts Lab stellten zwölf Grenzgänger<br />
zwischen Technologie und Kunst ihre<br />
Arbeiten vor und ermöglichten den Besuchern<br />
einen besonderen Blick über den Tellerrand.<br />
2<br />
[ Info ]<br />
Die nächste hub.berlin findet am 1. und 2. April<br />
2020 statt.<br />
Innovationen beim Bauforum Stahl<br />
Neues Veranstaltungsformat<br />
Bei den regionalen Unternehmergesprächen des Bauforums Stahl<br />
kündigte Geschäftsführer Dr. Rolf Heddrich kürzlich ein neues<br />
Veranstaltungsformat an. Der Verband für das Bauen mit Stahl<br />
will das Netzwerktreffen unter neuem Namen in Zukunft noch<br />
regionaler und fachübergreifender gestalten und außerdem eine<br />
Berufsfachmesse anbieten.<br />
So wird aus den Regionalen<br />
Unternehmergesprächen (vgl. 4/19,<br />
S. 41) bereits 2020 die bauFORUMstahl<br />
und LOUNGE. „Die Regionalen Unternehmergespräche<br />
sind ein wichtiger<br />
Teil unserer Verbandsaktivitäten, eine<br />
Plattform der Kommunikation, um Themen<br />
zu behandeln, die regional attraktiv<br />
und doch fachübergreifend relevant<br />
sind“, erklärte der neue Geschäftsführer<br />
und Sprecher des Verbandes, Dr.<br />
Rolf Heddrich.<br />
Berufsfachmesse<br />
Ein erster Schritt in diese Richtung<br />
wird die 1. Berufsfachmesse Stahlbau<br />
sein, die der Verband für das Bauen<br />
mit Stahl am 23.11.19 im Areal Böhler<br />
in Düsseldorf veranstaltet. Im Rahmen<br />
einer großen Fachausstellung und<br />
einer begleitenden Vortragsreihe sollen<br />
dort – vom Abiturienten bis zum Absolventen<br />
– junge Menschen auf die beruflichen<br />
Perspektiven im Stahlbau aufmerksam<br />
gemacht werden. „Die<br />
Zukunft gehört unserem Nachwuchs<br />
und genau hier setzt diese Veranstaltung<br />
an“, so Reiner Temme, Geschäftsführer<br />
der Temme Stahl- und Industriebau<br />
GmbH aus Bad Lauchstädt bei<br />
Halle und Präsident des Deutschen<br />
Stahlbauverbandes, der eigens zu dieser<br />
Veranstaltung nach Nordrhein-<br />
Westfalen kommt und hofft, dass möglichst<br />
viele Kollegen seinem Beispiel<br />
folgen werden. „Aus Überzeugung für<br />
die Sache“, so der Stahlbauunternehmer.<br />
Unternehmergespräche<br />
Der Auftakt der Neuausrichtung der<br />
Regionalen Unternehmergespräche<br />
soll im nächsten Jahr erfolgen: Vom<br />
Oberbürgermeister bis zum Startup-<br />
Unternehmen will sich der Verband<br />
die Experten einladen, die in der Stahlbaubranche<br />
für Bewegung sorgen können.<br />
Das Bauforum Stahl sieht seine<br />
Aufgabe nicht zuletzt darin, den Mitgliedsunternehmen<br />
neue Anregungen<br />
zu bieten, Innovationen transparent<br />
zu machen und ein starkes Netzwerk<br />
zu bilden.<br />
bauforumstahl e.V. (BFS) ist der<br />
Spitzenverband für das Bauen mit Stahl<br />
in Deutschland. Gemeinsam mit dem<br />
Deutschen Stahlbau-Verband DStV<br />
vertritt er die Anliegen seiner Mitglieder<br />
gegenüber Politik, Fachwelt,<br />
Medien und Öffentlichkeit, bietet Wissenstransfer<br />
und engagiert sich in Forschung<br />
und Normung. Übergeordnetes<br />
Ziel ist es, die Stahlbauweise unter<br />
Berücksichtigung ganzheitlicher<br />
Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, Sicherheit,<br />
Flexibilität und Nachhaltigkeit<br />
zu fördern. Zu den rund 350 Mitgliedern<br />
zählen alle namhaften deutschen<br />
Stahlbauunternehmen, Vorlieferanten<br />
und Folgegewerke, Architektur- und<br />
Ingenieurbüros sowie Hochschulen<br />
und Universitäten. 2<br />
42 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Digitale Frachtpapiere erwünscht<br />
Ergebnisse einer Bitkom-Umfrage<br />
Berlin im Blick<br />
Nach der Absage der CeBIT<br />
Etwa neun von zehn Unternehmen<br />
(88 %), die Waren transportieren, geben an,<br />
dass es ihnen helfen würde, wenn künftig<br />
auch eine digitale Variante der Frachtpapiere<br />
juristisch anerkannt wäre. Dies ist<br />
eines der Ergebnisse einer Umfrage des<br />
Digitalverbands Bitkom.<br />
Bei dieser Erhebung des Bundesverband<br />
Informationswirtschaft, Telekommunikation<br />
und neue Medien e. V. (Bitkom) präzisierte<br />
jedes zweite Unternehmen (50 %), dass es<br />
ihnen sehr helfen würde, weiteren 38 %<br />
würde es eher helfen. Gerade einmal 6 %<br />
gaben an, dass ihnen eine solche Änderung<br />
eher nicht helfen würde, 5 % sagten, dass<br />
es ihnen überhaupt nicht helfen würde.<br />
Dortmunder Forum<br />
Stahl und die Logistik<br />
Das NetzwerkForum Stahl erlebt am<br />
14.5.19 in Dortmund eine nächste Auflage.<br />
Bereits zum 19. Mal haben der Verband Verkehrswirtschaft<br />
und Logistik Nordrhein-<br />
Westfalen e.V. (VVWL) sowie Partner zu dem<br />
halbtägigen Treffen rund um die Stahllogistik<br />
eingeladen. Das Leitthema der zweiteiligen<br />
Veranstaltung lautet: „Stahl und Stahllogistik:<br />
Trends und Innovationen 2019 Plus“.<br />
„Der Zwang, Frachtdokumente auf Papier<br />
mit sich zu führen, ist angesichts der Digitalisierung<br />
in der Logistik ein nicht mehr<br />
nachvollziehbarer Anachronismus. Papierdokumente<br />
kosten Unternehmen und Verwaltung<br />
Zeit und Geld und belasten zudem<br />
die Umwelt“, resumierte Julia Miosga,<br />
Bereichsleiterin Handel & Logistik beim Bitkom,<br />
die Ergebnisse der repräsentativen<br />
Umfrage unter 514 Unternehmen mit Logistikprozessen.<br />
Die Bitkom-Umfrage zeige im<br />
Übrigen, dass je größer die Unternehmen,<br />
desto größer die Vorteile durch digitale<br />
Frachtdokumente.<br />
Auch vor diesen Hintergründen unterstützt<br />
Bitkom die EU-Initiative für elektronische<br />
Informationen zum Güterverkehr, über die<br />
nach Meinung des Verbandes möglichst<br />
noch in dieser Legislaturperiode entschieden<br />
werden sollte.<br />
In dem Trialog Land – Branche – Publikum:<br />
„Stahlstandorte NRW und Westeuropa im<br />
globalen Umfeld“ werden Christoph Dammermann<br />
(Staatssekretär im Ministerium<br />
für Wirtschaft, Digitales und Innovationen<br />
des Landes NRW) und Dr. Martin Theuringer<br />
(Geschäftsführer Wirtschaftsvereinigung<br />
Stahl) zu Beginn des Vormittags aktuelle<br />
wirtschaftspolitische Herausforderungen für<br />
die Branche in Westeuropa diskutieren. Zu<br />
diesem ersten Programmblock gehören<br />
auch ein Trialog-Impuls von Stefan Windgätter<br />
aus seiner Sicht als Transportlogistik-<br />
Unternehmer und Vorsitzender des Fachausschusses<br />
Stahl im VVWL sowie die<br />
„Rahmenbedingungen für die Stahlkonjunktur<br />
2019“, die Dr. Theuringer einbringt.<br />
Der zweite Veranstaltungsblock vor dem<br />
abschließenden Mittagessen thematisiert<br />
unter der Überschrift „Digitalisierung, Prozesse<br />
und Schnittstellenoptimierung in<br />
Stahl und Logistik“ Erfahrungen, Prozesse<br />
und Optimierungsansätze in diesem<br />
Bereich. Teilnehmer sind Bert Kloppert (Leiter<br />
Transport/Logistik 1, thyssenkrupp<br />
Steel Europe AG), Frank Michalk (Director<br />
Sales an Business Development Logenios<br />
GmbH), Dirk Schmaus (Vorstandsvorsitzender<br />
BiTech AG in Leverkusen) und Dirk M.<br />
Müller (Geschäftsführender Gesellschafter<br />
Rheinkraft International GmbH).<br />
[ Info ]<br />
Die Forumsveranstaltung wird wieder von dem<br />
Fachjournalisten Michael Cordes (Verkehrsrundschau)<br />
moderiert. Weitere Informationen und<br />
Anmeldemöglichkeiten gibt es beim VVWL über<br />
www.vvwl.de.<br />
Erstmals seit Jahrzehnten hat in diesem<br />
April eine Hannover Messe stattgefunden,<br />
ohne dass gleichzeitig auf eine aktuelle<br />
Computermesse CeBIT hätte verwiesen<br />
werden können. Das rief Erinnerungen an<br />
den letzten Herbst wach, als das einstige<br />
Großevent endgültig abgesagt und der<br />
Blick der Branche auf Berlin gerichtet worden<br />
war.<br />
„Wir bedauern, dass die Cebit 32 Jahre<br />
nach ihrer Erstauflage nicht mehr als eigenständige<br />
Veranstaltung stattfindet. Messe-<br />
Vorstand Oliver Frese und seinem Team<br />
danken wir für ihr Engagement und den<br />
Versuch, die Cebit zuletzt mit einem mutigen<br />
Konzept wieder auf den Wachstumspfad<br />
zu führen. Unabhängig von der positiven<br />
Resonanz, die das neue Konzept fand,<br />
muss es sich natürlich auch für den Veranstalter<br />
rechnen. Markt und Messelandschaft<br />
haben sich in den vergangenen Jahrzehnten<br />
stark gewandelt. Digitale Themen<br />
spielen inzwischen in allen Branchen eine<br />
entscheidende Rolle. Wir begrüßen, dass<br />
die Themen rund um die Industrie 4.0 auf<br />
der Hannover-Messe künftig noch stärker<br />
aufgegriffen werden.“ So kommentierte Bitkom-Präsident<br />
Achim Berg im November<br />
2018 die Absage.<br />
Gleichzeitig lud der Bundesverband Informationswirtschaft,<br />
Telekommunikation und<br />
neue Medien e. V. (Bitkom) die Digitalwirtschaft,<br />
ihre Partner und Kunden für 2019<br />
zu zwei innovativen und stark wachsenden<br />
Formaten ein: Am 10./11.4.19 führte Bitkom<br />
in Berlin sein internationales hub-Festival<br />
mit Artificial Intelligence Summit<br />
durch. Und vom 19.-21.11.19 findet zum<br />
zweiten Mal die Smart Country Convention<br />
des Bitkom bei der Messe Berlin statt.<br />
Email: Norm statt Guidline<br />
Es gibt jetzt eine genormte Prüfmethode für<br />
Emaillierungen mit Lebensmittelkontakt.<br />
Darauf hat der Deutsche Email Verband<br />
(dev) hingewiesen. Bis Anfang 2019 war die<br />
„Guidline 1001: Migration from enamelled<br />
articles made for food contact – Methode<br />
of test and permissible limits“ der European<br />
Enamel Authority (EEEA) der aktuelle Test-<br />
Standard. Mit der Veröffentlichung der EN<br />
ISO 4531 ist die EEA-Richtlinie nun durch<br />
eine offizielle Norm ersetzt worden.<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
43
Wissenswertes<br />
Bericht<br />
BIBB-Studie analysiert Schülerwünsche<br />
Ausbildung vs. Studium<br />
Angesichts steigender Studierendenzahlen hat das BIBB untersucht, welche Schüler/-innen<br />
trotz Hochschulzugangsberechtigung eher eine Ausbildung als ein Studium planen und welche<br />
Faktoren dies begünstigen. Dabei hat sich gezeigt, dass neben Einflüssen des sozialen Umfelds<br />
auch der Berufsorientierungsprozess sowie Kosten-, Nutzen- und Chanceneinschätzungen der<br />
Jugendlichen von Bedeutung sind.<br />
z Die Pläne der Jugendlichen sind<br />
zunächst stark durch die Erwartungshaltung<br />
der Eltern geprägt.<br />
Nur wenige Jugendliche, die ein<br />
Studium anstreben, vermuten, dass<br />
ihre Eltern sich statt eines Studiums<br />
eine Ausbildung für sie wünschen.<br />
Die Wahrscheinlichkeit,<br />
eine Ausbildung in Betracht zu ziehen,<br />
erhöht sich indessen, wenn<br />
die Jugendlichen vermuten, dass<br />
sich auch mit einer Ausbildung ein<br />
Beruf ergreifen lässt, der vom<br />
Niveau her ähnlich oder besser ist<br />
als die von den Eltern ausgeübten<br />
Berufe. Dies führt aus Sicht der<br />
Fachleute im Bundesinstitut für<br />
Berufsbildung (BIBB) zu der Anregung,<br />
bei Berufsorientierungsmaßnahmen<br />
neben den individuellen<br />
Interessen und Zielen der Schüler/-innen<br />
auch die sozialen Prozesse<br />
zu verdeutlichen, unter deren<br />
Einfluss sie stehen.<br />
z Sowohl Studien- als auch Ausbildungsinteressierte<br />
erwarten von<br />
einem Studium einen hohen Nutzen.<br />
Doch nur Ausbildungsinteressierte<br />
sehen dies auch für eine Ausbildung<br />
so. Die Wahrscheinlichkeit,<br />
eine Ausbildung für sich in<br />
Betracht zu ziehen, steigt also mit<br />
der Überzeugung, damit auch<br />
attraktive Berufschancen zu haben.<br />
Eine bessere Aufklärung über die<br />
Karriereperspektiven nach Ausbildungsabschluss<br />
könnte daher aus<br />
Sicht des BIBB zu einer Attraktivitätssteigerung<br />
der Ausbildung<br />
beitragen.<br />
zDie BIBB-Untersuchung zeigt ferner,<br />
dass die Wahrscheinlichkeit, eine<br />
Ausbildung anzustreben, umso<br />
höher ist, je konkreter die eigenen<br />
beruflichen Vorstellungen sind. Die<br />
Ergebnisse verdeutlichen aber<br />
auch, dass ein Teil der Jugendlichen<br />
offensichtlich meint, ihre beruflichen<br />
Interessen besser in einem<br />
Studium realisieren zu können.<br />
Dies gilt z.B. für jene mit Interesse<br />
an forschend-abstrakten oder künstlerisch-sprachlichen<br />
Tätigkeiten.<br />
Dass auch eine Vielzahl von Ausbildungsberufen<br />
derartige Tätigkeitsaspekte<br />
bieten, spricht aus<br />
Sicht der BIBB-Fachleute dafür, in<br />
der Berufsorientierung stärker auch<br />
auf solche Berufe einzugehen.<br />
Der Appell von BIBB-Präsident Friedrich<br />
Hubert Esser lautet daher: „Um<br />
die Attraktivitätsverluste der beruflichen<br />
Bildung in den Griff zu bekommen,<br />
braucht es eine gesamtgesellschaftliche<br />
Debatte über den Wert von<br />
Berufen.“ Es gelte zuvorderst, Tiefe<br />
und Tragweite des Attraktivitätsproblems<br />
zu erkennen sowie Maßnahmen<br />
zu erdenken, die wirklich helfen, um<br />
den Akademisierungstrend aufzuhalten,<br />
so Esser weiter. 2<br />
44 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Bereit für größere Aufgaben?<br />
Fernstudium – in drei Jahren berufsbegleitend zum „Betriebswirt Stahlhandel (BDS)“<br />
Argumente<br />
z Staatlich zugelassener Studiengang<br />
z Markenrechtlich geschützter Abschluss<br />
z Orientiert am Europäischen und<br />
Deutschen Qualifikationsrahmen<br />
z Zertifizierter Anbieter<br />
Inhalte<br />
z Technik (Werkstoffe, Produkte,<br />
Anarbeitung)<br />
z Wirtschaft (Kaufmännische Kompetenz,<br />
Führungskompetenz)<br />
z Methoden (Selbst- und Sozialkompetenz)<br />
Formen<br />
z 60 Module<br />
z 6 Präsenzphasen<br />
z 3 Prüfungen<br />
z 1 Studienarbeit<br />
Für Auskünfte und Anmeldungen:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel (BDS AG)<br />
Wiesenstraße 21 · 40549 Düsseldorf<br />
Telefon: 0211 86497-0 · Telefax: 0211 86497-22<br />
www.stahlhandel.com<br />
fernstudium<br />
Betriebswirt<br />
Stahlhandel (BDS)
Wissenswertes<br />
Nachrichten<br />
Prüferehrenamt stärken -<br />
Berufliche Bildung sichern<br />
Hintergründe,<br />
Herausforderungen,<br />
Handlungsfelder<br />
GemeinsamQualitätPrüfen<br />
Strategiepapier Prüferehrenamt<br />
(Quelle: DIHK)<br />
Buchtipp<br />
Nitrieren und Nitrocarburieren<br />
Mit dieser neu bearbeiteten<br />
Auflage eines traditionsreichen<br />
Fachbuchs soll dem Leser<br />
eine kurzgefasste Information<br />
über den gegenwärtigen technischen<br />
Stand der speziellen Wärmebehandlungsverfahren<br />
Nitrieren<br />
und Nitrocarburieren<br />
geboten werden.<br />
Strategiepapier Prüferehrenamt<br />
Sie sind das Rückgrat der Beruflichen Bildung: Mehr als<br />
150.000 ehrenamtliche Prüfer engagieren sich allein bei den<br />
Industrie- und Handelskammern in über 30.000 Prüfungsausschüssen.<br />
Wie ihre Leistungen stärker ins Licht der Öffentlichkeit<br />
gerückt und für die Zukunft gesichert werden können,<br />
beschreibt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag<br />
(DIHK) seit Ende des vergangenen Jahres in einem Strategiepapier.<br />
Darin wird deutlich, dass ehrenamtliche Prüfer jährlich<br />
mehr als 600.000 Zwischen- und Abschlussprüfungen in der<br />
Ausbildung, mehr als 60.000 Prüfungen in der Höheren Berufsbildung<br />
und über 70.000 Ausbildereignungsprüfungen durchführen.<br />
Rund 3.000 Prüfer arbeiten zudem unentgeltlich in den<br />
zentralen IHK-Aufgabenerstellungseinrichtungen mit. Das Strategiepapier<br />
soll für Anerkennung sorgen und auch helfen, den<br />
Aufwand für Prüfungen in praktikablen Grenzen zu halten.<br />
Nach der Darstellung der Entstehung,<br />
des Aufbaus und des<br />
Gefüges von Nitrierschichten<br />
werden ihre Eigenschaften im<br />
Hinblick auf die praktische<br />
Anwendung beschrieben: Verbesserung<br />
des Verschleiß-, Festigkeits-<br />
und Korrosionsverhaltens.<br />
Die derzeit wichtigsten<br />
industriell angewendeten Verfahren<br />
Gas- und Plasmanitrieren<br />
und -nitrocarburieren sowie das Salzbadnitrocarburieren<br />
und die dafür erforderlichen<br />
Behandlungsmittel und die Verfahrens- und<br />
Anlagentechnik werden vorgestellt. Für die<br />
praktische Anwendung sind Hinweise zur Verfahrensauswahl,<br />
zur Vor- und Nachbehandlung,<br />
zur Nitrierbarkeit, Möglichkeiten<br />
zum Vermeiden<br />
typischer Fehler und Anwendungsbeispiele<br />
enthalten.<br />
Eine Darstellung der Vorgehensweise<br />
für Zeichnungsangaben<br />
und der für die Qualitätskontrolle<br />
maßgebenden<br />
Prüfmethoden runden das<br />
Werk ab.<br />
Aus dem Inhalt: Entstehung,<br />
Aufbau und Gefüge von<br />
Nitrierschichten – Eigenschaften<br />
– Vorbehandeln und<br />
Vorbereiten der Werkstücke –<br />
Gasnitrieren und Gasnitrocarburieren<br />
– Plasmanitrieren<br />
und -nitrocarburieren – Salzbadnitrocarburieren<br />
– Sonderverfahren<br />
zum Nitrieren/<br />
Nitrocarburieren – Nachbehandlung – Hinweise<br />
zur Werkstoff- und Verfahrensauswahl<br />
– Nitrierte und nitrocarburierte Werkstücke:<br />
Darstellung und Angaben in Zeichnungen und<br />
anderen Fertigungsunterlagen – Prüfen<br />
nitrierter/nitrocarburierter Werkstücke.<br />
Liedtke, Dieter e.a.;<br />
Wärmebehandlung von<br />
Eisenwerkstoffen II. Nitrieren<br />
und Nitrocarburieren;<br />
7., neu bearbeitete Auflage;<br />
Tübingen 2018; 353 Seiten;<br />
64,80 €; expert verlag<br />
GmbH, 72070 Tübingen;<br />
ISBN 978-3-8169-3402-8<br />
KWB-Treffen der Ausbildungsleiter<br />
Das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB) mit Sitz in Bonn betreut<br />
zwei Arbeitsgemeinschaften, die für kaufmännische und gewerblich-technische Ausbildungsleiter.<br />
In Kooperation dieser Arbeitsgemeinschaften organisiert das KWB jeweils im<br />
Frühjahr eine Tagung für kaufmännische Ausbildungsleiter und im Herbst eine solche Veranstaltung<br />
für gewerblich-technische Ausbildungsleiter. Die Termine dafür sind in diesem<br />
Jahr der 23./24.5.19 in Düsseldorf (mit Unterstützung der örtlichen IHK bei Vodafone) und<br />
der 29./20.11.19 in Marl (mit Gastgeber Evonik an einem der größten Chemiestandorte<br />
Deutschlands). Einzelheiten dazu gibt es unter www.kwb-berufsbildung.de<br />
Gümpel, Paul e.a.;<br />
Rostfreie Stähle. Grundwissen, Konstruktionsund<br />
Verarbeitungshinweise; 5., durchgesehene<br />
Auflage; Tübingen 2016; 248 Seiten;<br />
56,00 €; expert verlag GmbH, 72070 Tübingen;<br />
ISBN 978-3-8169-3148-5<br />
Buchtipp:<br />
Rostfreie Stähle<br />
Das in fünfter Auflage inzwischen<br />
wieder lieferbare Buch erhebt den<br />
Anspruch, einen Überblick über die<br />
metallkundlichen Grundlagen auf dem<br />
Gebiet der nichtrostenden Stähle zu<br />
geben sowie über das Einsatzverhalten<br />
dieser Werkstoffe. Es werden insbesondere<br />
die notwendigen Hinweise für den<br />
Konstrukteur und den Verarbeiter von<br />
nichtrostenden Stählen formuliert. Einen<br />
Schwerpunkt stellt hierbei das Korrosionsverhalten<br />
dieser Werkstoffe dar. Es<br />
geht in diesem Werk für die Zielgruppen<br />
der Ingenieure, Techniker und Fachkräfte<br />
speziell darum, materialkundliches<br />
Grundwissen einer- mit andererseits Konstruktions-<br />
und Verarbeitungshinweisen<br />
zu kombinieren. Dieser Aufgabe haben<br />
sich Prof. Dr.-Ing. Paul Gümpel und sieben<br />
Mitautoren gestellt.<br />
Aus dem Inhalt: Einführung in die Werkstoffkunde<br />
der nichtrostenden Stähle –<br />
Korrosion von nichtrostenden Stählen in<br />
wässrigen Medien – Umformen von nichtrostendem<br />
Kaltband durch Tiefziehen und<br />
Streckziehen – Oberflächen und Oberflächenbehandlung<br />
bei Feinblechen aus<br />
nichtrostendem Stahl – Schweißtechnische<br />
Verarbeitung nichtrostender Stähle<br />
– Verarbeitungsverhalten von nichtrostenden<br />
Stählen – Neuere Entwicklungen<br />
bei nichtrostenden Stählen.<br />
46 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Fotos, 2: Schuler AG<br />
Motive der neuen 5-Euro-Sammlermünze … … und ihre Bestandteile.<br />
Metall und Polymer<br />
Neue Fünf-Euro-Sammlermünze<br />
Die erste neue 5-Euro-Sammlermünze mit dem Motiv „gemäßigte<br />
Zone“ ist im April mit Maschinen aus dem Schuler-Konzern in<br />
Karlsruhe angeprägt worden. Das metallene Geldstück, das u.a.<br />
einen Hasen und Wald zeigt, ist mit einem lichtdurchlässigen grünen<br />
Polymerring versehen, der in fünf Farbabstufungen verwendet wird.<br />
Die neue Münze ist Teil der fünfteiligen Serien „Klimazonen der Erde,<br />
die 2017 ihren Auftakt hatte. Das Motiv der dritten Ausgabe widmet<br />
sich der gemäßigten Klimazonen, zu der auch Deutschland zählt.<br />
Typisch für diese Klimazone sind der Wechsel der Jahreszeiten und<br />
Laubmischwälder Daher sind eine Waldsilhouette und ein herbstlicher<br />
Eichenast als Bildelemente integriert – sowie ein Feldhase, der<br />
als typischer Vertreter offener Landschaften in der gemäßigten Zone<br />
gilt. Das Motiv stammt von dem Berliner Künstler Peter Lasch. Die<br />
Wertseite, die bei allen Münzen der Serie identisch ist, wurde von<br />
der Künstlerin Stefanie Radtke aus Leipzig entworfen.<br />
Die Auflage der Sammlermünze liegt bei 3,4 Mio. Stück; davon werden<br />
3 Mio. in Stempelglanzqualität und 400.000 in Spiegelglanzoptik<br />
geprägt. Der Erstausgabetag wird der 19.9.19 sein. Das Geldstück<br />
wird – mit jeweils unterschiedlichen Grüntönen – auch in den Münzstätten<br />
in Stuttgart, München, Hamburg und Berlin geprägt. Die Herstellung<br />
der Münzrohlinge findet ausschließlich in den Münzstätten<br />
Karlsruhe und München statt.<br />
TV-Dokumentation<br />
Hermann Röchling<br />
Einer der umstrittensten Wirtschaftsführer<br />
der Weltkriegszeiten, Hermann Röchling,<br />
stand im Mittelpunkt einer Fernsehdokumentation,<br />
die Anfang April in der ARD<br />
und auf Arte gezeigt wurde und danach für<br />
einige Wochen in der Arte-Mediathek stand:<br />
Corten-Kunst in Passau<br />
Corten-Stahl war – neben Holz – das<br />
bevorzugte Material des Bildhauers Franz<br />
Bernhard (1934-2001). Das Museum<br />
Moderner Kunst in Passau widmet ihm<br />
eine Ausstellung und zeigt noch bis zum<br />
7.7.19 Skulpturen, Wandobjekte, Radierungen<br />
und Zeichnungen des Künstlers.<br />
[ Info ]<br />
„Der Stahlbaron – Hermann Röchling und<br />
die Völklinger Hütte. Dr. jur. h.c. Hermann<br />
Röchling (1872 bis 1955) war ein deutscher<br />
Montanunternehmer, der sich vor 1945 an<br />
der Seite von Nazigrößen zeigte und sich<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg mit Wirtschafts-<br />
sowie Politikgrößen der jungen<br />
Bundesrepublik ablichten ließ. Das dokumentiert<br />
der Fernsehfilm, den es in unterschiedlichen<br />
Längenfassungen gibt und der<br />
nachvollziehbar macht, warum der Name<br />
des in Völklingen Geborenen bis heute in<br />
der Stahlwirtschaft bekannt ist – nicht nur<br />
im Saarland.<br />
Foto: wikipedia<br />
Bildnis von Hermann Röchling an einem<br />
Industriedenkmal in Völklingen.<br />
Eine Wertung der Lebensleistung von Hermann<br />
Röchling muss der Zuschauer selber<br />
vornehmen, Fakten dazu liefert der Film.<br />
Foto: Bengt Oberger<br />
Nähere Informationen gibt es unter<br />
www.mmk-passau.de.<br />
Franz Bernhard: Der Kopf, Corten-Stahl, 2000<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
47
Lifesteel<br />
Bericht/Nachricht<br />
Foto: WZV/Velux Deutschland GmbH<br />
Die am Mont Blanc neu -<br />
gebaute Refuge du Goûter<br />
erhielt eine glänzende Haut<br />
aus Edelstahl Rostfrei.<br />
Brückenfunktionen<br />
Der Berg ruft: nach Edelstahl Rostfrei<br />
Schroffe Felsen, ewiges Eis und extreme Wetterverhältnisse: Weit über hundert Jahre lang lockten diese<br />
Herausforderungen lediglich Alpinisten in die Berge. Später entdeckten dann auch Hobbykletterer den Zauber<br />
von Hochgebirgen – u.a. mit der Folge, dass vormals spartanische Schutzhütten aus Holz moderner Architektur<br />
weichen mussten. Des einen Leid ist des anderen Freud. Bei der alpinen Gratwanderung zwischen Tradition<br />
und Innovation übernimmt Edelstahl Rostfrei eine Brückenfunktion. Das ruft nicht der Berg, sondern der<br />
zuständige Warenzeichenverband – und benennt zahlreiche Beispiele, u.a. am Mont Blanc und an der Zugpitze.<br />
Warenzeichenverband<br />
Weit über 700 Schutzhütten stehen<br />
allein in den Alpen, viele davon<br />
wurden vor über hundert Jahren<br />
gebaut. Neben der Zeit haben die<br />
herausfordernden Witterungseinflüsse<br />
– tiefer Frost, orkanartige Windböen,<br />
UV-Strahlung – sowie Auswirkungen<br />
des Klimawandels wie auftauende Permafrostböden<br />
massiv an ihnen genagt.<br />
Zugleich entspricht ihre Ausstattung<br />
nicht mehr den gestiegenen Anforde-<br />
Das international geschützte Markenzeichen Edelstahl<br />
Rostfrei wird seit 1958 durch den Warenzeichenverband<br />
Edelstahl Rostfrei e.V. (WZV) an Verarbeiter und<br />
Fachbetriebe vergeben. Die derzeit über 1.200 Mitgliedsunternehmen<br />
verpflichten sich zum produkt- und<br />
anwendungsspezifisch korrekten Werkstoffeinsatz und<br />
zur fachgerechten Verarbeitung. Missbrauch des Markenzeichens<br />
wird vom Verband geahndet.<br />
rungen. Nicht zuletzt werden sie auch<br />
veränderten gesetzlichen Vorgaben zu<br />
Umweltschutz, Brandschutz oder Statik<br />
oftmals nicht mehr gerecht. Mit enormem<br />
Aufwand werden sie deshalb entweder<br />
sukzessive renoviert oder direkt<br />
durch einen Neubau mit modernster<br />
Technik ersetzt.<br />
Für Planer und Bauherren sind mit<br />
der isolierten Lage der Berghütten zahlreiche<br />
Herausforderungen verbunden.<br />
Abgeschnitten von der Zivilisation und<br />
jeder Infrastruktur, müssen Mensch<br />
und Material während der Sommermonate<br />
dorthin per Helikopter transportiert<br />
werden. Angesichts des meist<br />
eng begrenzten Bauraums, der die Aufstellung<br />
eines Krans verhindert, muss<br />
der Hubschrauber auch Hebezeugfunktion<br />
übernehmen. Viele der Hütten<br />
zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe.<br />
Das Zusammenspiel all dieser Faktoren<br />
verlangt energetische Autonomiekonzepte<br />
mit gesicherter ökologischer<br />
Verträglichkeit. Entsprechend<br />
modernisierte oder neu errichtete Berghütten<br />
zeichnet deshalb ein ausgeklügeltes<br />
Energiemanagement mit Solarund<br />
Photovoltaikpaneelen, Wärmespeicher,<br />
energiesparenden Geräten<br />
und witterungsoptimierter Ausrichtung<br />
der Gebäudeöffnungen aus. Die Wasserversorgung<br />
erfolgt durch gesammeltes<br />
Schmelz- und Regenwasser, das<br />
in – oftmals unterirdischen – Wassertanks<br />
aus Edelstahl Rostfrei entkeimt<br />
und gespeichert wird. Das anfallende<br />
Abwasser reinigen dezentrale lokale<br />
Abwasseraufbereitungsanlagen mehrstufig.<br />
Durch Wiederverwendung als<br />
Brauchwasser – beispielsweise für die<br />
Toilettenspülung – wird der Trinkwasserbedarf<br />
um bis zu 30 % gesenkt. Nicht<br />
verbrauchtes, gereinigtes Abwasser<br />
kann in der ökologisch sensiblen Umgebung<br />
versickern. Die verbleibenden<br />
48 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
Fäkalschlämme werden kompostiert<br />
und per Hubschrauber zur nächstgelegenen<br />
Kläranlage ins Tal transportiert.<br />
Viele Hütten im Hochgebirge werfen<br />
sich wortwörtlich in Schale: Ihre<br />
Holzkonstruktion ist mit einer Wetterhülle<br />
aus Metall ummantelt. Dabei<br />
punktet Edelstahl Rostfrei mit seiner<br />
maximalen Witterungsbeständigkeit<br />
und für Jahrzehnte hochwertigen<br />
Ästhetik. Zudem spricht für den nichtrostenden<br />
Stahl, dass er am Ende seiner<br />
Lebenszeit nahezu vollständig ohne<br />
Qualitätseinbußen recycelt werden.<br />
Mont Blanc<br />
Die am Mont Blanc in 3.817 m Höhe<br />
neugebaute Refuge du Goûter verdankt<br />
ihre ovale Form und Lage am äußersten<br />
Rand des schneebedeckten Kamms der<br />
herausfordernden Topografie und Witterung.<br />
Nur zur Hälfte steht sie auf<br />
dem Felsen, der andere Teil schwebt<br />
frei über dem Abgrund und verleiht<br />
der energieautarken Schutzhütte mit<br />
Passivhausstandard ihre spektakuläre<br />
Wirkung. Die Holzkonstruktion wird<br />
durch eine 50 Zentimeter dicke Dämmung<br />
aus Holzwolle vor der hier herrschenden<br />
extremen Kälte geschützt.<br />
Um den Temperaturen von unter minus<br />
40 Grad und Orkanböen mit Geschwindigkeiten<br />
von über 250 Stundenkilometern<br />
dauerhaft die Stirn bieten zu<br />
können, erhielt der vierstöckige Kuppelbau<br />
eine glänzende Haut aus Edelstahl<br />
Rostfrei. Dank der guten Verformbarkeit<br />
und hohen Festigkeit des<br />
Materials konnte für die vollflächige<br />
Bekleidung der elliptischen Form eine<br />
geringere Materialstärke gewählt werden.<br />
Unempfindlich gegenüber UV-<br />
Strahlung und Temperatursprüngen,<br />
wartungsfrei und korrosionsbeständig<br />
bewährt sich die Edelstahlhaut als<br />
nachhaltig wirtschaftliche Entscheidung.<br />
Zugpitze<br />
Die Höllentalangerhütte ist im Wettersteingebirge<br />
auf 1.387 Meter Höhe ein<br />
beliebter Ausgangspunkt für Bergsteiger,<br />
um die Zugspitze von ihrer schwierigsten<br />
Seite besteigen zu können. Ihr<br />
flachgeneigtes Pultdach ist ebenso wie<br />
der gesamte übrige Baukörper so konzipiert,<br />
dass Lawinen eine möglichst<br />
geringe Angriffsfläche haben.<br />
Die Herausforderung bei der Tragwerkplanung<br />
bestand darin, mit möglichst<br />
wenig Material Schneelasten von<br />
Foto: WZV/Homann.Zehl Architekten<br />
Auf die Holzunterkonstruktion des Dachs der Höllentalangerhütte<br />
im Wettersteingebirge wurde eine Doppelstehfalzdeckung aus<br />
Edelstahl Rostfrei aufgebracht.<br />
bis zu 10,5 kN/m² standzuhalten. Auf<br />
die wärmegedämmte hinterlüftete Holzunterkonstruktion<br />
des Dachs mit<br />
30 mm dicker Schalung und zweilagiger<br />
Abdichtung wurde deshalb eine 600 m 2<br />
große Doppelstehfalzdeckung aus Edelstahl<br />
aufgebracht. Auch für die Fenster-<br />
und Sockelanschlussbleche wählten<br />
die Architekten diesen Werkstoff. Die<br />
matt patinierte Oberfläche der wetterfesten<br />
Elemente aus nichtrostendem<br />
Stahl greift die Tonigkeit der alpinen<br />
Landschaft auf und ordnet sich so behutsam<br />
der Umgebung unter. 2<br />
Stahl schafft Dynamik auf der Schiene<br />
Neue Reparaturwerkstätten im belgischen Melle<br />
Angesichts der Diskussionen über den<br />
Zustand – und die Zustände – bei den deutschen<br />
Bahnen stehen entsprechende Instandhaltungsfragen<br />
im Mittelpunkt des öffentlichen<br />
Interesses. Das ist in Belgien ähnlich, wo jetzt<br />
mit Hilfe von viel Stahl im Projekt TW Melle die<br />
Reparaturinfrastruktur nachhaltig verbessert,<br />
für Dynamik auf der Schiene gesorgt werden<br />
konnte.<br />
Insgesamt 270 t Stahl, darunter Träger und<br />
weitere Stahlkonstruktionen innerhalb des<br />
Werkes, wurden von Anfang Juni 2018 bis Ende<br />
September gleichen Jahres im belgischen<br />
Melle verarbeitet. In den gerade fertiggestellten<br />
Reparaturwerkstätten sollen in Zukunft<br />
Wartung und Inspektion des technischen und<br />
mechanischen Materials für die Eisenbahn<br />
durchgeführt werden. Die Metallbauarbeiten<br />
wurden von Dugardein-De Sutter durchgeführt,<br />
Coatinc Ninove hat sie veredelt. Ann Eeckhout,<br />
Sales Representative von Coatinc Ninove, hat<br />
das Projekt von Beginn an begleitet. Sie betont<br />
die Wichtigkeit der neuen Reparaturwerkstätten:<br />
„Da unser Bahnnetz in Belgien so ungeheuer<br />
dicht und weitreichend ist, ist eine zuverlässige<br />
Instandhaltung der Strecken absolut<br />
unerlässlich. Durch unsere Zusammenarbeit<br />
mit Dugardein-De Sutter kann nun langfristig<br />
die technische Inspektion und Wartung des<br />
Streckenmaterials gewährleistet werden.“<br />
Die gerade fertiggestellten<br />
Reparaturwerkstätten in Melle …<br />
In Belgien gibt es tatsächlich eines der dichtesten<br />
Bahn-Streckennetze der Welt: Mit einer<br />
Dichte von 112,6 m/km² liegt es weit über<br />
dem EU-Durchschnitt. Die Instandhaltung der<br />
Infrastruktur solcher Größe in dem kleinen<br />
Nachbarland stellt deshalb eine besondere<br />
Herausforderung für die staatliche Eisenbahngesellschaft<br />
dar.<br />
... sollen die belgischen Bahnen<br />
optimal einsatzbereit halten.<br />
Fotos, 2: Dugardein-De Sutter<br />
<strong>Stahlreport</strong> 5|19<br />
49
Lifesteel<br />
Nachricht<br />
Im Notfall bitte benutzen:<br />
Thyssenkrupp-Aufzug …<br />
… im Fremont-Hochhaus<br />
in San Francisco.<br />
Die anderen Aufzüge<br />
Thyssenkrupp freut sich über Hochhauspreis<br />
Der Fremont-Wolkenkratzer in San Francisco gilt als widerstandsfähigstes<br />
Gebäude an der US-Westküste. Das Gebäude kann sich neuerdings mit dem<br />
renommiertesten Hochhauspreis der Welt schmücken – und ist besonderer<br />
Stolz für Thyssenkrupp. Der Technologiekonzern mit Werkstoffkompetenz ist<br />
dort für Aufzüge verantwortlich, die auch im Notfall benutzt werden sollen.<br />
Daraus ergeben sich Perspektiven auch für den Stahlbau.<br />
Die Aufzüge mit der sogenannten Occupant-Evacuation-Operation-Ausstattung<br />
(OEO) wurden von thyssenkrupp Elevator entwickelt. OEO-fähige Anlagen sind<br />
im Gegensatz zu herkömmlichen Aufzügen, die im Notfall nicht benutzt werden<br />
dürfen, so konstruiert, gerade in Ausnahmesituationen der schnellstmöglichen<br />
Evakuierung von Hochhausnutzern zu dienen. Die speziellen Lifts sind mit<br />
Schutzvorrichtungen ausgestattet, die das Eindringen von Wasser, Feuer, Hitze<br />
und Rauch in die Schächte verhindern. Im Falle eines Stromausfalls können die<br />
Kabinen mit Notstrom betrieben werden.<br />
Das Bauwerk wurde von der Jay Paul Company konstruiert und ist das höchste<br />
Gebäude mit Mischnutzung westlich des Mississippi. Der Wolkenkratzer verfügt<br />
über mehr als 83.000 m 2 Bürofläche, 74 Luxuswohnungen in den oberen Stockwerken,<br />
Einzelhandelsflächen und direkten Zugang zu dem 5,4 Hektar großen<br />
„Rooftop-Park“. Insgesamt 14 der 17 Aufzüge im 181 Fremont sind OEO-fähig.<br />
Das Gebäude bekam im April den „Best Tall Building Award“. Der Preis richtet<br />
das Scheinwerferlicht auf Bauprojekte, die sowohl der Architektur von Wolkenkratzern<br />
als auch der Gestaltung urbaner Räume mit Hinblick auf maximale<br />
Nachhaltigkeit entscheidende Impulse verleihen. Auch die Lebensqualität der<br />
Bewohner spielt eine entscheidende Rolle. 181 Fremont erhielt die Auszeichnung<br />
für den wegweisenden Ansatz bei Sicherheit und Nachhaltigkeit.<br />
Foto: thyssenkrupp Elevator<br />
Impressum<br />
STAHLREPORT<br />
Das BDS-Magazin für die Stahldistribution<br />
Stahlhandel | Stahlproduktion |<br />
Stahlverarbeitung<br />
Offizielles Organ des BDS-Fernstudiums<br />
Herausgeber:<br />
Bundesverband Deutscher Stahlhandel<br />
Wiesenstraße 21<br />
40549 Düsseldorf<br />
Redaktion:<br />
Dr. Ludger Wolfgart (Chefredakteur)<br />
Telefon (02 11) 8 64 97-11<br />
E-Mail: Wolfgart-BDS@stahlhandel.com<br />
Markus Huneke<br />
Telefon (02 11) 8 64 97-24<br />
E-Mail: Huneke-BDS@stahlhandel.com<br />
Anzeigen:<br />
Ksenija Sandek<br />
Telefon (02 11) 8 64 97-21<br />
E-Mail: Sandek-BDS@stahlhandel.com<br />
Verlag:<br />
BDS AG<br />
Wiesenstraße 21<br />
40549 Düsseldorf<br />
Telefon (02 11) 8 64 97-0<br />
Telefax (02 11) 8 64 97-22<br />
Layout:<br />
auhage|schwarz, Leichlingen<br />
Druck:<br />
Hellendoorn, Bad Bentheim<br />
Titelbild:<br />
voestalpine<br />
Erscheinungsweise:<br />
monatlich (10 Hefte/Jahr)<br />
Bezugspreis:<br />
Jährlich 65 € im Inland und 70 € im Ausland<br />
zuzüglich Versandspesen und Mehrwertsteuer.<br />
Abbestellungen sind lediglich unter Einhaltung<br />
einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Jahres -<br />
ende möglich. Für die Mitglieder des BDS und die<br />
Teilnehmer im BDS-Fernstudium ist der Bezug<br />
eines Exemplars der Fachzeitschrift „<strong>Stahlreport</strong>“<br />
im Mitgliedsbeitrag bzw. in der Studien gebühr<br />
enthalten. Ein Nachdruck ist nur mit ausdrücklicher<br />
Genehmigung der Redaktion gestattet.<br />
Anzeigenpreis:<br />
Zur Zeit gilt die Preisliste Nr. 36.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte oder<br />
Fotos übernehmen Herausgeber, Redaktion und<br />
Verlag keine Gewähr. Namentlich oder mit Initialen<br />
gekennzeichnete Beiträge vertreten eine vom<br />
Herausgeber unabhängige Meinung der Autoren.<br />
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird mitunter<br />
auf die gleichzeitige Verwendung mänlicher<br />
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche<br />
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl<br />
für beiderlei Geschlechter.<br />
Außerdem bittet die Redaktion um Verständnis,<br />
dass insbesondere Firmennamen je Artikel in der<br />
Regel nur einmal in ihrer werbeorientierten Form<br />
verwendet und entsprechende Begriffe häufig<br />
eingedeutscht werden.<br />
International Standard Serial Number:<br />
ISSN 0942-9336<br />
Diese Zeitschrift wurde aus umwelt schonendem<br />
Papier hergestellt.<br />
50 <strong>Stahlreport</strong> 5|19
BDS-Berufsbildung<br />
Seminare und sonstige (BDS-)Veranstaltungen<br />
2019<br />
Seminarthema Termin Tagungsort<br />
Stahleinkauf ( Seminar/Kooperation) 07.-08.05. Duisburg<br />
Flacherzeugnisse (Seminar) 14.-15.05. Duisburg<br />
Qualitäts- und Edelstahl (Seminar) 04.-05.06. Baunatal<br />
Stahlkunde (Seminar) 20.-22.08. Gröditz<br />
Stahleinkauf (Seminar/Kooperation) 10.-11.09. Duisburg<br />
Prüfbescheinigungen (Seminar) 18.09. Neuss<br />
Grobbleche (Seminar) 10.-11.10. Wernigerode<br />
Nichtrostende Stähle und ihre Produktformen (Seminar) 28.-30.10.<br />
Lüdenscheid<br />
Stahlkunde (Seminar) 03.-05.12. Gengenbach<br />
Stahleinkauf (Seminar/Kooperation) 10.-11.12. Duisburg<br />
Diese Übersicht gibt den Stand der Planungen für Lernteam- und Seminarveranstaltungen<br />
und zum Fernstudium sowie zu entsprechenden Kooperationen wieder.<br />
Änderungen jeder Art sind vorbehalten, vor allem Ergänzungen. Über weitere Details sowie zu<br />
den Anmeldemöglichkeiten informieren Sie sich bitte im Internet (www.stahlhandel.com) oder<br />
wenden sich telefonisch bzw. elektronisch an den<br />
BUNDESVERBAND DEUTSCHER STAHLHANDEL (BDS)<br />
Wiesenstraße 21 · 40549 Düsseldorf<br />
Telefon: 0211/86497-19 · Telefax: 0211/86497-22<br />
E-MAIL: WYNANDS-BDS@STAHLHANDEL.COM
OUR STEEL BRINGS<br />
YOUR WORLD TO LIFE<br />
Marcegaglia has been covering<br />
for 60 years the whole downstream<br />
and distribution steel value chain,<br />
featuring a unique strategic position,<br />
expressed through 72 international<br />
manufacturing standards for carbon<br />
and stainless steels and 136 internal<br />
specifications, also tailor-made.<br />
Today, more than 15,000 customers<br />
in Europe and worldwide confirm the<br />
group’s widespread presence in several<br />
market segments: distribution, mechanical<br />
engineering, machinery, building and<br />
construction, automotive, appliances,<br />
food and many others.<br />
mex<br />
co<br />
lu<br />
Get our app<br />
MEET US at<br />
MADE in Steel<br />
May 14-16, 2019<br />
Milan, Italy<br />
HALL 24<br />
STAND C7<br />
MARCEGAGLIA HQ<br />
via Bresciani, 16 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mn - Italy<br />
phone +39 . 0376 . 685 1<br />
www.marcegaglia.com