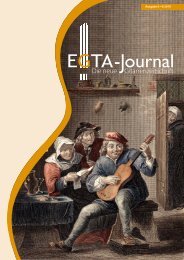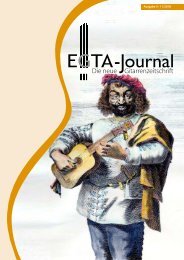EGTA-Journal 12-2019
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Stefan Hackl
Einige der Ländlerausgaben haben eine
obligate, andere eine optionale („willkürliche“)
Begleitung einer zweiten Gitarre.
Die frühen Duette (op. 16a, op. 55 und
die Auswahl aus dem Apollo-Saal) sind
für zwei Gitarren in Standardstimmung
geschrieben, die späteren verlangen für
die erste Stimme eine Terzgitarre.
Während die Nationalländer op. 16a zumindest
teilweise Arrangements von
Volksweisen sind, scheinen die anderen
Sätze vorwiegend Giulianis eigene Kompositionen
zu sein.
Giulianis erste Ländlerveröffentlichung
im Detail betrachtet:
16 Oesterreichische Nazionalländer Für
zwei Gitarren Componirt und dem Herrn
Heinrich Gründler Zugeeignet von Seinem
Lehrer Mauro Giuliani 16tes Werk erschienen
bei Artaria & Comp. im Jahr 1811.
Diese Ländler spiegeln mehr als alle anderen
die Sprache der österreichischen
Volksmusik wider. Einige von ihnen sind
offensichtlich traditionelle Melodien, die
noch im 20. Jahrhundert gespielt wurden
- z.B. die Nr. 1 ist unter dem Namen
„Schmalzer“ bekannt und wurde von
Alfred Quellmalz in Bozen 1942 auf Tonband
dokumentiert, eine Konkordanz zu
Nr. 11 findet sich in einem Manuskript
Steyerische Tänze (Kobenz, 1851). 7
Die Ländler op. 16a zeigen eine Vielzahl
verschiedener lokaler Stile. Die meisten
von ihnen haben eine einfache Metrik
(achttaktige Perioden) und harmonische
Struktur (Tonika und Dominante), nur Nr.
9 und 10 haben an Schubert erinnernde
harmonische Erweiterungen. Nr. 13
und 15 sind dem minimalistischen Innviertler
Ländlertyp (Oberösterreich) sehr
ähnlich. Nur Nr. 16 ist für Volksmusik eher
ungewöhnlich, es klingt wie ein konzer-
tantes Finale.
In Nr. 12 verwendet Giuliani ein Symbol
(ondeggiamento) für das typische „laterale“
Vibrato, wie es auf der Zither gespielt
wird. In modernen Ausgaben und Aufführungen
wird es manchmal mit dem
Symbol für einen Triller verwechselt,
aber das richtige Symbol für den Triller
(tr) erscheint eindeutig in Nr. 15. Wir finden
das ondeggiamento auch in anderen
Ländlern Giulianis (op. 80) und anderer
Komponisten (z.B. Franz Seegner, Zitter-Ländler
op. 2, Wien 1821).
Einige Noten werfen Fragen auf: In Nr.
7 sind offensichtlich einige Vorzeichen
falsch oder fehlen. Im zweiten Teil von
Nr. 15 würde der Basston A die Subdominante
suggerieren, aber
die Melodie erfordert die
Dominante (dasselbe gilt
für Nr. 12, T. 3). Als Septime
von H-Dur klingt das A seltsam,
aber vielleicht hat Giuliani
hier eine leere Saite bevorzugt
(der Basston H wäre
möglich, aber schwierig zu
greifen).
Ländler Arrangement von Sepp Eibl (1979). © Musikverlag Zimmermann
Im Allgemeinen trifft Giulianis
Satz sehr gut den
Stil der österreichischen
Volksmusik: Die Melodien haben einen
großen Ambitus mit den typischen Registerwechseln
zwischen der Bruststimme
und dem Falsett, die in weiten
Dreiklangsprüngen unverkennbar
das Jodeln darstellen. Der rhythmische
Fluss von Achtelnoten wird gelegentlich
durch Hemiolen und synkopierte Rhythmen
unterbrochen (diese sind eigentlich
typisch für den Walzer). In Bezug auf die
Spieltechnik könnte die ausgiebige Verwendung
von Verzierungen darauf hindeuten,
dass Amateure mit Bindungen
jeglicher Art vertraut waren. Nr. 14 von
op. 16a erscheint - in einem 4/4 Takt - als
Studie in op. 1 (Teil 3, Nr. 10).
Ländler von Mauro Giuliani aus op. 80 in der Erstausgabe
(1817), © Bayerische Staatsbibliothek München
7 Dank an Walter Deutsch und Rudolf Pietsch für die Hilfe bei der Suche nach den Quellen.
Ausgabe 7 • 12/2019
7