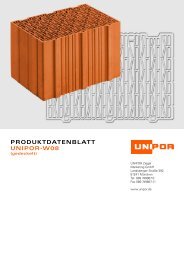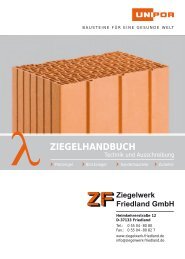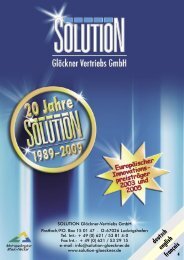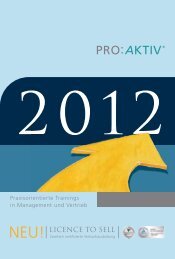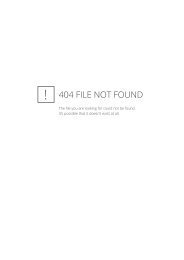Download: CSpiegel_1_2012.pdf - Kompetenznetz Mittelstand
Download: CSpiegel_1_2012.pdf - Kompetenznetz Mittelstand
Download: CSpiegel_1_2012.pdf - Kompetenznetz Mittelstand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4<br />
Resilienz<br />
Resilienzforschung gestern und heute Doreen Wagner<br />
Summary: In diesem Artikel sollen die wesentlichen Entwicklungslinien<br />
der Resilienzforschung in einem kurzen Abriss vorgestellt<br />
werden, dabei wir der Schwerpunkt auf den deutschen Forschungsraum<br />
gelegt. Um dem Konzept der Resilienz selbst näher<br />
zu kommen, wird anschließend ein in der deutschen Forschungslandschaft<br />
aktuell gut etabliertes Modell der theoretischen Einbettung<br />
des Konstrukts skizziert und die wesentlichen empirisch<br />
belegten Resilienzfaktoren benannt. In einem letzen Abschnitt<br />
wird es darum gehen, kurz die neuen Herausforderungen für die<br />
Resilienzforschung vorzustellen.<br />
Wesentliche Entwicklungslinien der Resilienzforschung<br />
Thema der Resilienzforschung ist die umfassende Ergründung der<br />
psychischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz), auf die ein Mensch<br />
zurückgreift, um Situationen positiv zu bewältigen, die als entwicklungsgefährdend<br />
eingeschätzt werden. Eine eigenständige<br />
Resilienzforschung entwickelte sich in den 70er Jahren des letzten<br />
Jahrhunderts zunächst in Großbritannien und Nordamerika, zu<br />
nennen sind hier v.a. Rutter 1979 mit der „Isle of Wight Studie“<br />
und die Kauei Studie von Werner und Smith (1982/2001) (vgl Artikel<br />
Resilienz und Familientherapie). Ende der 80er Jahre etabliert<br />
sich die Erforschung der Resilienz auch in Deutschland als fester<br />
Bestandteil der Forschungslandschaft (vgl. Fröhlich-Gildhoff &<br />
Rönnau-Böse 2009, S.10ff).<br />
Das Salutogenese Modell<br />
Den Anstoß zur Entwicklung einer eigenständigen Resilienzforschung<br />
in Deutschland gab vor allem das Salutogenese-Modell<br />
von Aaron Antonovsky. Dieser beförderte einen Paradigmenwechsel<br />
in der Gesundheitspsychologie – weg von der Pathogenese<br />
(Krankheitsperspektive) hin zu einer Salutogenese (Gesundheitsperspektive)<br />
(vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2009, S.13).<br />
Aufgrund der Bedeutung des Konzepts für die moderne Resilienzforschung<br />
und der Ähnlichkeit der Konzepte, sollen die wesentlichen<br />
Annahmen der Salutogenese an dieser Stelle kurz skizziert<br />
werden. Der israrelische Medizinsoziologe Antonovsky untersuchte<br />
Anfang der 70er Jahre den Gesundheitszustand von Holocaust<br />
Überlebenden und stellte dabei fest, dass ein Drittel der Personen<br />
trotz der extremen Belastungen bei guter körperlicher und psychischer<br />
Gesundheit waren. Er identifizierte bei diesen Personen<br />
übergreifende generalisierte Widerstandsressourcen (GRR). Diese<br />
Widerstandsressourcen prägen eine bestimmte, objektivierte<br />
Sicht auf die Welt, die er als sense of coherence (SOC) bezeichnete.<br />
Das Gefühl der Kohärenz umfasst drei wesentliche Aspekte<br />
und trägt entscheidend dazu bei, dass eine Person schwierige<br />
Lebensphasen meistert: Erstens das Vertrauen in die grundsätzliche<br />
Verstehbarkeit der auftretenden Ereignisse, zweitens das<br />
Vertrauen darin, diese bewältigen zu können und drittens das<br />
Vertrauen darin, dass ein tieferer Sinn dahinter steh und sich die<br />
Anstrengung lohnt (vgl. Kaluza 2003, S.352). Er hebt auf Grundlage<br />
dieser Ergebnisse die Dichotomie zwischen den Zuständen<br />
„krank“ und „gesund“ auf und postuliert stattdessen ein Kontinuum,<br />
dessen Endpunkte Krankheit und Gesundheit sind (Health<br />
- Ease - Disease – Continuum) (vgl. Dlugosch 1994, S.101ff). Das<br />
Konzept der Salutogenese ist dem der Resilienzforschung sehr<br />
ähnlich, jedoch werden unterschiedliche Akzente gesetzt: In der<br />
Salutogenese geht es darum, Schutzfaktoren zur Erhaltung der<br />
Gesundheit zu identifizieren, in der Resilienzforschung geht es<br />
im Wesentlichen um den Prozess der positiven Anpassung und<br />
Bewältigung schwieriger Situationen – unter Rückgriff auf Schutz-<br />
bzw. Resilienzfaktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse<br />
2009, S.13f).<br />
Resilienz als Kompetenz<br />
In der Gesundheitspsychologie wurde lange davon ausgegangen,<br />
dass Resilienz eine stabile Persönlichkeitseigenschaft ist. Es wurden<br />
zunächst Typenmodelle entwickelt, mit dem Ziel, einen konkreten<br />
Typus resilienter Personen zu finden. In den 70er Jahren<br />
des letzten Jahrhunderts ergaben Untersuchungen ein Resilienzkonzept,<br />
welches dynamisch und veränderbar ist. Resilienz ist<br />
campus Spiegel · Redaktion Berlin · Telefon: 030 / 24 63 98 95 · www.campusnaturalis.de · Berlin · Frankfurt am Main · Hamburg · München