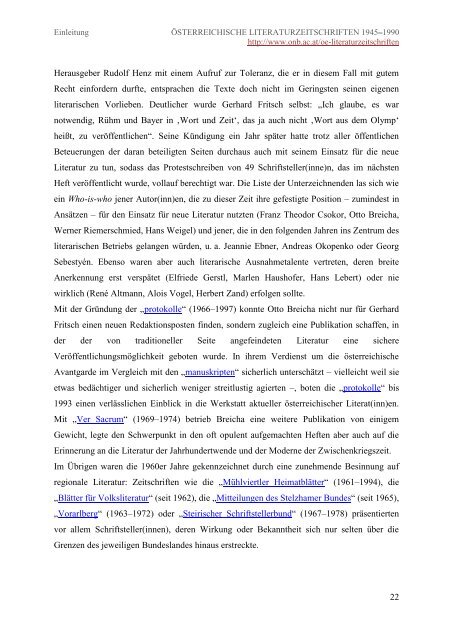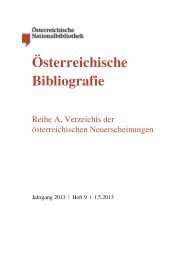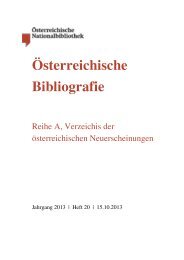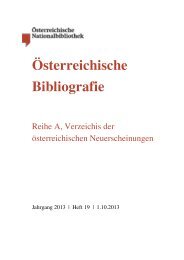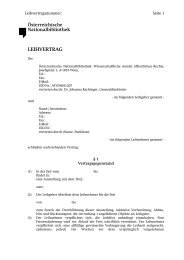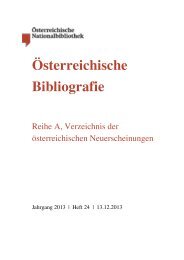Einleitung - Österreichische Nationalbibliothek
Einleitung - Österreichische Nationalbibliothek
Einleitung - Österreichische Nationalbibliothek
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Einleitung</strong> ÖSTERREICHISCHE LITERATURZEITSCHRIFTEN 1945–1990<br />
http://www.onb.ac.at/oe-literaturzeitschriften<br />
Herausgeber Rudolf Henz mit einem Aufruf zur Toleranz, die er in diesem Fall mit gutem<br />
Recht einfordern durfte, entsprachen die Texte doch nicht im Geringsten seinen eigenen<br />
literarischen Vorlieben. Deutlicher wurde Gerhard Fritsch selbst: „Ich glaube, es war<br />
notwendig, Rühm und Bayer in ‚Wort und Zeit‘, das ja auch nicht ‚Wort aus dem Olymp‘<br />
heißt, zu veröffentlichen“. Seine Kündigung ein Jahr später hatte trotz aller öffentlichen<br />
Beteuerungen der daran beteiligten Seiten durchaus auch mit seinem Einsatz für die neue<br />
Literatur zu tun, sodass das Protestschreiben von 49 Schriftsteller(inne)n, das im nächsten<br />
Heft veröffentlicht wurde, vollauf berechtigt war. Die Liste der Unterzeichnenden las sich wie<br />
ein Who-is-who jener Autor(inn)en, die zu dieser Zeit ihre gefestigte Position – zumindest in<br />
Ansätzen – für den Einsatz für neue Literatur nutzten (Franz Theodor Csokor, Otto Breicha,<br />
Werner Riemerschmied, Hans Weigel) und jener, die in den folgenden Jahren ins Zentrum des<br />
literarischen Betriebs gelangen würden, u. a. Jeannie Ebner, Andreas Okopenko oder Georg<br />
Sebestyén. Ebenso waren aber auch literarische Ausnahmetalente vertreten, deren breite<br />
Anerkennung erst verspätet (Elfriede Gerstl, Marlen Haushofer, Hans Lebert) oder nie<br />
wirklich (René Altmann, Alois Vogel, Herbert Zand) erfolgen sollte.<br />
Mit der Gründung der „protokolle“ (1966–1997) konnte Otto Breicha nicht nur für Gerhard<br />
Fritsch einen neuen Redaktionsposten finden, sondern zugleich eine Publikation schaffen, in<br />
der der von traditioneller Seite angefeindeten Literatur eine sichere<br />
Veröffentlichungsmöglichkeit geboten wurde. In ihrem Verdienst um die österreichische<br />
Avantgarde im Vergleich mit den „manuskripten“ sicherlich unterschätzt – vielleicht weil sie<br />
etwas bedächtiger und sicherlich weniger streitlustig agierten –, boten die „protokolle“ bis<br />
1993 einen verlässlichen Einblick in die Werkstatt aktueller österreichischer Literat(inn)en.<br />
Mit „Ver Sacrum“ (1969–1974) betrieb Breicha eine weitere Publikation von einigem<br />
Gewicht, legte den Schwerpunkt in den oft opulent aufgemachten Heften aber auch auf die<br />
Erinnerung an die Literatur der Jahrhundertwende und der Moderne der Zwischenkriegszeit.<br />
Im Übrigen waren die 1960er Jahre gekennzeichnet durch eine zunehmende Besinnung auf<br />
regionale Literatur: Zeitschriften wie die „Mühlviertler Heimatblätter“ (1961–1994), die<br />
„Blätter für Volksliteratur“ (seit 1962), die „Mitteilungen des Stelzhamer Bundes“ (seit 1965),<br />
„Vorarlberg“ (1963–1972) oder „Steirischer Schriftstellerbund“ (1967–1978) präsentierten<br />
vor allem Schriftsteller(innen), deren Wirkung oder Bekanntheit sich nur selten über die<br />
Grenzen des jeweiligen Bundeslandes hinaus erstreckte.<br />
22