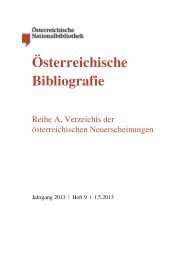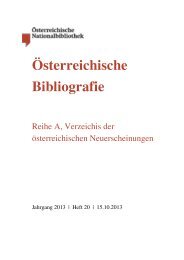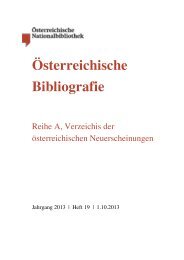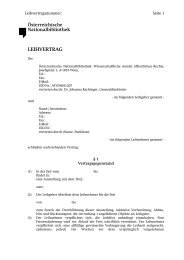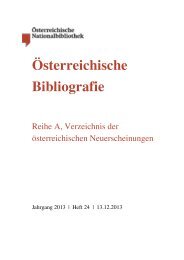Einleitung - Österreichische Nationalbibliothek
Einleitung - Österreichische Nationalbibliothek
Einleitung - Österreichische Nationalbibliothek
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Einleitung</strong> ÖSTERREICHISCHE LITERATURZEITSCHRIFTEN 1945–1990<br />
http://www.onb.ac.at/oe-literaturzeitschriften<br />
beschworene Selbstbild blieb nicht ohne Wirkung auf die Außensicht, die es teils übernahm<br />
und damit die – zweifellos – herausragende Stellung der „manuskripte“ noch weiter<br />
verfestigte. Der Wunsch nach dem historischen Fußabdruck war z. B. im ersten Heft von 1975<br />
unübersehbar. In seiner ungezeichneten Vorbemerkung schrieb Kolleritsch:<br />
In den Manuskripten erscheinen nur Erstveröffentlichungen. Sie werden für viele wichtige Arbeiten<br />
einmal die Grundlage für die Untersuchung von Textvarianten sein. 32<br />
Im deutlichen Gegensatz zu der Zeitschrift „Literatur und Kritik“, in der Gegenwartsliteratur<br />
in bestimmten Erscheinungsphasen gegenüber der Pflege und Re-Lektüre vorangegangener<br />
Schriftsteller(innen) teils einen schweren Stand hatte, bemühte sich Kolleritsch nur vereinzelt<br />
um ältere Autor(inn)en, wie etwa den steirischen Julius Franz Schütz oder – und dies äußerst<br />
verdienstvoll – den Surrealisten Raoul Hausmann. Ansonsten war Kolleritsch eher in ein Netz<br />
von Gleichaltrigen eingebunden. Ernst Jandl und Friederike Mayröcker gehörten zu den<br />
einflussreichsten Impulsgeber(inne)n der „manuskripte“. Von deren Vermittlung profitierte<br />
Kolleritsch, insbesondere in Bezug auf Oswald Wiener und auf die Wiener Gruppe überhaupt.<br />
Der Herausgeber behielt sich dennoch immer die letzte Entscheidung vor.<br />
An eine Spezifizierung der inhaltlichen Ausrichtung gelangten die „manuskripte“ am<br />
nächsten nicht zufällig im ideologisch aufgeheizten Jahr 1968. In einer „marginalie“ hatte<br />
Kolleritsch geschrieben:<br />
Die Literatur, die jetzt nur mehr politisch agitatorisch sein soll, wird zu leichtfertig angreifbar gemacht,<br />
verliert ihre notwendige Differenziertheit gegenüber der gleichgeschalteten Dummheit, und gibt so die<br />
Aktion einer begründbaren Bewußtseinsveränderung auf. […] Wenn Schneider die Avantgarde<br />
spöttisch angreift, so schneidet er den Ast ab, auf dem er selbst sitzt, weil er nicht begreift, daß ein<br />
konkretes Gedicht heute genauso eine Kampfansage gegen das Establishment ist wie ein ästhetisches<br />
Maoabzeichen. 33<br />
Michael Scharang setzte sich dagegen im nächsten Heft in einem langen Brief für die neue<br />
linke, sozialkritische Literatur im Gefolge der 68er ein. Während sich später auch Elfriede<br />
Jelinek an seine Seite gesellte, vertrat Peter Handke die entgegengesetzte Position:<br />
Außerdem interessiert es mich immer weniger, irgendwie überprüfbar effektiv zu werden, Hauptsache<br />
ich selber mache Erfahrungen beim Schreiben und Machen und dann auch Veröffentlichung [sic!] von<br />
Büchern. 34<br />
32 Manuskripte (1975), H. 46, S. [2].<br />
33 Alfred Kolleritsch: Marginalie. In: manuskripte (1969), H. 25, S. 3. – Bei gesagtem Schneider handelt es sich<br />
um den deutschen Schriftsteller Peter Schneider, der in dem von Hans Magnus Enzensberger verantworteten<br />
„Kursbuch“ die Literatur in den Dienst der Kulturrevolution stellen wollte.<br />
34 Zitiert nach Manuskripte (1969), H. 26, S. 1.<br />
26