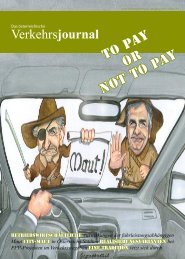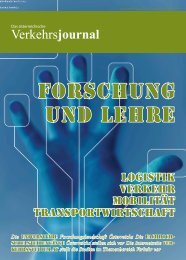Journal als PDF - Verkehrsjournal
Journal als PDF - Verkehrsjournal
Journal als PDF - Verkehrsjournal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TRANSITvERkEHRSPOLITIk DER ScHwEIZ<br />
Einleitung<br />
Der Alpenraum leidet unter dem stetig steigenden Ver-<br />
kehrsaufkommen und die dadurch entstehenden Schäden<br />
und Kosten. Insbesondere die Schweiz, dessen geogra-<br />
phische Lage und das daraus resultierende Transitver-<br />
kehrsproblem, stellt die Verkehrspolitik des Landes vor<br />
große Herausforderungen.<br />
Die Schweiz gehört, im Gegensatz zu den beiden eben-<br />
falls vom Transit-verkehr betroffenen Alpenraumlän-<br />
dern Frankreich und Österreich, nicht der Europäischen<br />
Union an.<br />
Methodik<br />
Diese wissenschaftliche Arbeit basiert auf einer voran-<br />
gegangenen Literaturrecherche ausgewählter Werke<br />
aus den Bereichen Verkehr, Verkehrspolitik, Verkehrs-<br />
wirtschaft und Alpenverkehrspolitik. Die gewonnenen<br />
theoretischen Erkenntnisse werden mit statistischem<br />
Datenmaterial und im Vorfeld eingeholten Expertenmei-<br />
nungen verglichen und bewertet.<br />
Aufbau der Arbeit<br />
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf den al-<br />
penquerenden Güterverkehr. Der Personenverkehr wird<br />
weitgehend außer Acht gelassen. Weiters werden die<br />
beiden Verkehrsträger Schiene und Straße näher be-<br />
leuchtet.<br />
Zunächst soll auf theoretische Grundlagen und auf De-<br />
finitionen sowie deren Abgrenzung eingegangen wer-<br />
den. Nach einer kurzen Umschreibung des Transitver-<br />
kehrsproblems folgt eine allgemeine Beschreibung der<br />
verkehrspolitischen Lage des Alpenraums und insbeson-<br />
dere der Schweiz. Ferner eine Übersicht der politischen<br />
Maßnahmen zur Verminderung des Transitverkehrs. An-<br />
schließend folgt ein Vergleich mit der österreichischen<br />
Verkehrspolitik. Abschließend wird ein kurzes Resümee<br />
gezogen.<br />
58 <strong>Verkehrsjournal</strong><br />
Allgemeines<br />
In diesem einführenden Kapitel werden die wichtigsten<br />
Begriffe genauer definiert. Des Weiteren erfolgen ein<br />
kurzer Abriss der Schweizer Ge-schichte sowie ein ge-<br />
ografischer Überblick. Anschließend ein Abbruch der<br />
Entwicklung des Verkehrs in dieser Region sowie dessen<br />
Entwicklung der Straßen- und Schieneninfrastruktur.<br />
Definitionen<br />
Transitverkehr<br />
Im Einzelnen versteht man unter Verkehr alle Maßnah-<br />
men die der Orts-veränderungen von Gütern, Personen<br />
und Nachrichten dienen [vgl. Kummer, 2006]. Als Tran-<br />
sit bezeichnet man alle Verkehrs- und Warenströme, die<br />
ein Gebiet durchqueren ohne dass die physischen Güter<br />
zolltechnisch abgefertigt, werden [vgl. www.logistikwo-<br />
erterbuch.or.at, 2008]. Folglich wird unter dem Begriff<br />
Transitverkehr jener Verkehr innerhalb eines Staates<br />
verstanden, bei dem weder die Quelle (Versender) noch<br />
die Senke (Empfänger) in dem betreffenden Staat liegt<br />
[vgl. Kummer, 2006]. Abgrenzend dazu Verkehre deren<br />
Quelle und Senke innerhalb eines Staates liegen, diese<br />
werden <strong>als</strong> Binnenverkehr im engeren Sinne be-zeichnet<br />
[vgl. Kummer, 2006].<br />
Verkehrspolitik<br />
Unter Verkehrspolitik versteht man die Summe der Maß-<br />
nahmen eines Staates zur Gestaltung und Beeinflussung<br />
des Verkehrssystems. Eine effiziente Verkehrspolitik<br />
sollte zum Ziel haben, die Verkehrssituation für alle Be-<br />
teiligten möglichst optimal zu gestalten und dazu bei-<br />
tragen gesamtwirtschaftliche Ziele zu erreichen. Träger<br />
der Verkehrspolitik sind Institutionen in deren Rahmen<br />
Personen tätig sind, die verkehrspolitische Prozesse in<br />
Gang setzen und vollziehen [vgl. Kummer, 2006].<br />
Entwicklung des Verkehrs in der Schweiz<br />
Wie gut sich ein Land wirtschaftlich entwickelt, hängt<br />
von jeher eng mit seiner Verkehrserschließung zusam-<br />
men. Die Alpen stellen ein natürliches Hindernis zwi-<br />
schen den nördlichen und südlichen Wirtschaftssektoren<br />
Europas dar. Dieser Alpenriegel lässt nur wenig Über-<br />
gänge zu. Um die Beziehungen und den Handel zu för-<br />
dern wurden immer wieder neue und schnellere Wege<br />
durch die Alpen geschaffen. Einerseits ist die Schweiz<br />
<strong>als</strong> rohstoffarmes aber wirtschaftlich starkes Land auf<br />
eine gute Verkehrsverbindung angewiesen. Anderer-<br />
seits hat die Schweiz in der kürzeren Vergangenheit ein<br />
durchaus alarmierendes Verkehrswachstum erlebt [vgl.<br />
technik.geschichte-schweiz.ch, 2008].<br />
Die Schweiz besitzt eine wichtige Aufgabe <strong>als</strong> Transit-<br />
land für den europäischen Nord-Süd-Verkehr und hat<br />
viel in den Ausbau ihres Straßen- und Schienennetzes<br />
investiert. In den folgenden beiden Abschnitten wird die<br />
Entwicklung der beiden Infrastrukturnetze kurz erläu-<br />
tert.<br />
Abb.1:Nation<strong>als</strong>traßennetz Abb.2: Schienennetz<br />
Entwicklung des Straßenverkehrsnetzes<br />
1805 wurde der Simplonpass <strong>als</strong> erste europäische<br />
Hochalpenstraße für den Wagenverkehr eröffnet. Zwi-<br />
schen 1821 und 1823 wurden die Bünd-ner Pässe San<br />
Bernardino und Splügen für den Wagenverkehr ausge-<br />
baut und 1830 wurde der Gotthardpass eröffnet. Wäh-<br />
rend beispielsweise in Deutschland ab 1930 der Auto-<br />
bahnbau vom Staat gefördert wurde, begnügte sich die<br />
Schweiz zunächst mit Ausbauten der Hauptstraßen [vgl.<br />
technik.geschichte-schweiz.ch, 2008]. Das Straßenwe-<br />
sen war bis Anfang der fünfziger Jahre noch kantonal<br />
geregelt. Erst 1958 haben die Schweizer mit fast 85%<br />
einer Verfassungsänderung zugestimmt, die den Bau<br />
eines nationalen Straßennetzes ermöglichte. Das Nati-<br />
on<strong>als</strong>traßengesetz von 1960 legt die Nation<strong>als</strong>traßen <strong>als</strong><br />
Gemeinschaftswerk von Bund und Kantonen fest [vgl.<br />
Liechti, 2000]. Seither wurde das Netz kontinuierlich<br />
ausgebaut und erreichte Ende 2006 eine Gesamtlän-<br />
ge von 1758 Kilometer beziehungsweise 93% der ge-<br />
planten Gesamtlänge. Der festgelegte Ziel-wert liegt<br />
bei 1892 Kilometer und soll im Jahre 2020 erreicht sein<br />
[vgl. www.bfs.admin.ch, 2008]. Die nachfolgende Ab-<br />
bildung zeigt das derzeitige Straßennetz (Stand 2006),<br />
wobei das Nation<strong>als</strong>traßennetz grün darge-stellt ist. Die<br />
roten Pfeile weisen auf die geographische Lage der vier<br />
wichtigsten Alpenübergänge hin, auf die später noch nä-<br />
her eingegangen wird.<br />
Entwicklung des Schienenverkehrsnetzes<br />
Der Eisenbahnbau hat in der Schweiz vergleichsweise<br />
spät eingesetzt. Es wurde zwar bereits 1836 eine Eisen-<br />
bahngesellschaft gegründet, welche aus Geldmangel<br />
jedoch scheiterte. Erst 1847 wurde die erste Strecke von<br />
Zürich nach Baden eingeweiht. Die weitere Erschlie-<br />
ßung des Mittellandes schritt rasant voran. Nur die Alpen<br />
waren für die Eisenbahn vorerst unüberwindbar. Nach<br />
10 jähriger Bauzeit konnte der Gotthard-Eisenbahn-<br />
<strong>Verkehrsjournal</strong> 59