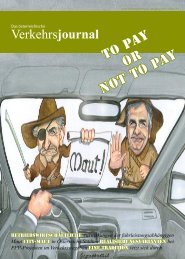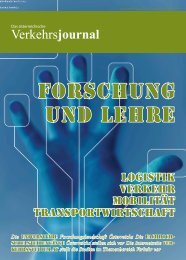Journal als PDF - Verkehrsjournal
Journal als PDF - Verkehrsjournal
Journal als PDF - Verkehrsjournal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TRANSITvERkEHRSPOLITIk DER ScHwEIZ<br />
die Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT),<br />
das bilaterale Landverkehrsabkommen Schweiz und<br />
der Europäischen Union (EU)<br />
verschiedene flankierende Maßnahmen<br />
Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe<br />
Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)<br />
setzt das Verur-sacherprinzip und damit die Kostenwahr-<br />
heit im Schwerverkehr durch. Sie muss für alle Motor-<br />
fahrzeuge und deren Anhänger entrichtet werden, die ein<br />
zulässiges Gesamtgewicht von mehr <strong>als</strong> 3,5 Tonnen auf-<br />
weisen, dem Gütertransport dienen und das öffentliche<br />
Straßennetz der Schweiz befahren [vgl. Wicki, 1999].<br />
Mit der Einführung der LSVA (2001) und der Erhöhung<br />
der Gewichtsbe-schränkung von 28 Tonnen auf 40 Ton-<br />
nen (2005) hat sich die Produktivität im Straßenverkehr<br />
erhöht [vgl. www.bav.admin.ch, 2008]. Der Leerfahrten-<br />
anteil war mit 23% in der Schweiz ungleich höher <strong>als</strong><br />
beispielsweise in Frankreich (5%) und Österreich (8%).<br />
Mit der Einführung und der Erhöhung der LSVA wur-<br />
de dem gegengesteuert. Ebenfalls ist seit dem Jahr 2001<br />
ein Rückgang an Straßengüterfahrzeuge von 10% zu<br />
verzeichnen, was unter anderem auf die Einführung der<br />
LSVA zurückzuführen ist [vgl. Bundesamt für Raument-<br />
wicklung, 2001].<br />
Die Einnahmen aus der LSVA werden zu einem Groß-<br />
teil in den Bau der neuen Eisenbahn-Alpentransversale<br />
(NEAT) investiert.<br />
Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT)<br />
Nach 30 Jahre dauernden Vorarbeiten, Diskussionen und<br />
Entwürfen von Experten und Kommissionen stimmte<br />
das Schweizer Volk 1992 dem Bau der Neuen Eisen-<br />
bahn-Alpentransversale (NEAT) zu. Für die Verlage-<br />
rung des Güterschwerverkehrs von der Straße auf die<br />
Schiene muss die Schieneninfrastruktur modernisiert<br />
und ausgebaut werden. Die NEAT umfasst die beiden<br />
Jahrhundertwerke des Tunnelbaus. Den 2007 eröffneten<br />
Lötschberg - Basistunnel, der zusammen mit dem Sim-<br />
plontunnel die Lötschberg - Simplon - Basisstrecke bil-<br />
det. Von größerer Bedeutung für die Verlagerung wird<br />
indes der 57 Kilometer lange Gotthardbasistunnel sein,<br />
dessen endgültige Fertigstellung 2019 geplant ist.<br />
Die Erhöhung der Transitkapazität wird weiterhin mit<br />
den großen Investitionen in den kommenden Jahren<br />
gewährleistet. Ziel der beiden NEAT-Achsen ist es, lei-<br />
stungsfähige Bahnverbindungen für Güter zwischen der<br />
Nord- und der Südseite der Alpen zu schaffen [vgl. Bun-<br />
desamt für Raumentwicklung, 2001].<br />
Verlagerungsgesetz<br />
Der Verlagerungsauftrag in der Verfassung verlangt,<br />
einen möglichst großen Teil der alpenquerenden Güter-<br />
ströme statt auf der Straße auf der Schiene zu bewälti-<br />
gen. Das auf der Bundesverfassung der Schweizer Eid-<br />
genossenschaft gestützte Verlagerungsgesetz beinhaltet<br />
Folgendes [Bundesverfassung der Schweizer Eidgenos-<br />
senschaft, 2008]:<br />
1. „Der Bund ist bestrebt, zum Schutz des Alpengebietes<br />
in Zusammen-arbeit mit den Kantonen, den Bahnen und<br />
seinen europäischen Part-nern eine sukzessive Verlage-<br />
rung von alpenquerendem Güterschwerverkehr auf die<br />
Schiene zu erzielen.“<br />
2. „Für den auf den Transitstrassen im Alpengebiet ver-<br />
bleibenden alpenquerenden Güterschwerverkehr gilt<br />
eine Zielgrösse von 650 000 Fahrten pro Jahr, welche<br />
möglichst rasch, spätestens zwei Jahre nach Eröffnung<br />
des Lötschberg - Basistunnels erreicht werden soll.“<br />
3. „Falls das Verlagerungsziel nach den Absätzen 1 und<br />
2 gefährdet er-scheint, legt der Bundesrat Zwischen-<br />
schritte für die Verlagerung fest und trifft die notwen-<br />
digen Massnahmen oder beantragt diese der Bundesver-<br />
sammlung. Er schlägt nötigenfalls weitere Massnahmen<br />
im Rahmen der Botschaft für ein Ausführungsgesetz zu<br />
Artikel 84 der Bundesverfassung vor.“<br />
Die verkehrspolitisch angestrebte Reduzierung der Stra-<br />
ßensendungen auf 650.000 LKW-Sendungen pro Jahr<br />
bis 2009 wird nicht erreicht werden.<br />
Waren es im Jahr 2000 noch 1.430.000 Schwerfahr-<br />
zeuge, überquerten 2007 noch 1.263.000 Schwerfahr-<br />
zeuge die Schweizer Alpen auf der Straße. Die Richtung<br />
stimmt. Das Ziel zwei Jahre nach Eröffnung des Lötsch-<br />
berg - Basistunnels die Anzahl zu halbieren wurde aber<br />
verfehlt.<br />
Bilaterales Landverkehrsabkommen<br />
Das Landverkehrsabkommen der Schweiz mit der Euro-<br />
päischen Union sichert die nachhaltige Schweizer Ver-<br />
kehrspolitik gegenüber Europa ab und bringt eine koor-<br />
dinierte Politik zum Schutz des gesamten Alpenrau-mes<br />
[vgl. Wicki, 1999].<br />
Das NEAT-Konzept ist auch Bestandteil des Transitab-<br />
kommens von 1992 und des Landverkehrsabkommens<br />
zwischen der Schweiz und der EU. Das deutliche Ja von<br />
Volk und Ständen am 29. November 1998 hat entschei-<br />
dend dazu beigetragen, dass die Verhandlungen über das<br />
Landverkehrsabkommen abgeschlossen werden konnte.<br />
Fond für Infrastrukturprojekte (FinöV-Fond)<br />
Der seit 1998 bestehende FinöV - Fonds sichert außer-<br />
halb des ordentli-chen Bundesbudgets die Finanzierung<br />
der Eisenbahnprojekte. Der Fonds umfasst Bahninfra-<br />
strukturprojekte, die einander ergänzen und eine Lei-<br />
stungssteigerung beim öffentlichen Verkehr ermögli-<br />
chen. Dieses Vorhaben basiert auf dem Grundsatz der<br />
nachhaltigen Verkehrs- und Verlagerungspolitik, wie<br />
er in Volksabstimmungen wiederholt bestätigt worden<br />
ist. Der Finöv - Fonds des Bundes wird zu 2/3 aus den<br />
Einnahmen der LSVA finanziert, während die übrigen<br />
Gelder aus der Mehrwert- und aus der Mineralölsteuer<br />
stammen [vgl. www.bav.admin.ch, 2008].<br />
m<br />
Vergleich Schweiz - Österreich<br />
Die topografische und geographische Lage der bei-<br />
den Länder, und dass daraus resultierende Transitver-<br />
kehrsproblem, stellt deren jeweilige Ver-kehrspolitik vor<br />
große Herausforderungen. Die Probleme sind weitge-<br />
hend deckungsgleich, die Lösungsansätze jedoch größ-<br />
tenteils verschieden. Im Gegensatz zur Schweiz gehört<br />
Österreich seit 1995 der Europäischen Union (EU) an,<br />
was die Ausgangssituation entscheidend beeinflusst.<br />
Die Schweiz verzichtet seit einer Volksabstimmung<br />
1994 auf den Aus-bau der Kapazität der Transitstrassen,<br />
stattdessen wird die Verlagerung des Transitverkehrs auf<br />
die Schiene angestrebt. Wohingegen es in Öster-reich<br />
nicht so einfach funktioniert und man in vielen Punkten<br />
von der gemeinsamen Verkehrspolitik der EU abhängig<br />
ist. Allgemein bezieht die Schweiz das Volk viel stärker<br />
in verkehrspolitischen Entscheidungen mit ein. Wäh-<br />
rend in Österreich der Straßengüterverkehr weiter stark<br />
zunimmt, ist es der Schweizer Verkehrspolitik gelungen,<br />
das Wachstum zu verringern. Im alpenquerenden Güter-<br />
verkehr dominiert bezüglich der beförderten Menge in<br />
Österreich klar die Straße mit 73%. Wo hingegen in der<br />
Schweiz der Anteil der Straße nur 36% und der Schie-<br />
nenanteil 64% beträgt. In diesem Punkt hat Österreich<br />
sicherlich noch Aufholbedarf.<br />
Die Schweiz hat bereits im Jahr 2001 eine LKW-Maut<br />
eingeführt, die auf allen Straßen zu bezahlen ist und<br />
nicht wie in Österreich nur auf Autobahnen und Schnell-<br />
straßen. Auch ist die LKW-Maut in der Schweiz deutlich<br />
höher. In der Schweiz zahlen Lkw für jeden zurückge-<br />
legten Kilometer durchschnittlich 50 Cent. In Österrei-<br />
ch zahlen LKW nur für die hochrangigen Straßen ge-<br />
fahrenen Kilometer, und dort im Durchschnitt lediglich<br />
23 Cent pro Kilometer. Die daraus resultierenden Ein-<br />
nahmen fließen in der Schweiz direkt in den Ausbau der<br />
Schieneninfrastruktur. Wohingegen in Österreich damit<br />
der Ausbau der Schnellstraßen und Autobahnen finan-<br />
ziert wird.<br />
Zusammenfassung<br />
Im Herzen Europas gelegen besitzt die Schweiz eine<br />
66 <strong>Verkehrsjournal</strong> <strong>Verkehrsjournal</strong><br />
67