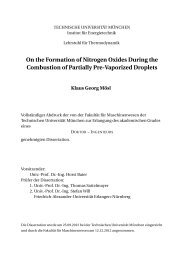Bestimmung des Blasenverhaltens beim unterkühlten ...
Bestimmung des Blasenverhaltens beim unterkühlten ...
Bestimmung des Blasenverhaltens beim unterkühlten ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Grundlagen Blasensieden ohne Konvektion (Behältersieden)<br />
2.2 Blasensieden ohne Konvektion (Behältersieden)<br />
Aufgrund der Komplexität <strong>des</strong> Siedeprozesses erscheint es zunächst sinnvoll, die physikalischen<br />
Vorgänge <strong>beim</strong> Blasensieden in Behältern, also ohne erzwungene Strömung, genauer<br />
zu betrachten. Diese beinhalten die Keimbildung, die Verdampfung unter Einwirkung von<br />
Kapillarkräften, die Bewegung und Dynamik der Phasengrenzflächen, den Impulsaustausch<br />
<strong>beim</strong> Wachsen der Blase mit der flüssigen Phase, die Interaktionen benachbarter Blasen sowie<br />
die instationären Wärmeströme in der Heizwand. Diese Vorgänge zeigen offensichtlich ein<br />
chaotisches Verhalten. Bei kleinen Änderungen der System- oder Versuchsparameter zeigt<br />
sich ein deutlich verändertes Siedemuster. In der Vergangenheit wurden für die <strong>Bestimmung</strong><br />
<strong>des</strong> Wärmeübergangskoeffizienten zahlreiche mechanistische Modelle konzipiert und Korrelationen<br />
für technische Anwendungen entwickelt.<br />
2.2.1 Mechanismen der Wärmeübertragung<br />
Viele Modelle zur Ermittlung <strong>des</strong> Wärmestroms <strong>beim</strong> Blasensieden basieren auf <strong>des</strong>sen<br />
Aufspaltung in unterschiedliche Wärmetransportprozesse <strong>beim</strong> Wachstum und Aufstieg einer<br />
Blase, wie sie in Abbildung 2.4 nach Nordmann [Nor_81] dargestellt sind. Danach bilden sich<br />
Dampfblasen vorzugsweise in kleinen Vertiefungen auf der Siedefläche, den sogenannten<br />
Keimstellen, deren Anzahl mit ansteigender Heizflächentemperatur zunimmt. Die für das<br />
Wachstum der Blase benötigte Energie wird von der wandnahen, überhitzten Flüssigkeitsschicht<br />
geliefert. Die Heizfläche unterhalb der wachsenden Blase kühlt sich dabei ab. Die<br />
Blase, deren Form und Größe maßgeblich durch die Oberflächenspannung bestimmt wird,<br />
wächst so lange an, bis die Auftriebskräfte die Haftkräfte übersteigen. Nach dem Ablösevor-<br />
gang transportiert die Blase Wärme, die sich aus dem Volumen der Blase und die darin<br />
enthaltene Verdampfungsenthalpie zusammensetzt, von der Heizfläche weg. Außerdem wird<br />
in ihrem Nachlauf eine Driftströmung induziert, die für eine weitere Erhöhung der Konvektion<br />
sorgt. Die in der überhitzten Grenzschicht vorhandenen Temperaturunterschiede haben<br />
zur Folge, dass entlang der Blasenkontur unterschiedliche Oberflächenspannungen herrschen.<br />
Dadurch wird eine weitere Strömung, die sogenannte Marangoni-Konvektion, hervorgerufen.<br />
Liegt die Temperatur der Kernflüssigkeit unterhalb der Sättigungstemperatur, so findet am<br />
Blasenkopf ein Kondensationsprozess statt. Je nach Grad der Unterkühlung erfolgt die<br />
Blasenkondensation entweder thermisch oder fluiddynamisch kontrolliert [Nor_80]. Beim<br />
thermisch kontrollierten Kollaps limitieren die geringen Temperaturgradienten in der flüssigen<br />
Phase den Stofftransport während <strong>des</strong> Kondensationsvorgangs. Dagegen kollabiert die<br />
- 10 -