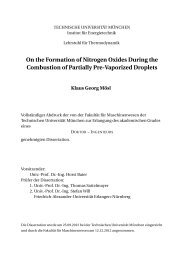Bestimmung des Blasenverhaltens beim unterkühlten ...
Bestimmung des Blasenverhaltens beim unterkühlten ...
Bestimmung des Blasenverhaltens beim unterkühlten ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Grundlagen Blasensieden ohne Konvektion (Behältersieden)<br />
Keimen entstehen, die als Gas- oder Dampfreste in den Rauhigkeitsvertiefungen der Heizfläche<br />
eingeschlossen sind. Die Vorstellungen, wie die Wärme hauptsächlich an das Fluid<br />
übertragen wird, unterscheiden sich hingegen teilweise wesentlich und sollen nachfolgend<br />
kurz erwähnt werden. Für eine genaue Betrachtung der Modelle sei auf die angegebene<br />
Literatur verwiesen.<br />
Die ersten Modelle von Jakob [Jak_31], Fritz [Fri_32] und Rohsenow [Roh_52] machten die<br />
Rührwirkung (auch Blasenagitation) der wachsenden und aufsteigenden Blasen und die<br />
damit verbundene Durchmischung der überhitzten Grenzschicht für die Verbesserung der<br />
Wärmeübertragung <strong>beim</strong> Blasensieden verantwortlich. Nach diesen Modellen sind die Blasen<br />
über ihre Kondensationswärme nicht direkt am Wärmestransport beteiligt und verursachen die<br />
Konvektionsströmung nur aufgrund ihrer hydrodynamischen Wirkung. Die Richtigkeit dieser<br />
Modelle wurde später aufgrund der geringen beobachteten Wachstumsgeschwindigkeit der<br />
Blasen von 0,1 bis 1 m/s angezweifelt, da die erhöhte Konvektion für die hohe Wärmeübertragungsverbesserung<br />
allein nicht ausreichend ist. Nach den Modellen von McAdams<br />
[Mca_49], Rohsenow und Clark [Roh_51] ist die latente Wärme, die bei der Entstehung der<br />
Dampfblasen Wärme von der Heizfläche und durch Kondensation an das Fluid transportiert,<br />
der dominierende Wärmeübertragungsmechanismus. Über den Beitrag der Verdampfung zur<br />
Wärmeübertragung herrschen allerdings konträre Meinungen. Andere Autoren, wie<br />
beispielsweise Beer [Bee_68], gehen davon aus, dass der Beitrag der latenten Wärme, die in<br />
Form <strong>des</strong> Blasenvolumens als Dampf gespeichert ist und während eines Blasenzyklus anfällt,<br />
für die Wärmeübertragung zu vernachlässigen sei. Die Mikrokonvektion, induziert durch<br />
Pumpwirkung wachsender und kondensierender Blasen, spielt bei dem Modell von Forster<br />
und Zuber [For_55] die dominierende Rolle. Beim Modell von Han und Griffith [Han_65] ist<br />
die Grenzschichtverdrängung der entscheidende Mechanismus, wonach heiße Flüssigkeitsballen,<br />
die sich oberhalb der wachsenden Blasen befinden, durch deren Anwachsen von der<br />
Heizwand in das Kernfluid wegtransportiert werden. Zusätzlich strömt kältere Flüssigkeit aus<br />
der Umgebung nach dem Abreißen der Blasen an den Ort der Blasenentstehung nach. Einen<br />
anderen Ansatz verfolgten Snyder und Robin [Sny_68] mit dem Modell <strong>des</strong> Massentransportes.<br />
Danach findet ein Energie- und Massentransport durch die Blase hindurch aufgrund<br />
von Verdampfung am Blasenfuß und Kondensation am Blasenkopf statt. Nach den Modellvorstellungen<br />
von Tien [Tie_62] und Beer [Bee_68] ist die Driftströmung entscheidend, die<br />
im Nachlauf ablösender Blasen entsteht. Hier ist insbesondere der Einfluss der Gravitation auf<br />
die Wärmeübertragung wichtig. Nach Straub [Str_93], der den Wärmeübergang unter<br />
Schwerelosigkeit an einem beheizten Draht untersuchte, spielt jedoch der Einfluss der Gravi-<br />
- 12 -