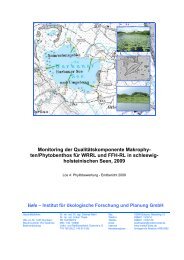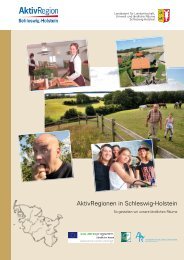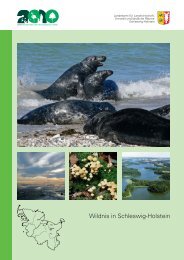Untersuchungsprogramm zur Ermittlung des nutzbaren ...
Untersuchungsprogramm zur Ermittlung des nutzbaren ...
Untersuchungsprogramm zur Ermittlung des nutzbaren ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1. Einführung<br />
- 1 -<br />
Zu den durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) den Ländern übertragenen Aufgaben gehört<br />
die wasserwirtschaftliche Rahmenplanung. Sie soll die für die Entwicklung der Lebens- und<br />
Wirtschaftsverhältnisse notwendigen wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen sichern. Sie ist<br />
dadurch gekennzeichnet, dass sie gleichzeitig alle gesamtwasserwirtschaftlich relevanten Fragen<br />
in einem Planungsraum betrachtet und somit die Grundlage für eine langfristige wasserwirtschaftliche<br />
Ordnung bildet. Dieses bedeutet, dass die zu erwartenden Anforderungen an<br />
den Wasserhaushalt abgeschätzt und die durch unterschiedliche Nutzungsinteressen möglicherweise<br />
entstehenden Konflikte gelöst werden können.<br />
Einen wichtigen Bestandteil der wasserwirtschaftlichen Rahmenplanung stellen Grundwasserbewirtschaftungspläne<br />
dar. Sie dienen dem Schutz <strong>des</strong> Grundwassers als Bestandteil <strong>des</strong><br />
Naturhaushaltes, der Schonung der Grundwasservorräte und sollen zudem den Nutzungserfordernissen<br />
Rechnung tragen. Eine der wesentlichen Ausgangsgrößen für diese Planungen<br />
ist das natürliche Grundwasserdargebot, welches im Rahmen von Erkundungsprogrammen<br />
ermittelt wird. Umfangreiche Untersuchungen zum Wasserhaushalt und <strong>zur</strong> Grundwasserbeschaffenheit<br />
sowie der Einsatz numerischer Grundwassermodellierung machen es möglich, die<br />
Auswirkungen tatsächlicher und angenommener Grundwasserentnahmen für einen Untersuchungsraum<br />
offenzulegen. Die Erkundungsprogramme liefern damit die naturwissenschaftliche<br />
Grundlage für die Bewirtschaftungsplanung.<br />
Die Frage, in welchem Umfang das so ermittelte Grundwasserdargebot der Nutzung <strong>zur</strong> Verfügung<br />
steht, kann jedoch unmittelbar nicht beantwortet werden. Jede Grundwassernutzung stellt<br />
einen Eingriff in den Wasserhaushalt dar, welcher zwangsläufig zu wie auch immer gearteten<br />
Veränderungen <strong>des</strong> Naturzustan<strong>des</strong> führt. Die Entscheidung, inwieweit diese Veränderungen<br />
ökologisch und ökonomisch tolerierbar sind, fällt nicht in die Zuständigkeit der Naturwissenschaften,<br />
sondern muss in Abgleich der Interessen aller Beteiligten basierend auf den gewonnenen<br />
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und gesetzlichen Regelungen getroffen werden.<br />
Durch Bevölkerungszuwachs und geänderte Lebensgewohnheiten war in Schleswig-Holstein<br />
in den letzten Jahrzehnten ein deutlicher Anstieg <strong>des</strong> Wasserverbrauchs zu verzeichnen. Während<br />
Ende der 60er Jahre der Bedarf an Trinkwasser bei rund 113 Mio. m³/a lag, stieg er bis<br />
zum Jahr 1992 auf etwa 218 Mio. m³/a an. Seit dem stagniert der Wasserverbrauch bzw. geht<br />
leicht <strong>zur</strong>ück. Im Kreis Pinneberg nordwestlich von Hamburg ist dieser Trend ebenfalls zu beobachten.<br />
So stieg z.B. die Grundwasserförderung der öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen<br />
von 19,8 Mio. m³ im Jahre 1975 auf 22,4 Mio. m³ im Jahre 1991, wobei die Freie und<br />
Hansestadt Hamburg einen Teil ihres Wasserbedarfs aus dem Kreisgebiet deckt.<br />
Abgelöst wurde das sich damit etwas entspannende Mengenproblem in den vergangenen Jah-<br />
ren vermehrt durch Nutzungseinschränkungen hinsichtlich der Grundwasserqualität, wie bei-<br />
spielsweise ansteigende Nitrat- und Pflanzenschutzmittelgehalte im oberflächennahen Grund-