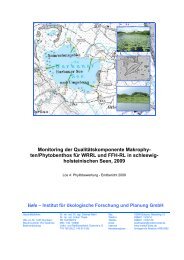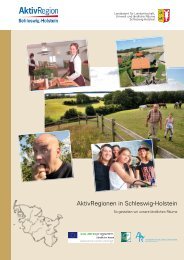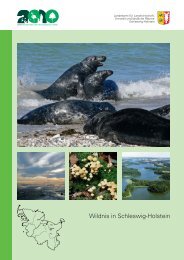Untersuchungsprogramm zur Ermittlung des nutzbaren ...
Untersuchungsprogramm zur Ermittlung des nutzbaren ...
Untersuchungsprogramm zur Ermittlung des nutzbaren ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 5 -<br />
Das quadratische Untersuchungsgebiet wurde für den Berechnungsgang in 33x33 Zellen<br />
(1089 Rasterzellen) der Größe von 500x500 m aufgeteilt. Die Gebietsgröße betrug demzufolge<br />
272,25 km². Die Hoch- und Rechtswerte (Gauss/Krüger) der Südwest- und Nordostecke <strong>des</strong><br />
Untersuchungsgebietes lauten:<br />
Rechtswert Hochwert<br />
Südwesten: 3545.750 5946.750<br />
Nordosten: 3562.250 5963.250<br />
1.3 Geomorphologischer und hydrologischer Überblick<br />
Die Landschaft Schleswig-Holsteins wird in entscheidender Weise durch die Ablagerungen der<br />
pleistozänen Vereisungen geprägt. Die glazialen Gesteinsserien erreichen in elstereiszeitlichen<br />
Rinnen nicht selten Mächtigkeiten von über 400 m. Wie SCHMIDTKE (1992: S. 8) anschaulich<br />
zeigt, liegt die Quartärbasis im Normalfall unter dem Meeresspiegelniveau. Denkt man sich die<br />
eiszeitlichen Sedimente weg, wäre Schleswig-Holstein heute bis auf wenige Inseln aus voreiszeitlichem<br />
Untergrund von einer vereinigten Nord- und Ostsee überflutet. Ablagerungen der<br />
Weichseleiszeit finden sich vor allem im nördlichen und östlichen Schleswig-Holstein östlich<br />
der Linie Flensburg - Schleswig - Rendsburg - Neumünster - Bad Segeberg - östlicher Stadtrand<br />
von Hamburg - nördlich Schwarzenbek und Büchen. Es handelt sich vorwiegend um junge<br />
Grund- und Endmoränen, die der Landschaft einen kuppigen Habitus verleihen. Westlich<br />
davon, in Richtung Westküste und Unterelbe, schließen sich ausgedehnte Sanderflächen an.<br />
Grund- und Endmoränenablagerungen der Saaleeiszeit finden sich vor allem an der Westküste<br />
sowie im südwestlichen und südöstlichen Schleswig-Holstein (vgl. GRIPP, 1964: Kt. 3).<br />
Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen den ausgedehnten Sanderflächen um Neumünster<br />
und Bad Bramstedt im Norden und den Elbmarschen im Süden. Die Saaleeiszeit (Drenthe-<br />
Stadium) hat hier eine mächtige Grundmoräne hinterlassen, die oberflächennah im ganzen<br />
Untersuchungsgebiet zu finden ist. Die jüngeren Eisvorstöße der Saaleeiszeit erreichten das<br />
Untersuchungsgebiet nicht mehr. Sie hinterließen jedoch glazifluviatile Sedimente, die z.T.<br />
recht grobkörniger Natur sind und die Drenthemoräne vielerorts überdecken. Besonders im<br />
Osten <strong>des</strong> Untersuchungsgebietes, im Dreieck Quickborn - Norderstedt - Hennstedt-Rhen, erreichen<br />
die saaleeiszeitlichen Sandersande eine Mächtigkeit von bis zu 30 m (SCHEER, 1995).<br />
Als das weichseleiszeitliche Inlandeis abschmolz, flossen die Schmelzwässer in den Tälern in<br />
Richtung auf das Elbeurstromtal. Als Relikt finden sich daher im Pinnau-, Bilsbek- sowie im<br />
Krückautal Schmelzwasserablagerungen in Form von Niederterrassen (KOERT, 1914;<br />
SCHRÖDER, STOLLER & WOLFF, 1913). Charakteristisch für das Untersuchungsgebiet sind<br />
auch ausgedehnte Niedermoore, die allerdings heute zu Großteil dräniert sind. Besonders hervorzuheben<br />
wären hier das Himmelmoor westlich von Quickborn sowie das Liether Moor östlich<br />
von Elmshorn.