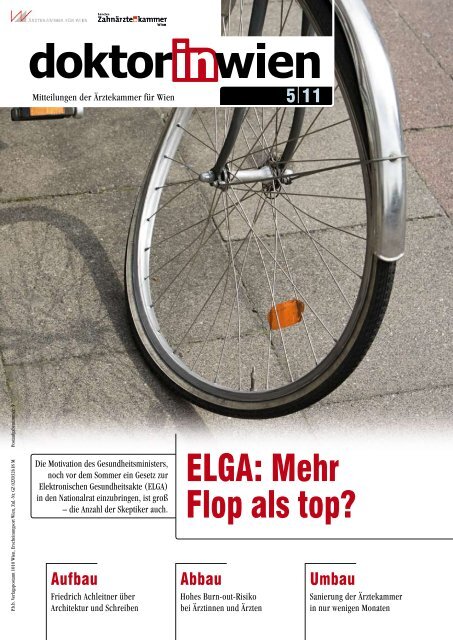ELGA: Mehr Flop als top? - PrOgiParK
ELGA: Mehr Flop als top? - PrOgiParK
ELGA: Mehr Flop als top? - PrOgiParK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
P.b.b. Verlagspostamt 1010 Wien, Erscheinungsort Wien, Zul.-Nr. GZ 02Z032618 M Postaufgabenummer: 5<br />
Die Motivation des Gesundheitsministers,<br />
noch vor dem Sommer ein Gesetz zur<br />
Elektronischen Gesundheitsakte (<strong>ELGA</strong>)<br />
in den Nationalrat einzubringen, ist groß<br />
– die Anzahl der Skeptiker auch.<br />
Aufbau<br />
Friedrich Achleitner über<br />
Architektur und Schreiben<br />
Abbau<br />
Hohes Burn-out-Risiko<br />
bei Ärztinnen und Ärzten<br />
5 11<br />
<strong>ELGA</strong>: <strong>Mehr</strong><br />
<strong>Flop</strong> <strong>als</strong> <strong>top</strong>?<br />
Umbau<br />
Sanierung der Ärztekammer<br />
in nur wenigen Monaten
Anmeldung<br />
Name/Adresse<br />
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an Medizin Akademie, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien<br />
Anmeldung per Fax: 01/546 00-740 oder www.medizin-akademie.at<br />
State of the Art/18. Juni 2011<br />
Institution ÖÄK-Nummer<br />
Möchten Sie regelmäßig per Mail über aktuelle DFP-Fortbildungsarbeiten informiert werden? Dann bestellen Sie den kostenlosen Newsletter der Medizin Medien Austria.<br />
E-Mail-Adresse<br />
Die drei D’s<br />
Depression, Demenz, Delir – ein Update<br />
Veranstalter: Fortbildungsreferat der Ärztekammer für Wien<br />
Programmgestaltung und Vorsitz: Priv.-Doz. Dr. Michael Rainer<br />
Referenten und Vorsitzende<br />
Mag. Martina Anditsch<br />
Anstaltsapotheke, Donauspital im SMZ Ost, Wien<br />
Prim. Dr. Christian Jagsch<br />
Geron<strong>top</strong>sychiatrie, Landesnervenklinik Sigmund Freud, Graz<br />
Chefarzt Prim. Dr. Georg Psota<br />
Psychosoziale Dienste in Wien (PSD)<br />
Priv.-Doz. Dr. Michael Rainer<br />
Psychiatrische Abteilung, Donauspital im SMZ Ost, Karl Landsteiner<br />
Institut für Gedächtnis- und Alzheimerforschung, Wien<br />
Prim. Dr. Andreas Walter<br />
Geron<strong>top</strong>sychiatrische Abteilung und Memory-Institut, Geriatriezentrum am Wienerwald, Wien<br />
MR Dr. Albert Wuschitz<br />
Niedergelassener Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Wien<br />
Sponsoren: Austroplant • CSC/Angelini • Germania • Lundbeck • Merz • Pfizer<br />
Mit<br />
Kinder-<br />
programm<br />
Achtung: Neuer Veranstaltungsort!<br />
Samstag, 18. Juni 2011<br />
9.00 bis 12.45 Uhr<br />
Courtyard Marriott Wien Messe<br />
Trabrennstraße 4, 1020 Wien
Sehr geehrte Frau Kollegin! Sehr geehrter Herr Kollege!<br />
Seit geraumer Zeit ist das beherrschende<br />
Thema der Gesundheitspolitik das<br />
„Sparen“. Wir geben angeblich zu viel Geld<br />
aus (was nicht stimmt, denn der Anteil der<br />
öffentlichen Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt<br />
ist mit ungefähr 8 Prozent<br />
die letzten Jahre hindurch annähernd<br />
gleich geblieben), und nunmehr muss gespart<br />
werden, um wichtigere Investitionen<br />
und Ausgaben tätigen zu können.<br />
Was auch immer von den verantwortlichen<br />
Politikern <strong>als</strong> wichtiger erachtet wird –<br />
dies können Tunnels, marode Banken<br />
oder Lobbyisten sein, die bedient werden<br />
müssen: „Ganz klar“, dass Geld im Sozialund<br />
Gesundheitswesen eingespart werden<br />
muss, um andere Begehrlichkeiten erfüllen<br />
zu können.<br />
Sparen ist angesagt<br />
Eine bessere Zusammenarbeit zwischen<br />
Ambulanzen und niedergelassenen Ärztinnen<br />
und Ärzten, wie von uns gefordert,<br />
wird aber genauso wenig umgesetzt wie<br />
notwendige und sinnvolle Präventionsprogramme,<br />
die kurzfristig Geld kosten und<br />
nur mittelfristig Wirkung zeigen. Kein<br />
Wunder <strong>als</strong>o, dass in Österreich um ein<br />
Drittel weniger für Prävention ausgegeben<br />
wird, <strong>als</strong> im Rest der OECD.<br />
Gerade in diesem Bereich gibt es aber noch<br />
viel zu tun. Vor allem Jugendliche haben einen<br />
deutlich ungesünderen Lebenswandel.<br />
In keinem anderen OECD-Land ist unter<br />
den 15-Jährigen der Anteil der Raucher so<br />
hoch wie in Österreich. Besonders deutlich<br />
ist der Abstand zu anderen Ländern bei<br />
Mädchen. Auch beim Alkoholkonsum steht<br />
Österreich im Vergleich nicht gut da. 36<br />
Prozent der Mädchen und 41 Prozent der<br />
Jungen im Alter von 15 Jahren geben an,<br />
brief des vizepräsidenten<br />
Warum Josef Pröll gerade jetzt<br />
Finanzminister hätte bleiben sollen<br />
�<br />
schon mindestens zweimal im Leben betrunken<br />
gewesen zu sein. Der mediale Aufschrei<br />
war groß, doch gibt es keine Anzeichen<br />
in der derzeitigen Gesundheitsdebatte,<br />
hier gezielt Gegenmaßnahmen zu setzen,<br />
geschweige denn, für frühzeitige Prävention<br />
Geld in die Hand zu nehmen.<br />
Eine bestimmte Geldmenge ist vorhanden,<br />
es ist allerdings zu wenig, um alles finanzieren<br />
zu können, und so muss gespart werden.<br />
Wo wird gespart? Dort, wo die verantwortlichen<br />
Politiker es am wenigsten für<br />
notwendig erachten, mehr Geld zu investieren.<br />
Bei jungen, gesunden, leistungsstarken<br />
und dynamischen Politikern gehört das Gesundheitssystem<br />
dazu. Hier könne gespart<br />
werden. Wozu benötigt auch schon ein junger,<br />
dynamischer, gesunder Politiker ein<br />
Spital oder eine Ordination? Hoffentlich gar<br />
nicht, und wenn ausnahmsweise doch,<br />
dann finden sich Wege, um Wartezeiten, Bewilligungen<br />
oder sonstige Hürden des Systems<br />
besser bewältigen zu können.<br />
Nunmehr ist etwas passiert, was so nicht<br />
vorgesehen war. Einer der dynamischen<br />
Politiker ist in relativ jungen Jahren erkrankt,<br />
und anstatt gerade so jemanden<br />
wie unseren erkrankten Finanzminister gesund<br />
zu pflegen und dann weiter in dieser<br />
verantwortungsvollen Position arbeiten zu<br />
lassen, wirft er das Handtuch und muss abgelöst<br />
werden. Ich habe selbstverständlich<br />
Verständnis für die Entscheidung des Vizekanzlers,<br />
aber sie tut mir nicht nur menschlich<br />
und persönlich, sondern auch gesundheitspolitisch<br />
weh. Gerade nach einer solchen<br />
Erkrankung und einem Spit<strong>als</strong>aufenthalt<br />
hätte er mehr Verständnis mit<br />
nicht ganz gesunden Menschen gehabt,<br />
und vielleicht hätte es seine Prioritätensetzung<br />
etwas beeinflusst.<br />
In eigener Sache<br />
Abbau von 180 Stellen<br />
In Sparzeiten wäre ein solches Signal besonders<br />
wichtig gewesen. So wird zum<br />
Beispiel das Universitätsbudget reduziert,<br />
was nicht nur Auswirkungen auf Lehre und<br />
Forschung, sondern sehr wohl auch Auswirkungen<br />
auf das gesamte Gesundheitssystem<br />
haben wird. Allein an der Medizinischen<br />
Universität Wien (AKH) müssen<br />
entweder 180 Stellen abgebaut oder viele<br />
Journaldiensträder gestrichen werden, um<br />
die neuen und strengeren Budgetvorgaben<br />
erfüllen zu können. Dies wird unweigerlich<br />
negative Auswirkungen auf die Versorgung<br />
der Patienten haben.<br />
Weniger Ärztinnen und Ärzte heißt weniger<br />
Versorgung, längere Wartezeiten für Patienten<br />
sowie Leistungsreduktionen.<br />
Wir werden noch sehen, wo genau es zu<br />
den Einsparungen kommt, aber ich<br />
fürchte, dass Unfall- sowie Notfallabteilungen<br />
genauso betroffen sein werden wie<br />
Operationskapazitäten und Anästhesieabteilungen.<br />
Gerade in solchen Zeiten würden wir uns<br />
einen verständnisvollen Finanzminister<br />
wünschen, für den das Gesundheitssystem<br />
und die Versorgung von kranken Menschen<br />
wichtiger, oder zumindest genauso<br />
wichtig, ist wie der Bau von Tunnels oder<br />
die Finanzierung von Banken und Abfangjägern.<br />
Mit freundlichen Grüßen, Ihr<br />
Thomas Szekeres
7. Neurologische<br />
Nähere Informationen: www.braindays.com<br />
Mag. Karin Preisinger: preisinger@medizin-akademie.at<br />
SAVE<br />
THE<br />
DATE<br />
Fortbildungstage<br />
30. 09. – 1. 10. 2011<br />
Themenschwerpunkte<br />
mit Scientific-Board<br />
• Parkinson<br />
Prim. Dr. Dieter Volc<br />
• Schmerzsyndrome<br />
Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Bach<br />
• Multiple Sklerose<br />
Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Kristoferitsch<br />
• Epilepsie<br />
Univ.-Prof. DI Dr. Chris<strong>top</strong>h Baumgartner<br />
NH Danube City<br />
Wagramer Straße 21 • 1220 Wien
inhalt<br />
05<br />
11<br />
i m p r e s s u m<br />
In eigener Sache 3<br />
Intro|Inhalt 5<br />
intern<br />
Friedrich Achleitner: „Von der Unmöglichkeit, über die Architektur<br />
zu schreiben?“ 6<br />
Berichte aus den Kurien und Referaten 12<br />
Ausschreibungen 17<br />
Kammerbereich 18<br />
Gesundheit und Politik 20<br />
cover<br />
<strong>ELGA</strong>: <strong>Mehr</strong> <strong>Flop</strong> <strong>als</strong> <strong>top</strong>? 22<br />
Die Motivation des Gesundheitsministers, noch vor dem Sommer ein<br />
Gesetz zur Elektronischen Gesundheitsakte (<strong>ELGA</strong>) in den Nationalrat<br />
einzubringen, ist groß – die Anzahl der Skeptiker auch.<br />
Fortbildung<br />
Vorträge | Tagungen | Symposien<br />
service<br />
26<br />
Medizin 28<br />
Webtipps 34<br />
Buchtipps 35<br />
Diensthabende Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 36<br />
Der aktuelle Kommentar von außen 37<br />
Kleinanzeigen 38<br />
Webbtipp s 34<br />
Immer mehr Menschen setzen auf Informationen<br />
aus dem Internet. Dass Klicks<br />
im Web den Arztbesuch nicht ersetzen,<br />
ist klar: Die Tendenz ist <strong>als</strong>o kein „entweder<br />
oder“, sondern es werden immer<br />
häufiger sowohl der Arzt <strong>als</strong> auch das<br />
Web konsultiert.<br />
Buchtipps s 35<br />
In letzter Zeit ist eine Reihe von interessanten<br />
Medizinrechtsbüchern erschienen.<br />
doktorinwien bringt in der aktuellen<br />
Ausgabe Rezensionen von „Der Weg in<br />
die ÄrzteGmbH/OG“, „Vielschichtiges<br />
Medizinrecht“ sowie „Handbuch Ärztliches<br />
Berufsrecht“.<br />
Herausgeber und Medieninhaber: Ärztekammer für Wien, Körperschaft des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Präsidenten, 1010 Wien,<br />
Weihburggasse 10–12, Tel.: 01/515 01, Fax: 01/515 01-1289, E-Mail: pressestelle@aekwien.at. Chefredakteur: Dr. Jörg Hofmann. Stellvertreter: Dr. Barbara Fischer-Schutti,<br />
Dr. Sabine Fradl, Dr. Marcus Franz, Dr. Klaus Frohner, Dr. Wolfgang Köstler, Dr. Wolfgang Kurth, Dr. Helmut Leitner, Dr. Astrid Schumich, MR Dr. Wolfgang Werner.<br />
Redaktion: Dr. Hans-Peter Petutschnig (Chef vom Dienst), Mag. Kathrin McEwen, Mag. Elisa Cavalieri, Michaela Muggi (Sekretariat, Fotos). Verleger: Medizin Medien Austria<br />
GmbH, 1050 Wien, Wiedner Hauptstraße 120–124, Tel.: 01/54 600-0, Fax.: DW 710, E-Mail: office@medizin-medien.at.<br />
Aboverwaltung: Sylvia Saurer, Tel.: 01/54 600-112, saurer@medizin-medien.at.<br />
Anzeigenleitung & Anzeigenverkauf: Reinhard Rosenberger, Tel.: 01/54 600-210. Anzeigensekretariat: Sylvia Saurer, Tel.: 01/54 600-112. Druck: Friedrich VDV, 4020 Linz.<br />
Fotonachweise: AEK Wien: 5, 16, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 37; Anton-Proksch-Institut: 30; Rüdiger Ettl: 16, 20; Fotolia XII: 1, 22; IntMedCom: 29; Krankenhaus Göttlicher Heiland:<br />
24; Doris Kucera: 23, 39; Bernhard Noll: 12 (2), 13, 15; Stefan Seelig: 7, 10, 23; Martin Stickler: 25; Gregor Zeitler: 3, 14.<br />
Inhalt|Intro<br />
intro<br />
Alles neu macht der Mai<br />
Der Rücktritt von Vizekanzler und Finanzminister<br />
Josef Pröll hat einen politischen<br />
Paukenschlag ausgelöst. Jetzt sind in der<br />
Regierung alle Zeichen auf Veränderung<br />
gestellt. Wir dürfen auf die Akzente des<br />
Teams der ÖVP gespannt sein. Ein eindeutiges<br />
Bekenntnis der neuen Finanzministerin<br />
zur Finanzierung des Gesundheitssystems<br />
blieb aber bisher noch aus. Warum<br />
sich aber Vizepräsident Thomas Szekeres<br />
gewünscht hätte, dass gerade jetzt Josef<br />
Pröll in seinem Amt bleibt, lesen Sie im<br />
Brief des Vizepräsidenten auf Seite 3.<br />
In der letzten Ausgabe von doktorinwien<br />
berichteten wir von der diesjährigen Preisverleihung<br />
des Paul-Watzlawick-Ehrenrings<br />
an Friedrich Achleitner. In der aktuellen<br />
Ausgabe können Sie dessen Vortrag<br />
im Rahmen der Preisverleihung nachlesen<br />
– ab Seite 6.<br />
Eine aktuelle Studie belegt, dass mehr <strong>als</strong><br />
die Hälfte der österreichischen Ärzteschaft<br />
Burn-out-gefährdet ist – alle Daten, Fakten<br />
und Forderungen der Ärztekammer ab<br />
Seite 12.<br />
Über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen<br />
im Haus der Ärztekammer sprechen<br />
im Interview ab Seite 14 Kammeramtsdirektor<br />
Thomas Holzgruber und Finanzdirektor<br />
Franz Hirtzi.<br />
In der Covergeschichte lesen Sie alles<br />
Wissenswerte über das Projekt <strong>ELGA</strong> – ab<br />
Seite 22.<br />
Als Schlusspunkt konnten wir diesmal einen<br />
besonders aktuellen Kommentar von<br />
außen bekommen: Oberösterreichs Landeshauptmann<br />
Josef Pühringer erklärt auf<br />
Seite 37, wie er die nachhaltige Absicherung<br />
der Spitzenmedizin in seinem Land<br />
garantieren möchte.<br />
Bilden Sie sich mit uns Ihre Meinung.<br />
Ihre Astrid Schumich<br />
E-Mail: ordination.schumich@gmail.com<br />
Fax: 515 01/1289 DW
Paul-WatzlaWick-EhrEnring dEr ÄrztEkammEr für WiEn 2011<br />
Von der Unmöglichkeit, über Architektur zu schreiben?<br />
Im Zuge der „Wiener Vorlesungen“ erhielt der österreichische Architekturexperte, Schriftsteller und Polyhistor Friedrich Achleitner am<br />
14. März 2011 im Kuppelsaal der Technischen Universität Wien den von der Wiener Ärztekammer gestifteten Paul-Watzlawick-Ehrenring<br />
2011. Der Preis wird an Menschen verliehen, die sich für den Diskurs zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen sowie um die Humanisierung<br />
der Welt verdient gemacht haben. Er ist eine Hommage an den großen – 2007 verstorbenen – Kommunikationstheoretiker Paul<br />
Watzlawick, der unter anderem durch seine Publikationen „Anleitung zum Unglücklichsein“ und „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ Bekanntheit<br />
erlangte. Im Rahmen der Preisverleihung hielt Achleitner einen Vortrag zum Thema „Von der Unmöglichkeit, über Architektur zu<br />
schreiben?“. doktorinwien bringt den Vortrag ungekürzt.<br />
� Mein Dank für diese große Auszeichnung ist lich beschreibende Literatur überhaupt gibt – hat-<br />
ein nicht ganz freiwilliger Vortrag über ein Thema, te jedenfalls Tore geöffnet. Seit dieser Zeit bin ich<br />
das vermutlich auch Anlass für diese Ehrung war für jeden Irrtum dankbar.<br />
und das mich mit großer Unsicherheit belastet. Eh- Gestatten Sie mir noch, dass ich für diese Ehrenrenringe<br />
können <strong>als</strong>o den unangenehmen Nebenringvorlesung – Paul Watzlawick würde vermuteffekt<br />
haben, dass sie den Beringten sanft aufforlich gleich die Frage stellen, handelt es sich um<br />
dern, einmal, in Form etwa einer Ringvorlesung, eine Ehrenring-Vorlesung oder um eine Ehrendarüber<br />
nachzudenken, was eigentlich die Mög- Ringvorlesung – zunächst alte Quellen einer Danlichkeiten<br />
und Grenzen seines Handwerks sind. kesrede benutze, die ich vor 25 Jahren halten<br />
Ich muss vorweg gestehen, und das ist keine billi- durfte, die den pessimistischen Titel hatte „Von<br />
ge Koketterie, dass ich mich nie zu den Wissen- der Unmöglichkeit, über Architektur zu schreischaftern<br />
gezählt und auch nie den Versuch unterben“. Heute verwende ich diesen Titel noch einnommen<br />
habe, etwa eine Architekturtheorie zu mal, allerdings mit einem Fragezeichen, was viel-<br />
basteln. Ich verwende hier absichtlich das Wort leicht ebenso ein Irrtum ist. Ich benütze ein länge-<br />
Handwerk, weil ich meinen Umgang mit Sprache res Zitat: Heimito von Doderer hat einmal ge-<br />
mit der Herstellung von Texten verbinde, die sich meint, es sei deshalb so schwierig, wenn nicht<br />
darin abmühen, ein ganz anderes Medium, näm- unmöglich, über Literatur zu schreiben, weil Gelich<br />
die Architektur, mithilfe der Sprache zu vergenstand und Reflexion sich im gleichen Medium<br />
mitteln.<br />
befänden, weil <strong>als</strong>o das Schreiben über Geschriebenes<br />
keine Chance hätte, das eigene System zu<br />
Sprache <strong>als</strong> „Material“<br />
verlassen. Demnach wäre es schlüssig, dass das<br />
Mir ist rechtzeitig eine Definition in die Hände ge- Schreiben über ein anderes Medium, etwa über<br />
fallen, die Beat Wyss einmal, ich vermute neben- die Architektur, von vornherein mehr Aussicht auf<br />
bei und ohne zu ahnen, was er damit anrichtet, <strong>als</strong> Wirklichkeitsnähe, auf eine tatsächliche Vermitt-<br />
„begleitenden Kommentar“ zum Baugeschehen lung von Wirklichkeit hätte. Aber es ist offenbar<br />
bezeichnet hat. Das war Wasser auf meine Mühlen gerade das Gegenteil der Fall.<br />
und gab mir die Chance, mir in dem an sich theo- Ich möchte mich jetzt nicht auf die Wittgenstein‘sche<br />
riefeindlichen Klima Wiens eine begleitende Exis- „Abbildtheorie“ einlassen, aber zur Erinnerung<br />
tenz einzurichten.<br />
den 610. Absatz aus seinen „Philosophischen Un-<br />
Ausgangspunkt Mitte der 1950er-Jahre war, um tersuchungen“ zitieren: „Beschreib das Aroma<br />
auch das noch zu erwähnen, dass ich von meinen des Kaffees! Warum geht es nicht? Fehlen uns die<br />
Freunden der „wiener gruppe“ die Meinung über- Worte? Und wofür fehlen sie uns? Woher aber der<br />
nommen habe, dass Sprache ohnehin unfähig sei, Gedanke, es müsse doch eine Beschreibung mög-<br />
irgendeine Form von Wirklichkeit zu erreichen lich sein? Ist dir so eine Beschreibung je abgegan-<br />
oder gar abzubilden, jedoch könne sie eine eigegen? Hast du versucht, das Aroma zu beschreiben,<br />
ne entwickeln. Offenbar verwechselten wir Wirk- und ist es dir gelungen?“<br />
lichkeit mit Wahrnehmung von Wirklichkeit, und, Der Hoffnungslosigkeit des Unterfangens steht aber<br />
jedenfalls ich, hatte sicher Wittgenstein missver- die Tatsache gegenüber, dass unentwegt über Archistanden,<br />
was zu einem präziseren, aber gleichzeitektur geschrieben wird. Es geschieht trotz der bestig<br />
lockeren Umgang mit Sprache an sich führte. seren Einsicht, dass ein Text seinen Gegenstand nie<br />
Ihre Verwendung und Profanierung <strong>als</strong> „Material“ erreichen kann. Ja, der erfahrene Schreiber macht<br />
hatte zu ungeahnten Abenteuern geführt. Ohne sogar die unangenehme Entdeckung, dass mit dem<br />
diesen Irrtum wären wohl keine Montagen, Dia- Umfang der sprachlichen Auseinandersetzung der<br />
lektgedichte, keine konkrete, visuelle Poesie oder Text immer mehr Eigenleben und Eigendynamik<br />
Lautgedichte entstanden. Die Verachtung der be- bekommt, sodass der Gegenstand sich immer mehr<br />
schreibenden Literatur – der Irrtum lag vielleicht von der Beschreibung entfernt und auch für den<br />
schon darin zu glauben, dass es eine ausschließ- Rezipienten immer unerreichbarer wird.<br />
6 5|11<br />
Verbindlichkeit von Mitteilungen<br />
Architektur ist <strong>als</strong>o eine Sache, und das Schreiben<br />
darüber eine andere. Von Interesse kann nur der<br />
Grad, die Intensität, sein, wie stark ein Medium zu<br />
einem anderen eine Beziehung herzustellen vermag,<br />
wieweit es gelingt, nachvollziehbare Aussagen<br />
zu machen. Und eine Frage ist nicht zuletzt,<br />
welche Aussagen überhaupt gemacht werden können.<br />
Adolf Loos hat die Behauptung aufgestellt, eine Architektur<br />
sei erst dann vollendet, wenn man ein<br />
Bauwerk über das Telefon, <strong>als</strong>o ohne Zeichnung,<br />
bestellen könne. Das heißt, es gibt nicht nur das<br />
Problem der Annäherung von Sprache an Architektur,<br />
sondern auch das von Architektur an die<br />
Sprache. Vollkommenheit bedeutet hier Übersetzbarkeit,<br />
oder besser: Mitteilbarkeit in einem anderen<br />
Medium.<br />
Eingeschlossen in diese Forderung ist aber ebenso<br />
der Wunsch nach Verbindlichkeit der Mitteilung,<br />
nach stabilen Verhältnissen zwischen Form<br />
und Bedeutung, wodurch die Kommunikation<br />
über ein anderes Vehikel, eben die Sprache, möglich<br />
wird. Dass dieser Zustand in der Architektur<br />
heute weniger denn je erreicht ist, erzeugt das eigentliche<br />
Thema unserer Frage. Ich möchte aber<br />
gleich hinzufügen, dass unser Dilemma jenen gesellschaftlichen<br />
Verhältnissen, die einen solchen<br />
sprachlichen Konsens ermöglichten oder erzwängen,<br />
vorzuziehen ist. Ende dieser jugendlich überzogenen<br />
Behauptungen.<br />
Inzwischen sind <strong>als</strong> Buße für diese saloppen Feststellungen<br />
drei Wienbände erschienen, die nichts<br />
anderes machen, <strong>als</strong> gegen diese behaupteten Unmöglichkeiten<br />
zu verstoßen – eine Frage <strong>als</strong>o, die<br />
nur mit Hilfe eines besonders pfiffigen Psychotherapeuten<br />
beantwortet werden könnte.<br />
Noch eine andere Erfahrung aus den frühen<br />
1950er-Jahren, der Zeit, in der nicht nur der Existenzialismus,<br />
sondern auch noch der französische<br />
Surrealismus unsere Hirne beschäftigte: Ein müder<br />
Abglanz in der Person eines Jean Cocteau erhellte<br />
noch den bereits sich verdunkelnden<br />
„Strohkoffer“. In dieser Zeit wurde noch die Stadt<br />
zu Fuß ergangen, mit sogenannten „Fremdgängen“<br />
– ein Begriff Heimito von Doderers –, mit<br />
distanziertem Blick und unersättlicher Neugier.
Dam<strong>als</strong> gab es auch das Modewort gfäud. Alles Interesse<br />
galt dem Gfäuden, ob Personen, Lokalen,<br />
Orten oder Gegenständen. Ich habe den surrealen<br />
Hintergrund dieses Worts nie ganz begriffen. Für<br />
mich handelte es sich um eine Mischung von verfault<br />
und verfehlt. Wir waren permanent auf der<br />
Suche nach „Gfäudem“. H. C. Artmann war ein<br />
Spezialist für gfäude Orte in der Stadt. Unorte, die<br />
einmal Stadt waren oder erst, meist an der Peripherie,<br />
werden sollten. Brachen, die warteten und<br />
noch keine Zukunft hatten. Die bemalten Holz-<br />
tafeln der Ruine eines verlassenen Ringelspiels<br />
lieferten sogar die Bilder für den Buchdeckel von<br />
„med ana schwoazzn dintn“. Mir wurde erst viel<br />
später klar, dass dies nicht nur Exkursionen ins<br />
Sonderliche, Abgründige einer Stadt waren, sondern<br />
auch Wanderungen ins Unbeschreibbare.<br />
Die Beschreibung wurde durch das Atmosphärische,<br />
eben die Poesie, ersetzt.<br />
Beschreibung und Zweifel<br />
In diesem Vorspann stecken viele Fragen, die ich<br />
nie gestellt habe und sicher nie beantworten<br />
könnte. Ich probiere es zuerst mit einer vermutlich<br />
sehr alten Behauptung: Der perfekte Gegenstand<br />
ist der unbeschriebene Gegenstand. Jede<br />
Beschreibung nimmt dem Gegenstand etwas weg<br />
beziehungsweise erreicht ihn nur <strong>als</strong> Fragment.<br />
Und, paradox genug, umgekehrt: Die Beschreibung<br />
deckt den Gegenstand teilweise oder schließlich<br />
ganz zu. Die totale Beschreibung, so es sie<br />
überhaupt gibt, bringt den Gegenstand zum verschwinden.<br />
Die Beschreibung nimmt dem Gegenstand<br />
<strong>als</strong>o nicht nur etwas weg, sondern fügt auch<br />
etwas hinzu. Die Wahrnehmung und der Vorgang<br />
der Beschreibung schaffen einen neuen Gegenstand,<br />
eben den beschriebenen Gegenstand, in<br />
dem sich der ursprüngliche, der wirkliche, versteckt<br />
oder verflüchtigt hat.<br />
Die Beschreibung ist nicht die eigentliche Funktion<br />
der Sprache. Die Sprachen entwickelten sich im<br />
Umgang mit der sogenannten Wirklichkeit. Man<br />
brauchte Namen für die Dinge, um darüber reden<br />
zu können. Voraussetzung jeder Kommunikation<br />
war die Kenntnis der gleichen Dinge, die gleichen<br />
Erfahrungen mit ihnen, der gleiche Wissensstand.<br />
Die sinnlichen Grunderfahrungen wie Licht und<br />
Finsternis, Wärme und Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit,<br />
Hunger und Durst oder Farben musste<br />
man nicht beschreiben. Das darüber Reden setzte<br />
erst ab einer zweiten Ebene ein: die Differenzierung<br />
durch Vergleich, Abweichungen, et cetera.<br />
„Beschreib mir das Aroma des Kaffees“: Diese<br />
Aufforderung ist vielleicht eine Falle. Jeder, der einen<br />
Kaffee getrunken hat – vorausgesetzt es war<br />
einer –, kennt das Aroma. Die Sprache darüber<br />
beginnt erst bei den Kaffeekennern, bei den Händ-<br />
Paul-WatzlaWick-EhrEnring dEr ÄrztEkammEr für WiEn 2011<br />
lern und Röstern. Die Sprache wird erst aktiv in<br />
der Differenzierung, in der Feststellung von Unterschieden,<br />
Qualitäten, Preisen. Oder in den verschiedenen<br />
Formen der Verarbeitung und der<br />
Aufbereitung. Eine Kaffeehauskultur entwickelt<br />
ihre eigene Sprache, und diese verlangt nicht die<br />
Beschreibung des Aromas des Kaffees an sich.<br />
Ich gehöre, nach Otto Antonia Graf, zu den Wiener<br />
Diapositivisten. Ich vermute, dass die Fotografie<br />
mehr über sich selbst aussagt <strong>als</strong> über den abgebildeten<br />
Gegenstand. Trotzdem vermag sie andererseits,<br />
in Sekundenschnelle visuell viel mehr<br />
und anderes zu vermitteln, <strong>als</strong> die Sprache. Die<br />
Sprache ist ein langsames, zeitraubendes Medi-<br />
um. Eine besondere Qualität der Vermittlung entsteht<br />
dann, wenn derjenige, der über einen Gegenstand,<br />
oder ein Gebäude, spricht, zusätzlich<br />
Fotos verwendet, die er selbst gemacht, <strong>als</strong>o schon<br />
mit einer bestimmten Absicht fotografiert hat. Der<br />
Diapositivist erzeugt schon eine fokussierte, präparierte<br />
Wirklichkeit, besser: eine selektive Wahrnehmung<br />
von Wirklichkeit, die im Kommentar<br />
durch das Medium der Sprache ergänzt wird. Man<br />
könnte auch von einer besonderen Informations-<br />
oder Kommunikationsstrategie sprechen, nach<br />
Wittgenstein wäre das dann eine Kombination von<br />
Vorzeigen und Sprechen, von visueller Wirklichkeit<br />
und Kommentar.<br />
Thomas Bernhard, den ich nicht gern zitiere, hat<br />
einmal behauptet, dass man alles, was man sieht,<br />
nicht beschreiben muss. Das klingt plausibel, ist<br />
aber ein Irrtum. Denn nicht alles Sichtbare wird<br />
gesehen. Und eine Beschreibung kann ein Instrument<br />
des sichtbar Machens sein, ein Zwang zum<br />
genauen Hinschauen. Ich glaube, Goethe hat einmal<br />
behauptet, „man sieht nur, was man weiß“.<br />
Damit kann man leben.<br />
Vom Schreiben über Architektur<br />
Was heißt überhaupt beschreiben? Was ist beschreibbar?<br />
Wird Beschreibung nicht überbewertet?<br />
Ich hege den Verdacht, dass eine gute Beschreibung<br />
auch ohne Beschreibung auskommt. Da ich<br />
kein Philosoph bin, kann ich hier passen. Aber<br />
ich erlaube mir daran herumzunörgeln. Können<br />
nicht gerade die Voraussetzungen für eine Beschreibung<br />
nicht beschrieben werden, sozusagen<br />
die Grundprodukte – elementare Sinneswahrnehmungen<br />
wie Geruch, Temperatur, Licht, Farben,<br />
Feuchtigkeit, Aggregatzustände, et cetera?<br />
Karl Valentins „dreißig Zentimeter gelb“ bringt<br />
Friedrich Achleitner: Am 14. März 2011 hielt der österreichische Architekturexperte, Schriftsteller und Polyhistor<br />
im Rahmen der „Wiener Vorlesungen“ im Kuppelsaal der Technischen Universität in Wien einen viel beachteten<br />
Vortrag zum Thema „Von der Unmöglichkeit, über Architektur zu schreiben?“<br />
mit drei Worten das Problem auf den Punkt. Es<br />
geht vermutlich gar nicht um die Beschreibung<br />
des Unbeschreibbaren. Über Architektur zu<br />
schreiben heißt nicht, Architektur zu beschreiben,<br />
man schreibt eben über, und das betrifft<br />
nicht nur das Sichtbare.<br />
Ich konnte einmal bei einer kleinen Auftragsarbeit<br />
eine interessante Entdeckung machen: Die<br />
Berliner Heimito-von-Doderer-Gesellschaft bat<br />
mich, über die Strudlhofstiege, genauer, über ihr<br />
Vorkommen im Roman, einen Vortrag zu halten.<br />
Man hat mir sogar, mit Hilfe der segensreichen<br />
Computer-Suchprogramme, alle Seiten des Textes<br />
gemailt, auf denen das Wort Strudlhofstiege vorkommt.<br />
Meine Überraschung war groß, die Stiege<br />
wurde an keiner Stelle wirklich beschrieben, sie<br />
kam nur <strong>als</strong> Hintergrund oder Bühne für Begegnungen<br />
der Figuren vor, und wenn Details beschrieben<br />
oder erwähnt wurden, dann beiläufig<br />
oder sogar f<strong>als</strong>ch.<br />
Doderer setzte voraus, dass man die Stiege kennt<br />
oder sie aufsucht. Ich wage hier eine boshafte Unterstellung:<br />
Der Baumeistersohn Doderer war<br />
7
Paul-WatzlaWick-EhrEnring dEr ÄrztEkammEr für WiEn 2011<br />
nicht nur Historiker, sondern ein gar nicht so unbedeutender<br />
Stadtforscher. Er wusste auch, dass<br />
die Strudlhofstiege gar kein besonderes Bauwerk<br />
ist, das einen Romantitel verdiente. Aber der Name<br />
garantierte eine gewisse Aufmerksamkeit. Strudl<br />
ist ein mehrfach kodierter, mit Wien verbundener<br />
Begriff, wenn auch der Namensgeber ein Tiroler<br />
Maler und Bildhauer aus der Leopoldinischen Zeit<br />
war. Also war die Rolle der Stiege eine literarische,<br />
sicher keine architektonische.<br />
An anderen Stellen des Romans gibt es Bemerkungen<br />
zu Wien, die Doderer nicht nur <strong>als</strong> einen<br />
„Fremdgänger“ mit den Augen eines Entdeckers<br />
ausweisen, sondern eben <strong>als</strong> intimen Kenner der<br />
Topografie und Geschichte der Stadt. Zitat: „Mary<br />
war beim Teetisch gesessen, den Blick draußen in<br />
der kaum beginnenden Dämmerung eines Nachsommerabends.<br />
Man sah hier eine Gasse entlang<br />
und dann über den Donaukanal (der kein Kanal<br />
ist, sondern ein erheblicher, breiter und tiefer,<br />
rasch fließender Teil des Stromes).“<br />
In diesem Halbsatz ist ein Wiener Trauma verpackt,<br />
dass seit der großen Donauregulierung<br />
1873 angeblich Wien nicht mehr an der Donau<br />
liegt, sondern eben an einem Kanal. Dabei handelt<br />
es sich nur um ein Problem der Benennung, der<br />
semantischen Kodierung. Hätte man den „erheblichen,<br />
breiten und tiefen, rasch fließenden Teil<br />
des Stromes“ nicht Kanal, sondern von Anfang an<br />
Innere Donau genannt, wären die Wiener nicht<br />
dem Irrtum aufgesessen, dass ihre Stadt nicht<br />
mehr an der Donau liegt.<br />
Weil es so schön ist, noch ein anderes Beispiel<br />
von Doderer, das uns von der Beschreibung wegführt.<br />
Zitat: „Ohne weiteres ist klar, daß die K.‘sche<br />
Wohnung denselben Grundriss haben mußte, wie<br />
die darunter liegende Siebenschein‘sche: alle<br />
Räume lagen in einer Achse – vier große und ein<br />
kleiner Raum, was keinen üblen Prospekt abgab<br />
–, bis auf das besonders ausgedehnte Schlafzimmer<br />
(bei Siebenscheins Gesellschaftsraum) und<br />
ein Kabinett von bescheidenen Maßen (unten des<br />
Doktors Arbeitszimmer). Die K.‘sche Wohnung<br />
war <strong>als</strong>o sehr groß ... denn unten hatte der Doktor<br />
Siebenschein ja auch sein Rechtsanwaltsbüro<br />
samt Wartezimmer untergebracht.“<br />
Hier beschreibt Doderer keinen Ort, sondern<br />
skizziert ein System, ja eine ganze Soziologie der<br />
gehobenen Gründerzeitwohnung, das Thema der<br />
Variabilität und Multifunktionalität, das Generationen<br />
von Architekten zu komplizierten theoretischen<br />
Abhandlungen verführt hat und das etwa<br />
ein Adolf Behne <strong>als</strong> rationalistisches Konzept gegenüber<br />
einem funktionalistischen – das die Form<br />
der Räume an Funktionen bindet – bevorzugte.<br />
Das Ganze wird in ein paar Sätzen, mit zwei Familiennamen<br />
und einigen Nutzungen, abgehandelt<br />
8 5|11<br />
und, wie es zumindest erscheint, erschöpfend.<br />
Die scharfe Analyse hüllt sich in das Kleid einer<br />
biederen Feststellung, der Erzähler ist ein verkappter<br />
Wissender, er ist Fremdgänger im System<br />
Stadt, der durch Distanz, den Blick von außen, zur<br />
Kenntnis einer Sache vorgedrungen ist.<br />
Ehrenrettung der Beschreibung?<br />
Es gibt im Zusammenhang mit Bauen und Architektur<br />
eine Form der Beschreibung, die einigen<br />
Anspruch auf Wirklichkeitsnähe hat: Das ist die<br />
Ausschreibung, <strong>als</strong>o eine Beschreibung aller Leistungen,<br />
die mit der Herstellung eines Bauwerks zu<br />
tun haben und die auch schließlich die Grundlage<br />
für die Kalkulation, <strong>als</strong>o für die Kosten der Herstellung,<br />
bilden. Gerade aber diese an kaum überbietbarer<br />
Perfektion grenzende Form der Beschreibung<br />
hat am allerwenigsten mit Architektur,<br />
der kulturellen oder gar künstlerischen Bedeutung<br />
eines Bauwerks zu tun; schon gar nichts mit<br />
ästhetischer Wirkung, Atmosphäre, Aura oder<br />
kultureller Positionierung.<br />
Diese Art technischer Perfektion schließt alle anderen<br />
Eigenschaften aus. Das ist der Punkt, an dem<br />
sich die Beschreibung selbst desavouiert. Hier unterliegt<br />
sie einem eindeutigen, gefesselten Interesse,<br />
einem Zweck, um eine in diesem Zusammenhang<br />
immer noch beliebte Vokabel zu verwenden.<br />
Sie bemerken: Der Begriff der Beschreibung beginnt<br />
sich aufzulösen. In Zusammenhang mit Architektur<br />
muss das Sehbare sichtbar gemacht<br />
werden. Das schafft die Beschreibung allein – und<br />
sei sie noch so genau – nie.<br />
Um die Verwirrung noch perfekter zu machen, ein<br />
paar willkürliche Behauptungen, Vermutungen in<br />
wilder Reihenfolge:<br />
Jede Beschreibung ist ein Schöpfungsakt, sicher<br />
ein fragwürdiger, fehlerhafter, unvollständiger,<br />
vielfach in die Irre führender, aber ein Schöpfungsakt.<br />
Der Gegenstand entsteht neu erst in der Beschreibung.<br />
Selbstbewusste Schöpfer, vor allem Künstler, sehen<br />
in dem verhängnisvollen Wort, zumindest seit<br />
der Romantik, eine Art Teilnahme an der Schöpfung,<br />
Gottnähe, und für die Kritiker reicht der<br />
Papst.<br />
Beschreibungen sind <strong>als</strong>o individuelle Leistungen.<br />
Ihnen liegt ein fokussiertes Interesse zugrunde,<br />
die sogenannte selektive Wahrnehmung. Es ist<br />
einfach ein Unterschied, ob ein Bauer, Jäger, Wilderer,<br />
Förster, Holzhändler, Geigenbauer oder ein<br />
romantischer Maler einen Wald beurteilen. Jeder<br />
sieht etwas anderes.<br />
Ich könnte mir vorstellen, dass Paul Watzlawick<br />
eine Versuchsreihe mit diesem „selektiven Blick“<br />
gemacht hätte – vielleicht hat er sie sogar –, dass<br />
er verschiedene Versuchspersonen mit unterschiedlichem<br />
Blick durch eine Stadt gehen und<br />
ihre Eindrücke beschreiben ließ. Soweit ich mich<br />
erinnere, hat 1960 Kevin Lynch Versuche in dieser<br />
Richtung im Zusammenhang mit architektonischer<br />
Stadtwahrnehmung gemacht. Vermutlich waren<br />
die Versuchspersonen Architekturstudenten, jedenfalls<br />
auf Bilder, Zeichen, ästhetische Wahrnehmung<br />
fokussierte Personen. Interessant wären<br />
aber Obdachlose, Polizisten, Einbrecher, Touristen,<br />
Rauchfangkehrer, Gourmets, Straßenkehrer,<br />
et cetera. Daraus könnte man vermutlich auch<br />
schließen, dass auf Beschreibungen nur im Besonderen,<br />
aber nicht im Allgemeinen, ein Verlass ist.<br />
Das heißt, dass jede einzelne mit anderen Interessen<br />
in Konflikt geraten muss. Anders gesagt: Jede<br />
Beschreibung schafft nur jeweils einen ganz kleinen<br />
Ausschnitt von wahrnehmbarer Wirklichkeit<br />
und bedarf der einfühlenden Nachsicht.<br />
Ich muss jetzt zugeben, dass ich mich in den unzähligen<br />
Möglichkeiten der Beschreibung verheddert<br />
habe. Der Titel des Vortrags lautet aber „Von<br />
der Unmöglichkeit, über Architektur zu schreiben?“<br />
Als Frage eine sogenannte No-na-Behauptung:<br />
Jeder (jede) kann über Architektur schreiben,<br />
aber ...?<br />
Zusätzlich ist mir die lebenslange Beschäftigung<br />
mit Objekten auf den Kopf gefallen. Architektur,<br />
auch das ist eine Binsenwahrheit, besteht ja nicht<br />
nur aus Objekten. Ja, es gab eine Zeit, da hat man<br />
nur mehr von soziologischen Fragen, urbanen Zusammenhängen,<br />
Strukturen, Typologien und Zeichen<br />
gesprochen – wichtige Erweiterungen der<br />
Beobachtungsfelder. Man kann sich darüber verständigen,<br />
dass die beste, ja einzige, Architekturwahrnehmung<br />
die unmittelbare Anschauung ist.<br />
Dieses Anschauen, ja Erleben, mit allen Sinnen<br />
muss aber mit Informationen genährt und unterstützt<br />
werden. Deshalb sind die leersten, fadesten,<br />
unbefriedigendsten und unnötigsten Architekturtexte<br />
ausschließliche Beschreibungen.<br />
Paul Watzlawick verweist auf Bertrand Russel, der<br />
daran erinnert, dass ein Fehler der Wissenschaft<br />
darin liege, „zwei Sprachen zu vermengen, die<br />
streng voneinander getrennt sein müssten. Nämlich<br />
die Sprache, die sich auf Objekte bezieht, und<br />
die, die sich auf Beziehungen bezieht“.<br />
Wahrscheinlich kann man im Hinblick auf Architektur<br />
diese beiden Sprachen überhaupt nicht trennen.<br />
Das Schlamassel entsteht <strong>als</strong>o im Gemenge.<br />
Wirklichkeit – ein paar Zwischenrufe<br />
Ich neige dazu, Wirklichkeit – unabhängig von<br />
unseren subjektiven Wahrnehmungen, die ja die<br />
eigentlich interessanteren sind – <strong>als</strong> real anzuerkennen.<br />
Wenn ein Philosoph gegen einen Baum<br />
fährt, kann man vermutlich nachher nicht mehr
��������������<br />
�����������������������������������<br />
�������������<br />
�����������<br />
���������<br />
�������������������<br />
��������������������<br />
�����������<br />
��������������<br />
�������������������<br />
�������������<br />
�����������������������<br />
�����������������������������������<br />
�����������������������������������������<br />
�������<br />
������<br />
������<br />
���<br />
���<br />
����� ������������<br />
���������� ������ ���������<br />
�<br />
�<br />
�����������������������������������<br />
�������������������<br />
��������������������<br />
�������������������<br />
�����������������������<br />
�����������������������������������<br />
��������������������������<br />
������������������<br />
���������<br />
��������<br />
������������������<br />
����<br />
���������������<br />
�������<br />
��������������������������������<br />
������������������������<br />
���������������������������������������<br />
�����������<br />
������������������������������������������������<br />
�����������������������<br />
�����������������������������������������<br />
������������������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������<br />
������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������<br />
�������������������<br />
�������������������������������<br />
��������������������������������<br />
���������������������������������������
Paul-WatzlaWick-EhrEnring dEr ÄrztEkammEr für WiEn 2011<br />
mit ihm über den Begriff Wirklichkeit diskutieren.<br />
Die Leugnung der Existenz eines Baumes<br />
kann ein akademisches Vergnügen, aber auch ein<br />
letaler Irrtum sein. Vielleicht sollte man den Begriff<br />
Wirklichkeit nur im Plural verwenden.<br />
Wenn ich in den bewundernswerten Biografien<br />
von Rüdiger Safranski lese, dass zu Schillers<br />
Zeiten in Weimar noch die Schweine in den Straßen<br />
der Stadt herumliefen, dann ist das nicht nur<br />
ein zwar unscheinbarer, aber einprägsamer, Hinweis<br />
– den man sich sicher merkt –, sondern ich<br />
kann daraus schließen, dass die Straßen noch<br />
nicht gepflastert waren, dass es noch keine Kanalisation<br />
gab, dass in den Häusern noch Ställe wa-<br />
ren und von den Bürgern zumindest teilweise<br />
noch Landwirtschaft betrieben wurde, und dass es<br />
im Olymp der deutschen Klassik ganz schön gestunken<br />
hat. Dieses einprägsame Bild entsteht<br />
nicht durch Beschreibung, sondern durch eine<br />
einfache Bemerkung.<br />
Beispiel skrupelloser Ambivalenz in der Architektur<br />
ist etwa die Rolle der antiken Säulen, die in den verschiedensten<br />
Situationen (Beziehungen), ob <strong>als</strong><br />
Symbole für Kultur oder Macht, für imperialen<br />
Prunk oder <strong>als</strong> Erinnerung an Quellen der Demokratie,<br />
<strong>als</strong> Zeichen für Revolutionen, <strong>als</strong> Versatzstücke<br />
für das Pathos faschistischer oder stalinistischer<br />
Symbole, oder schlicht <strong>als</strong> Präsentation handwerklicher<br />
Kunst, gebraucht oder missbraucht<br />
wurden. Ihre Omnipräsenz ist vielleicht auch daraus<br />
zu erklären, dass die Säule ein unverzichtbares<br />
konstruktives Element darstellt, das nur durch den<br />
Wandel an Form und Bedeutung erträglich blieb.<br />
Die Säule war immer, austriazistisch gesagt, gut<br />
herzunehmen. Hans Hollein hat diesen Sachverhalt<br />
in der „Strada Novissima“ an der Biennale von<br />
Venedig 1980 eindrucksvoll demonstriert.<br />
10 5|11<br />
Faktor Zeit<br />
In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich,<br />
auch noch auf den Faktor Zeit hinzuweisen. Die<br />
Moderne begann, abgesehen von der Entdeckung<br />
und Darstellung des perspektivischen Raums in<br />
der Renaissance, spätestens mit dem Historismus,<br />
mit der Industrialisierung, der zeitlichen Organisation<br />
der Arbeitswelt, es entstand – so vermute<br />
ich – zumindest praktisch ein linearer Zeitbegriff.<br />
Die Kunst- und Architekturforschung teilte die<br />
Vergangenheit in eine lineare Abfolge von Stilen,<br />
ihre Beschreibung, Katalogisierung, faktische Benennung,<br />
Unterscheidbarkeit, und verankerte sie<br />
in einer Chronologie der Geschichte.<br />
Der Paul-Watzlawick-Ehrenring der Ärztekammer für Wien wird zukünftig zweijährlich an herausragende, interdisziplinär<br />
forschende Wissenschafter verliehen: Friedrich Achleitner mit dem Laudator und Organisator der<br />
„Wiener Vorlesungen“, Hubert-Christian Ehalt (li.) und Ärztekammerpräsident Walter Dorner<br />
Es war sicher ein schöpferischer Irrtum der<br />
Historisten, dass man durch Stilwahl auch Geschichte<br />
rekonstruieren oder bewahren könne.<br />
In Wahrheit hat man in jedem qualitätsvollen<br />
Werk nur die Distanz zur Geschichte veranschaulicht<br />
und dokumentiert. So wurde das Feld<br />
der scheinbaren Nachahmung zum Spielfeld<br />
großartiger Raum- und Formerfindungen, wenn<br />
man etwa an Theophil Hansens Mittelachse im<br />
Wiener Parlament denkt, die zwei „Häuser“ –<br />
das Abgeordneten- und das Herrenhaus – trennt<br />
und verbindet in einem. Hansen hat den klassischen<br />
„Griechischen Stil“ nicht nur <strong>als</strong> Verweis<br />
auf die „Wiege der Demokratie“ benutzt,<br />
sondern weil er der Meinung war, dass kein anderer<br />
Stil Ordnung und Freiheit in einem so anschaulich<br />
darzustellen vermag. Und weil er<br />
durch praktische Rekonstruktionen in Athen so<br />
intime Kenntnisse der Antike erwarb, konnte er<br />
mit diesem Vokabular ziemlich frei, fast in<br />
einem musikalischen Sinn, fantasieren oder improvisieren,<br />
was wiederum die Basis für Erfindungen<br />
schuf. Ich glaube, der architektonische<br />
Erfindungsreichtum des Historismus ist noch<br />
nicht wirklich entdeckt.<br />
Grundlage oder Herausforderung zur Erfindung<br />
im Zusammenhang mit vergangenen Stilen war<br />
aber auch das Auftreten neuer Bauaufgaben, zukunftsweisender<br />
Raumkonzepte, neuer Gebäudetypologien<br />
wie Museen, Parlamente, Bahnhöfe,<br />
Bäder, Hotels, Schulen, Verkehrsanlagen oder<br />
Produktionsstätten. Die oft frei erfundenen historisierenden<br />
Kleider machten in Verbindung mit<br />
den konstruktiven Großleistungen erst richtig ihre<br />
Distanz zur Geschichte, <strong>als</strong>o den Fortschritt, sichtbar.<br />
Und noch ein Thema, das für den Schreibenden<br />
schweißtreibend sein kann: Jedes architektonische<br />
Objekt durchwandert seine Existenz mit<br />
zwei Geschwindigkeiten: Die langsame ist die<br />
substanzielle, die physikalische und chemische.<br />
Die Natur nimmt die Gebilde der Menschen sehr<br />
langsam zurück, der Verfall hängt von den Materialien,<br />
den klimatischen Bedingungen, der Abnutzung<br />
ab: Der Neubau ist auf jeden Fall ein Fremdkörper<br />
– eine gleißende Holzscheune in der Landschaft<br />
kann schon ein Ärgernis sein –, die Patina,<br />
die sichtbare Alterung, ist zunächst ein Schutz,<br />
suggeriert Bestand, ja ästhetischen Widerstand,<br />
die langsame Verrottung eine Auflösung <strong>als</strong> Naturprozess.<br />
Die zweite Geschwindigkeit der Veränderung entsteht<br />
durch die Wahrnehmung des Menschen. Ich<br />
erinnere an die allgemeine Bewertungskurve: zunächst<br />
Ablehnung; das Neue wird immer <strong>als</strong> existenzbedrohend<br />
empfunden. Generationskonflikt,<br />
„Vatermord“, Ignoranz – am gefährdetsten sind<br />
Bauten so um die 30 bis 50 Jahre –, Wiederentdeckung<br />
der Großelterngeneration, Dokumentation<br />
ihrer Werke, Beschreibung, Einordnung, Benennung<br />
und schließlich Verklärung oder gar Heiligsprechung.<br />
Meine Generation hat diese Metamorphosen<br />
vom Historismus und Jugendstil, Moderne<br />
der Zwischenkriegszeit – einschließlich Faschismus<br />
und Stalinismus – bis hin zur Architektur der<br />
1950- und 1960er-Jahre erlebt. In diesem Kontext<br />
betrachtet sind Architekturtexte Teil dieses Prozesses,<br />
oft auch in der Rolle <strong>als</strong> Beschleuniger.<br />
Zwei Ästhetiken<br />
Dabei könnte man von zwei Ästhetiken sprechen,<br />
einer Konzeptionsästhetik und einer Perzeptionsästhetik.<br />
Die Konzeptionsästhetik ist untrennbar<br />
mit einem Zeitpunkt der Geschichte verknüpft. Sie<br />
spiegelt die Kultur des Machens, des Erfindens,<br />
den künstlerischen Diskurs und den Geist in einer<br />
einmaligen gesellschaftlichen Situation wider. Allerdings<br />
steht dieser „Augenblick“ nicht still, er<br />
treibt im „Strom der Zeit“, bleibt allen kommenden<br />
Wahrnehmungen ausgesetzt und wird schließ-
lich ein Element der Perzeptions- und Rezeptionsästhetik.<br />
Diese Wahrnehmungsästhetiken sind von<br />
Anfang an subjektiv, personenbezogen, ein Element<br />
der Vielfalt, der Bewegung, des Wandels, der<br />
Halbfertigkeit und der permanenten Offenheit.<br />
Man könnte auch sagen: Wahrheiten auf Wanderschaft.<br />
Die Konzeptionsästhetik strebt nach Dauer, ewige<br />
Gültigkeit, gibt sich <strong>als</strong> absolut sicher, ist unduldsam<br />
und ausschließend. Künstlerurteile über<br />
Zeitgenossen grenzen oft ans Absurde. Ich bin<br />
der Meinung, dass diese Ausschließlichkeit im<br />
sogenannten Entwurfs- und Produktionsprozess<br />
notwendig ist. Ein Künstler, der alles toleriert,<br />
wird schwer überleben. Die sogenannte Rezeptionsästhetik<br />
wäre demnach eine der Bewertung,<br />
Einordnung, die in einem dauernden Prozess der<br />
Aufarbeitung entsteht und dementsprechend<br />
wandelbar ist. Ich dresche vermutlich auch hier<br />
altes Stroh, aber der Schreibende wird mit diesen<br />
unbequemen Gesetzen seine irritierenden Erfahrungen<br />
machen.<br />
Aber warum und für wen schreibt man denn eigentlich?<br />
Die Frage nach dem Warum ist schwer oder gar<br />
nicht zu beantworten. Dass gescheiterte Künstler,<br />
Studienabbrecher, et cetera Kritiker werden, daran<br />
mag etwas Wahres sein und soll auch in anderen<br />
Branchen vorkommen. Wenn sich Kunsthistoriker<br />
ins Baugewerbe verirren, kann es für die Architekturbetrachtung<br />
von Vorteil sein, weil sie<br />
meist ein größeres Beobachtungsfeld ins Spiel<br />
bringen, vorausgesetzt, dass sie Pläne lesen lernen,<br />
ihren Augen mehr vertrauen <strong>als</strong> den abrufbaren<br />
Texten. Man muss leider auch zur Kenntnis<br />
nehmen, dass die sogenannte „Intertextualität“<br />
mit entsprechendem Fachjargon immer mehr zunimmt,<br />
konkret, die Zunft widmet sich immer<br />
mehr den Texten statt den Kunstwerken/Bauten, ja<br />
sie schreiben immer mehr über Gebautes, das sie<br />
nie gesehen haben. Texte zu zitieren, die man nie<br />
gelesen hat, soll auch schon vorkommen.<br />
Ja, für wen schreibt man eigentlich?<br />
Ich behaupte einmal, sicher nicht für Architekten.<br />
Ich kenne unter den Architekten sehr wenige wirkliche<br />
Leser, und wenn, dann sind es meistens solche,<br />
die wenig oder nichts zum Bauen haben. Zugegeben,<br />
das Entwerfen und Bauen ist ein selbstausbeuterischer<br />
Beruf, der keine oder wenige Freiräume<br />
kennt. Der Architekt lebt in einer<br />
substanzraubenden Wirklichkeit. Ihm muss kein<br />
Schreiberling erklären, wie es in der Bauwirklichkeit<br />
zugeht. Wozu soll dann eigentlich ein Architekt<br />
lesen? Seine Erfahrungen holt er sich von Gebautem<br />
oder vom publizierten Gebauten. Zeitschriften sind<br />
Artikelfriedhöfe, die kaum gelesen werden. Das Interesse<br />
liegt entweder an Information über Neues<br />
Paul-WatzlaWick-EhrEnring dEr ÄrztEkammEr für WiEn 2011<br />
oder darin, ob man vorkommt, wie umfangreich<br />
die Texte und wie groß die Abbildungen sind. Das<br />
ist die Wirklichkeit. Die wahrnehmbare natürlich.<br />
Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz in den<br />
1960er-Jahren der Zentralvereinigung der ArchitektInnen<br />
Österreichs, bei der die Wiener Zeitungen<br />
aufgefordert wurden, mehr, oder überhaupt,<br />
über Architektur zu schreiben. Dabei sagte<br />
ein Sprecher des Vereins: „Was ihr schreibt’s, ist<br />
wurscht, Hauptsache vü.“<br />
Drei Medien der Architekturdarstellung<br />
Ich möchte noch kurz von der Beziehung von drei<br />
Medien in der Architekturdarstellung oder, vielleicht<br />
besser, ihren Erscheinungsformen sprechen:<br />
von der Zeichnung, eingeschlossen Skizze,<br />
Entwurf, Plan, Modell und bildliche Darstellungen),<br />
dem Bau selbst – der sich von der Idealform<br />
weit entfernen kann – und schließlich dem Kommentar,<br />
<strong>als</strong>o die gesamten verbalen Erscheinungsformen<br />
der kulturellen Präsenz der Architektur.<br />
Keines dieser Medien allein kann die Architektur<br />
in ihrer Gesamtheit darstellen und damit sichern.<br />
Sie werden sich darüber wundern, dass ich auch<br />
den Bau selbst, die eigentliche „Architektur“, nur<br />
zu ihren Erscheinungsformen zähle. Der Bau ist,<br />
was das Überleben betrifft, das sensibelste und<br />
vergänglichste Element dieser Trinität von Darstellung,<br />
Sprache und materialer Verwirklichung.<br />
Die bildliche Darstellung, in welcher Form immer,<br />
dokumentiert meist eine Idealform, die im Bau<br />
nie, oder ganz selten, erreicht wird. Der Bau<br />
selbst kann sich von seiner Idealform weit entfernen,<br />
sie nie erreichen, und beginnt in seiner substanziellen<br />
Existenz durch Nutzung, Alterung, Veränderung,<br />
et cetera einen Verfallsprozess. Der<br />
Kommentar kann sich durch historische Positionierung,<br />
Beschreibung, ästhetische „Verortung“<br />
an der Erhaltung der ursprünglichen Vollkommenheit<br />
beteiligen und so auch den Artefakt konservieren.<br />
Überleben kann eigentlich die Architektur<br />
nur in der Verbindung all dieser drei Komponenten.<br />
Architektur ist <strong>als</strong>o nicht nur das Gebaute<br />
allein, und am wenigsten überdauert sie in<br />
ihrer physischen Existenz.<br />
Noch einmal zurück zu den Objekten und zu einer<br />
scheinbar solideren Ebene der Sprache: Seit jeher<br />
ist der Handwerker ein Vertrauter des Architekten,<br />
und, wie gesagt, <strong>als</strong> Beispiel gut herzunehmen.<br />
Sein Denken ist schlicht, seine Kenntnisse sind solide,<br />
seine Sprache ist unbestechlich und an eine<br />
Dingwelt gebunden. Ob wir ihn heute noch <strong>als</strong> einen<br />
Garanten für eine sprachlich heile Welt ansehen<br />
können, ist eine Frage. Ich benutze noch einmal<br />
seine Figur des Tischlers, und sei es für einen<br />
Abgesang. Denn seine Sprache ist die einer fast<br />
vergangenen Arbeitswelt.<br />
Wahrscheinlich wird die Zahl der Tischler, die<br />
noch Tische bauen können, immer geringer. Sie<br />
reden, wenn sie es überhaupt nötig haben, über<br />
Holzarten oder Holzverbindungen, über die Stabilisierung<br />
der Bauteile, es geht auch um Werkzeuge.<br />
Aber vermutlich müssen Tischler über<br />
Tische gar nicht reden. Kritisch wird es erst, wenn<br />
sich andere Interessen einmischen. Wenn Architekten<br />
oder Designer dem Tischler erklären, was<br />
ein Tisch ist oder sein soll. Kein Tischler würde in<br />
seinem Milieu einen Tisch in Frage stellen, es sei<br />
denn, er ist ein Kunsttischler, Restaurator oder gar<br />
ein Fälscher. Jede Kultur, jede Gesellschaft hatte<br />
ihre Tische – und die Tischler, die sie verdiente.<br />
Die Sprache wird erst herausgefordert, wenn es<br />
um Mängel oder Missverständnisse geht.<br />
Ich lese zum Schluss einen kurzen Text aus dem<br />
Band „und oder oder und“ in der Sprache eines<br />
Tischlers. Ich hoffe, damit meinen H<strong>als</strong> aus den<br />
philosophischen Schlingen des Paul Watzlawicks<br />
zu ziehen:<br />
„federieren<br />
der tisch wackelt nicht, herr architekt, der federiert.<br />
damit war nicht nur klargestellt, wer der<br />
meister und fachmann war, sondern dass sich in<br />
einem einfachen tisch zwei weltzustände manifestieren<br />
können: der einfache mechanische defekt,<br />
den ein tischler nie zulassen würde, und ein<br />
höheres prinzip der baukunst, das elastische<br />
schwingen, das prinzip des nachgebens und des<br />
sanften widerstands, das im schwingen des<br />
schilfs oder der weide, ja in jedem baum unübertroffen<br />
zum ausdruck kommt: eben das federieren.<br />
ich war beschämt und wollte möglichst<br />
elegant den h<strong>als</strong> aus der schlinge ziehen: aber<br />
meister, sagte ich ein wenig überheblich, das wackeln<br />
ist doch an sich nichts schlechtes, schließlich<br />
gibt es den berühmten wackelstein, und<br />
deswegen fahren sogar die wiener ins waldviertel.<br />
ja, antwortete er prompt, aber sicher keine<br />
tischler.“ �<br />
Zur Person<br />
Friedrich Achleitner war fünf Jahre lang in Zusammenarbeit<br />
mit Johann Georg Gsteu <strong>als</strong> freischaffender<br />
Architekt tätig. Seit 1958 ist er freier<br />
Schriftsteller. Seine Werke, Montagen, Dialektgedichte,<br />
der „quadratroman“ und die später erschienenen<br />
Kurzprosatexte gehören zu den bedeutendsten<br />
der österreichischen Moderne. Friedrich<br />
Achleitner schloss Ende 2010 den Österreichischen<br />
Architekturführer mit den drei Bänden<br />
zu Wien ab, ein Opus magnum, das auf ungeteilte<br />
Bewunderung stieß.<br />
11
STUDIE<br />
Intern<br />
12 5|11<br />
aus den kurien und referaten<br />
Hohes Burn-out-Risiko bei Ärztinnen und Ärzten<br />
Dorner: „Das Ergebnis<br />
der Umfrage<br />
führt uns vor<br />
Augen, unter welchem<br />
Druck Ärztinnen<br />
und Ärzte<br />
tagtäglich stehen“<br />
Hofmann: „In anderen<br />
vergleichbaren<br />
Hochleistungsberufen<br />
liegt die Zahl<br />
der belasteten Personen<br />
deutlich<br />
niedriger“<br />
Daten und Fakten<br />
Eine aktuelle Studie belegt: <strong>Mehr</strong> <strong>als</strong> die Hälfte der österreichischen Ärzteschaft<br />
ist Burn-out-gefährdet. Die Ärztekammer ortet dringenden Handlungsbedarf.<br />
� Das Thema Burn-out beschäftigt seit Auswertung und damit eine valide Ein-<br />
einiger Zeit auch die Ärzteschaft – und schätzung des persönlichen Burn-outzwar<br />
<strong>als</strong> unmittelbar Betroffene. Die Gra- Risikos. Die anonymisierten Datensätze<br />
zer Universitätsklinik für Psychiatrie hat werden für wissenschaftliche Zwecke<br />
im Auftrag der Österreichischen Ärztekam- weiterverwendet.<br />
mer weltweit erstm<strong>als</strong> eine wissenschaft- „Nach kritischer Analyse konnten wir 6249<br />
liche Studie zu diesem Thema durchge- korrekte Datensätze auswerten; das entführt,<br />
welche die Basis für weiterführende spricht einer Teilnahmequote von 14,38<br />
Untersuchungen bilden wird.<br />
Prozent und ist hochrepräsentativ“, erläu-<br />
Das Projekt steht unter der Leitung von Peterte Studienleiter Hofmann.<br />
ter Hofmann und lief vorerst von Novem- In etwa 54 Prozent der Befragten befinden<br />
ber 2010 bis Februar 2011 unter Beteili- sich demnach in unterschiedlichen Phasen<br />
gung von österreichweit insgesamt 6249 des Burn-outs, der Großteil davon in der<br />
Ärztinnen und Ärzten. Das Ergebnis: Knapp eher harmlosen Phase 1. „Phase 1 zeichnet<br />
54 Prozent der Befragten befinden sich in sich durch emotionale Erschöpfung sowie<br />
unterschiedlichen Phasen des Burn-outs. die Unfähigkeit zur Entspannung aus und<br />
Es besteht <strong>als</strong>o Handlungsbedarf. Daher ist temporär“, so Hofmann. Dieses „täg-<br />
fordert Ärztekammerpräsident Walter Dorliche Burn-out“ sei aber durch entsprener<br />
Reformen im Gesundheitswesen, vor chende Regeneration rasch kompensier-<br />
allem auch bei den Spitälern, und ein bar und betreffe in erster Linie Frauen.<br />
Überdenken der kollegialen Führung, die Phase 2 ist geprägt durch ein Abstumpfen<br />
sich neben anderen Faktoren wie lange gegenüber privaten Interessen und Bezie-<br />
Dienstzeiten, Überstunden und Nachthungen, ebenso durch Hilflosigkeit und<br />
dienste <strong>als</strong> elementarer Stressfaktor erwei- körperliche Beschwerden. Diese Sympse.<br />
„Das Ergebnis der Umfrage führt uns tome verstärken sich in Phase 3 noch wei-<br />
vor Augen, unter welchem Druck Ärzter, in der von einer behandlungswürdigen<br />
tinnen und Ärzte tagtäglich stehen“, resü- Krankheit gesprochen werden muss.<br />
mierte Dorner am 14. März 2011 bei einer Ärztinnen und Ärzte seien überdurch-<br />
Pressekonferenz in Wien.<br />
schnittlich gefährdet, so Hofmann weiter:<br />
„In anderen vergleichbaren Hochleistungs-<br />
Drei Phasen<br />
berufen wie zum Beispiel bei Richtern,<br />
An der Studie konnten Ärztinnen und Wirtschaftstreibenden und Wirtschaftstreu-<br />
Ärzte online mit einem Passwort teilnehhändern liegt die Zahl der belasteten Permen.<br />
Jeder Teilnehmer erhielt dabei unsonen deutlich niedriger – nämlich bei<br />
mittelbar nach der Eingabe eine sofortige durchschnittlich ungefähr 40 Prozent.“<br />
n An der Studie beteiligten sich 6249 Ärztinnen und Ärzte, Teilnehmerquote: 14,48 Prozent<br />
n 54 Prozent der Befragten sind Burnoutgefährdet<br />
n Burn-out findet in drei Phasen statt:<br />
Phase 1: emotionale Erschöpfung, Unfähigkeit zur Entspannung – sogenanntes „tägliches Burnout“<br />
Phase 2: Abstumpfen gegenüber Interessen und Beziehungen, Hilflosigkeit, körperliche Beschwerden<br />
Phase 3: Symptome aus Phase 2 verstärken sich und werden behandlungsbedürftig<br />
n Besonders gefährdet: Spit<strong>als</strong>ärzte bis 47 Jahre; Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung zum Facharzt, Fachärzte,<br />
Turnusärzte; Singles ohne sozialen und emotionalen Rückhalt<br />
n Gründe für Burnout: überlange Dienstzeiten, Nachtdienste, überbordende Bürokratie und Administration,<br />
Personalmangel in den Spitälern, Journaldienste, hohe Patientenfrequenz, kollegiale Führung<br />
Jung, männlich – und gefährdet<br />
Besonders gefährdet sind männliche Spit<strong>als</strong>ärzte<br />
bis 47 Jahre, und hier wiederum<br />
vor allem jene, die sich in einer Ausbildung<br />
zum Facharzt befinden, sowie Turnus-<br />
und Fachärzte. Nachtdienste und Notarzttätigkeit<br />
lassen das Burn-out-Risiko<br />
weiter steigen. Auch Singles, denen der soziale<br />
und emotionale Rückhalt einer Partnerschaft<br />
beziehungsweise einer Familie<br />
fehlt, sind deutlich stärker gefährdet. Und:<br />
Wer bereits an einer Depression leidet,<br />
läuft Gefahr, zusätzlich ins Burn-out zu<br />
schlittern – und umgekehrt.<br />
„Dass speziell Spit<strong>als</strong>ärzte gefährdet sind,<br />
ist leider nicht weiter verwunderlich, im<br />
Gegenteil: Die Gründe für ihre Gefährdung<br />
liegen klar auf der Hand“, führte<br />
Dorner aus. Überlange Dienstzeiten,<br />
Nachtdienste, überbordende Bürokratie<br />
und Administration, die verbesserungswürdige<br />
Zusammenarbeit der einzelnen<br />
Berufsgruppen sowie Personalmangel<br />
würden der Spit<strong>als</strong>ärzteschaft schon seit<br />
Jahren das Leben schwer machen und<br />
seien <strong>als</strong> Hauptursachen für Burn-out zu<br />
sehen. Dorner: „Neben den beruflichen<br />
sind auch private Stressfaktoren zu berücksichtigen<br />
– jüngere Kolleginnen und<br />
Kollegen, die sich mitten in der Familienplanung<br />
befinden, sind einer doppelten<br />
Belastung ausgesetzt.“<br />
Unklare Führungsverantwortung<br />
Ein schwerwiegendes Problem sind ungeklärte<br />
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten<br />
in den Spitälern. Hier erweise<br />
sich die kollegiale Führung <strong>als</strong> „elementarer<br />
Stressfaktor“ für die Ärztinnen und<br />
Ärzte. Dorner: „Wir müssen die Führungsverantwortung<br />
im patientennahen Bereich<br />
überdenken und neu strukturieren. Die<br />
Ärztinnen und Ärzte sind in den Spitälern<br />
zunehmend mit dem Umstand konfrontiert,<br />
dass sie die Letztverantwortung etwa<br />
auch für den Pflegebereich übernehmen<br />
müssen. Das ist aus organisatorischer<br />
Sicht und aufgrund der konkreten Anforderungen<br />
an die Führung eines medizinischen<br />
Betriebs kontraproduktiv.“<br />
Es bedürfe daher einer umsichtigen Spit<strong>als</strong>reform,<br />
die das Hauptaugenmerk auf<br />
die im Spital tätigen Menschen lege anstatt<br />
auf die bloße Ökonomie. „Es sind nicht zu-
letzt Ökonomisierung, Rationalisierung<br />
und Effizienzsteigerung, die den aktuellen<br />
Zustand mitverschuldet haben“, betonte<br />
der Ärztechef. Oberflächliche Maßnahmen<br />
zur Entlastung der Betroffenen seien ausschließliche<br />
Kosmetik, die Streichung von<br />
Dienstposten und extreme Rationalisierungen<br />
würden die Problematik weiter verschärfen.<br />
Dorner: „Dienstposten zu eliminieren<br />
mag zwar in der Jahresbilanz gut<br />
aussehen, aber für die verbliebenen Ärztinnen<br />
und Ärzte bedeutet die Entlassung<br />
von Kolleginnen und Kollegen zusätzlichen<br />
Stress und ein wachsendes Arbeitspensum.<br />
Die Ärztekammer bringt für die belastenden<br />
Zustände in den Krankenhäusern<br />
seit Jahren Lösungsvorschläge zur Sprache,<br />
aber angesichts der aktuellen Pläne der<br />
Spit<strong>als</strong>reform scheint es, <strong>als</strong> seien unsere<br />
Forderungen bislang ungehört verhallt.“<br />
Um das Burn-out-Risiko der Spit<strong>als</strong>ärzteschaft<br />
nachhaltig zu senken, müsse ein<br />
Bündel an strukturellen Reformen umgesetzt<br />
werden, so der Ärztekammerpräsident.<br />
Dazu gehörten neue, flexible Arbeits-<br />
DIE NEUE<br />
zeitmodelle, spit<strong>als</strong>eigene Betreuungsplätze<br />
für Kinder und nicht zuletzt der Ausbau<br />
des niedergelassenen Bereichs. Auch die<br />
Führungsstrukturen in den Spitälern müssten<br />
angepasst werden: Die faktische Letztverantwortung<br />
der Ärzte im patientennahen<br />
Bereich müsse sich in den Führungsaufgaben<br />
klar niederschlagen und geregelt<br />
werden. Zur Entlastung der Spit<strong>als</strong>ärzteschaft<br />
von Administration und Dokumentation<br />
bedürfe es der flächendeckenden<br />
Installation von Administrationsassistenten;<br />
und schließlich dürfe die durchgehende<br />
Dienstzeit 25 Stunden nicht überschreiten.<br />
Präventionsprojekt geplant<br />
Doch auch im niedergelassenen Bereich<br />
ist Burn-out ein Thema. Speziell Journaldienste<br />
und Rufbereitschaft erweisen sich<br />
<strong>als</strong> Risikofaktoren, und auch hier ist man<br />
gegen überbordende Bürokratie und Dokumentation<br />
<strong>als</strong> Mitverursacher von<br />
Burn-out nicht gefeit. Von Journaldiensten<br />
sind vor allem Landordinationen be-<br />
KESTBEFREITE *<br />
Mit einer Laufzeit von 15 Jahren ***<br />
aus den kurien und referaten<br />
Intern<br />
troffen, deren gegenwärtige existenzielle<br />
Gefährdung man nicht hinnehmen dürfe,<br />
so Dorner.<br />
Die Ärztekammer plant zusätzlich ein Präventionsprojekt,<br />
das die nachhaltige Senkung<br />
des Burn-out-Risikos in den Niederlassungen<br />
zum Ziel hat. Federführend ist<br />
dabei Wolfgang Lalouschek von der Medizinischen<br />
Universität Wien. „Das Projekt<br />
soll über einen Zeitraum von eineinhalb<br />
Jahren zunächst in Wien stattfinden, regelmäßige<br />
Veranstaltungen wie Vorträge und<br />
Coachings sollen das Burn-out-Risiko reduzieren“,<br />
führte Lalouschek die Eckpunkte<br />
des Projekts aus. Als Belastungsfaktoren<br />
im niedergelassenen Bereich sieht er einerseits<br />
die hohe Patientenfrequenz, andererseits<br />
„die Gefahr der Vereinsamung“.<br />
Prävention müsse dabei breit angelegt werden,<br />
erklärte Lalouschek. In Workshops<br />
würden daher unter anderem (Ehe)Partner,<br />
aber auch Mitarbeiter der betroffenen Ärztinnen<br />
und Ärzte, einbezogen; ein weiterer<br />
Schwerpunkt liege auf der Kommunikation<br />
in schwierigen Situationen. �<br />
HYPO WOHNBAUANLEIHE<br />
Lalouschek: „Als<br />
Belastungsfaktoren<br />
im niedergelassenen<br />
Bereich sehe<br />
ich einerseits die<br />
hohe Patientenfrequenz,<br />
andererseits<br />
aber auch die Gefahr<br />
der Vereinsamung“<br />
Die vorliegende Publikation stellt eine unverbindliche Information für unsere Kunden über die betreffende Kapitalveranlagung dar. Es handelt sich nicht um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder<br />
eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes. Die enthaltenen Informationen können eine fachgerechte Beratung nicht ersetzen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und<br />
der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Der gebilligte Prospekt inklusive sämtlicher Nachträge zur „3,9 % p. a. Wandelschuldverschreibung NÖ 2011-2026/15, ISIN AT0000A0M-<br />
QY1“ steht den Interessenten in den Geschäftsstellen der HYPO NOE Landesbank bzw. auf deren Homepage, www.hyponoe.at (www.hypolandesbank.at/m029/at/de/content/Ueber_uns/emissionsprospekte.<br />
shtml), und auf der Homepage der Emittentin HYPO-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, www.hypo-wohnbaubank.at (www.hypo-wohnbaubank.at/boersenprospekt.htm), zur Verfügung. Diese Mitteilung wurde<br />
von der HYPO NOE Landesbank AG, Neugebäudeplatz 1, 3100 St. Pölten, erstellt. Stand: 21. 3. 2011<br />
* Steuervorteil: Für Privatanleger sind Kapitalerträge im Ausmaß bis zu 4 % des Nennbetrages von der Kapitalertragsteuer (KESt) befreit.<br />
** Bei einem fi ktiven Kaufkurs von 100 % beträgt die jährliche Rendite 3,9 % (ohne Steuervorteil lt. derzeit gültiger Rechtslage)<br />
***Laufzeit 1. 4. 2011 bis 31. 3. 2026, Tilgung: 1. 4. 2026 zum Nennwert, sofern nicht zuvor gewandelt wurde<br />
www.hyponoe.at<br />
Entspricht einer<br />
KESt-pfl ichtigen Veranlagung von<br />
5,2 % Zinsen p. a. **
UMBAU<br />
Intern<br />
doktorinwien: Als Kammeramts- und<br />
Finanzdirektor der Ärztekammer für Wien<br />
sind Sie beide hauptverantwortlich für<br />
den reibungslosen Ablauf sämtlicher Sanierungs-<br />
und Renovierungsmaßnahmen<br />
in der Ärztekammer. Was genau ist eigentlich<br />
geplant und warum gerade jetzt?<br />
Holzgruber: Es gibt zwei Hauptgründe<br />
für den Umbau. Einerseits müssen wir den<br />
modernen Sicherheitsanforderungen genügen,<br />
die uns von außen auferlegt werden.<br />
Dies betrifft vor allem den Lift, der<br />
nicht mehr den behördlichen Bestimmungen<br />
entspricht. Diese schreiben zwingend<br />
vor, dass zwischen Fahrkabine und Wand<br />
eine geschlossene Tür sein muss. Das ist<br />
derzeit nicht der Fall. Zusätzlich gibt es<br />
zahlreiche Auflagen des Arbeitsinspektorats.<br />
Und dann kam es in den letzten Jahren<br />
zu einem Art Sanierungsstau, der unter<br />
anderem die Heizanlage sowie die Fenster<br />
betrifft, die aus den 1960er- und 1970er-<br />
Jahren stammen.<br />
Hirtzi: Nach derzeitigem Stand müssen<br />
wir die Heizanlage sowie die EDV-Verkabelungen<br />
komplett erneuern. Die Heizung ist<br />
völlig veraltet, man kann nicht einmal die<br />
Raumtemperatur einstellen. Die Fenster<br />
werden teilweise erneuert, hier ist es<br />
14 5|11<br />
aus den kurien und referaten<br />
„In wenigen Monaten wird die Ärztekammer komplett renoviert sein“<br />
Kammeramtsdirektor Thomas Holzgruber und Finanzdirektor Franz Hirtzi<br />
über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Haus der Ärztekammer, das<br />
neue Veranstaltungszentrum in der Weihburggasse sowie die sich daraus ergebenden<br />
Vorteile für die Ärzteschaft.<br />
Holzgruber: „Alle Mitarbeiter sind in der Umbauphase ohne Unterbrechung<br />
per E-Mail erreichbar“<br />
schon in einigen Räumen zum Herausbrechen<br />
von Fenstern gekommen, die beinahe<br />
Besucher und Mitarbeiter verletzt haben.<br />
Bei einigen Fenstern können wir aber<br />
auch noch sanieren, was unterm Strich<br />
günstiger kommt. Auch die Böden sind<br />
nach teilweise mehr <strong>als</strong> 30-jähriger Benützung<br />
renovierungsbedürftig. Und schließlich<br />
müssen auch die sanitären Einrichtungen<br />
komplett erneuert werden. In manchen<br />
Zimmern war das Arbeiten nicht<br />
mehr möglich, da es je nach Wetterlage<br />
unerträglich nach Fäkalien gestunken hat.<br />
Zudem sind die Sanitäranlagen hygienisch<br />
teilweise absolut nicht mehr am Stand der<br />
Technik, was gerade für die Ärztekammer<br />
nicht akzeptabel ist.<br />
doktorinwien: Hat man hier zu lange<br />
gewartet?<br />
Holzgruber: Keineswegs. Aber in einem<br />
so großen Haus mit sieben Ebenen, in dem<br />
inklusive der Österreichischen Ärztekammer<br />
und der Zahnärztekammer ungefähr<br />
150 Personen arbeiten, kommt es mit den<br />
Jahren zu Abnützungserscheinungen, die<br />
nun einmal saniert werden müssen. Eigentlich<br />
bin ich froh darüber, dass jetzt<br />
vieles zusammenkommt, denn das gibt uns<br />
die Möglichkeit, neben den notwendigen<br />
Sanierungsmaßnahmen auch einige Neuerungen<br />
durchzuführen, die direkt den Servicecharakter<br />
des Hauses betreffen.<br />
doktorinwien: Und die wären?<br />
Holzgruber: In den letzten zehn bis 20<br />
Jahren wurden immer wieder kleine Adaptierungen<br />
durchgeführt, die zum Beispiel<br />
die Schaffung zusätzlicher Sitzungssäle betrafen.<br />
Das hat dazu geführt, dass – über<br />
das ganze Haus verteilt – Räume in unterschiedlichen<br />
Größen zu Besprechungszimmern<br />
umfunktioniert wurden. In der<br />
jeweiligen Situation hat das schon Sinn gemacht,<br />
denn es war notwendig, rasch und<br />
ohne großen finanziellen Aufwand entsprechenden<br />
Platz zu schaffen. Nun aber<br />
haben wir die Chance, auf einer Ebene<br />
sämtliche Sitzungssäle zusammenzufassen,<br />
mit all den damit verbundenen Vorteilen,<br />
nämlich höchstmögliche Flexibilität in den<br />
Raumgrößen sowie beste technische Ausstattung.<br />
Damit werden wir auch erreichen,<br />
dass wir viel mehr Veranstaltungen<br />
<strong>als</strong> bisher in der Ärztekammer belassen<br />
können. Denken Sie nur an die Vollversammlung<br />
mit ihren 100 Mandataren, die<br />
bislang immer auswärts stattfinden musste.<br />
Mit dem neuen Raumkonzept können<br />
wir die Vollversammlung wieder in die<br />
Ärztekammer holen, denn Sitzungen und<br />
andere Veranstaltungen mit 100 Teilnehmern<br />
und mehr werden dann kein Problem<br />
sein.<br />
doktorinwien: Wissen Sie schon, wie<br />
die Raumaufteilung nach der Gener<strong>als</strong>anierung<br />
ausschauen wird?<br />
Holzgruber: Im Erdgeschoss wird weiterhin<br />
das Ärzte-Info-Service mit der Standesführung<br />
sein, allerdings räumlich erweitert,<br />
da es unser Ziel ist, möglichst viele<br />
Aufgaben nicht mehr in den Büros darüber,<br />
sondern eben bereits im Ärzte-Info-Service<br />
erledigen zu lassen. Und auch die Telefonzentrale<br />
und ein Empfang sollen ins Erdgeschoss,<br />
damit jeder Arzt gleich zielgerichtet<br />
dorthin geleitet wird, wo er hinmöchte. Für<br />
den Arzt hat das den Vorteil, dass er zukünftig<br />
alles aus einer Hand erhält und nur<br />
in Ausnahmefällen im Haus weitergeleitet<br />
wird. Darüber, <strong>als</strong>o in der derzeitigen Unterteilung<br />
(um eine moderne Stockwerksbezeichnung<br />
zu bekommen, werden künftig<br />
die Stockwerke der Reihe nach nummeriert,<br />
die Unterteilung wird damit zum ersten<br />
Stock, Anm.), wird besagtes Veranstaltungszentrum<br />
etabliert. Die Kurie angestellte<br />
Ärzte bleibt im Mezzanin (künftig zweiter<br />
Stock, Anm.), die Kurie niedergelassene<br />
Ärzte kommt in den dritten Stock (künftig<br />
fünfter Stock, Anm.), wo auch die gesamte<br />
interne Verwaltung untergebracht ist, und<br />
im vierten Stock (künftig sechster Stock,<br />
Anm.) werden das Präsidium, das Kammeramt,<br />
die Stabsstelle Recht sowie der<br />
Bereich Medien und Fortbildung untergebracht<br />
sein. Die der Österreichischen Ärztekammer<br />
vorbehaltenen Räumlichkeiten<br />
im ersten und zweiten Stock (künftig dritter<br />
und vierter Stock, Anm.) sowie die<br />
Zahnärzte im Mezzanin bleiben von den Sanierungsmaßnahmen<br />
unberührt.
doktorinwien: Kann bei so umfassenden<br />
Umbaumaßnahmen überhaupt<br />
ein reibungsloser Betrieb während des<br />
Umbaus garantiert werden?<br />
Holzgruber: Ja, im Wesentlichen schon.<br />
Durch ein sehr gut durchdachtes Übersiedlungskonzept<br />
sollten alle Abteilungen<br />
weitgehend ungestört ihrer Arbeit nachgehen<br />
können. Natürlich sind wir uns<br />
dessen bewusst, dass die Abteilungen innerhalb<br />
kurzer Zeit teilweise zweimal<br />
komplett, das heißt mit sämtlichen Telefon-<br />
und EDV-Anschlüssen, im Haus übersiedeln<br />
müssen, zuerst einmal in das Ausweichquartier<br />
und danach in die endgültigen<br />
Räumlichkeiten. Alle EDV-Arbeiten,<br />
die sich durch die Umsiedlungen ergeben,<br />
werden durchgehend in den Abendstunden<br />
sowie an Wochenenden gemacht,<br />
sodass die Mitarbeiter während der<br />
Dienstzeiten ohne Unterbrechung per<br />
E-Mail erreichbar sind und auch auf<br />
alle notwendigen EDV-Systeme der Ärztekammer<br />
zurückgreifen können. Allerdings<br />
ist nach derzeitigem Stand nicht<br />
auszuschließen, dass es bei der telefonischen<br />
Erreichbarkeit der Mitarbeiter<br />
möglicherweise zu Wartezeiten kommt.<br />
Wir appellieren daher schon jetzt an<br />
alle Ärztinnen und Ärzte, in den nächsten<br />
Wochen und Monaten vermehrt auf die<br />
Kontaktaufnahme via E-Mail zurückzugreifen.<br />
doktorinwien: Wurden die Sanierungsmaßnahmen<br />
ausgeschrieben?<br />
Hirtzi: Selbstverständlich wurden alle<br />
Maßnahmen vergaberechtlich korrekt<br />
ausgeschrieben und auch gemäß den hierfür<br />
geltenden Richtlinien vergeben. Der<br />
gesamte Vergabeprozess wurde auch von<br />
einem Rechtsanwalt und dem Architekten<br />
mitbetreut.<br />
doktorinwien: Müssen während der<br />
Umbauphase für Sitzungen externe Räume<br />
angemietet werden?<br />
Holzgruber: Um Kosten zu sparen, werden<br />
wir das Ausweichen in externe Räume<br />
so gering wie möglich halten. Bis voraussichtlich<br />
Ende Juni 2011 bleiben die Sitzungssäle<br />
in der Unterteilung von den Umbauarbeiten<br />
sowieso unbenommen und<br />
stehen daher nach wie vor für Sitzungen<br />
zur Verfügung, auch wenn es teilweise zu<br />
Staub- und Lärmbelästigungen kommen<br />
kann. Auch der Sitzungssaal im 4. Stock<br />
kann die meiste Zeit durchgehend belegt<br />
werden. Das neue Veranstaltungszentrum<br />
in der Unterteilung wird dann im Juli und<br />
August fertiggestellt. Das sind jene Monate,<br />
wo erfahrungsgemäß die wenigsten Sitzungen<br />
und Veranstaltungen in der Ärztekammer<br />
stattfinden.<br />
Hirtzi: Sie dürfen hier auch nicht vergessen,<br />
dass das neue Veranstaltungszentrum,<br />
wie schon gesagt, zukünftig mehr<br />
Personen Platz bieten wird und nach dem<br />
neuesten Stand der Technik ausgestattet<br />
sein wird. Es wird daher möglich sein,<br />
zukünftig Sitzungen mit vielen Teilnehmern,<br />
die in den letzten Jahren stets ausgelagert<br />
werden mussten, wieder in die<br />
Weihburggasse zu holen. Sollte es <strong>als</strong>o zu<br />
geringen Kosten für die Anmietung von<br />
Räumlichkeiten während der Umbauphase<br />
kommen, wären diese <strong>Mehr</strong>kosten<br />
sehr rasch durch geringere Anmietkosten<br />
nach erfolgter Sanierung wettgemacht.<br />
Insgesamt bringt der Umbau daher in<br />
diesem Bereich eine nachweisbare Ersparnis<br />
von jährlich ungefähr 50.000<br />
Euro. Auf 20 Jahre hochgerechnet, <strong>als</strong>o<br />
die Zeitspanne, ab der wahrscheinlich<br />
wieder eine Sanierung notwendig wird,<br />
beträgt die Ersparnis eine Million Euro.<br />
doktorinwien: Fürchten Sie jetzt nicht,<br />
dass der Vorwurf laut werden könnte,<br />
die Ärztekämmerer richteten sich eine<br />
„goldene Burg“ ein?<br />
Hirtzi: Der Vorwurf wird sicher kommen,<br />
ist aber bei nüchterner Betrachtung<br />
nicht haltbar. Erstens sind viele der Sanierungsmaßnahmen<br />
einfach notwendig. Jeder,<br />
der ein Haus besitzt, weiß, dass man<br />
regelmäßig investieren muss. Man kann ja<br />
schlecht Mitarbeiter vor undichten Fenstern<br />
oder in Räumen arbeiten lassen, die<br />
nicht einmal über einen Thermostat zur<br />
Einstellung der Zimmerwärme verfügen.<br />
Oder der Aufzug: Soll sich eine Körperschaft<br />
öffentlichen Rechts über bestehende<br />
Bestimmungen hinwegsetzen, ganz abgesehen<br />
einmal vom Sicherheitsaspekt?<br />
Alles andere, wie beispielsweise Neuverkabelungen<br />
im Bereich der EDV oder ergonomisch<br />
eingerichtete Arbeitsplätze,<br />
können nebenbei mitlaufen. Das kommt<br />
uns wesentlich günstiger, <strong>als</strong> wenn wir das<br />
immer stückchenweise in den kommenden<br />
Jahren machen würden, was schon<br />
aufgrund der Auflagen des Arbeitsinspektorats<br />
unvermeidlich geworden wäre.<br />
aus den kurien und referaten<br />
Intern<br />
doktorinwien: Muss für den Umbau<br />
eine eigene Umlage eingehoben werden?<br />
Holzgruber: Nein. Durch die vorausschauende<br />
Finanzpolitik in den letzten Jahren<br />
ist es uns gelungen, entsprechende<br />
Rücklagen zu schaffen, da klar war, dass<br />
irgendwann eine Gener<strong>als</strong>anierung kommen<br />
muss. Daraus werden sämtliche Unkosten<br />
für den Umbau und die Sanierung<br />
getragen. Dazu kommt, dass wir in den<br />
Folgejahren durch die Umwegrentabilität<br />
einiges von den jetzt getätigten Ausgaben<br />
wieder hereinbringen werden. Ich denke<br />
hier zum Beispiel an Ersparnisse, die sich<br />
bei den Energieaufwendungen ergeben<br />
werden, aber auch durch den Wegfall der<br />
Anmietung von Räumlichkeiten. Zusätzlich<br />
Hirtzi: „Zukünftig wird es möglich sein, Sitzungen mit vielen Teilnehmern<br />
wieder in die Weihburggasse zu holen“<br />
hatten wir in den letzten Jahren immer<br />
stärker steigende Instandhaltungskosten,<br />
die nach dem Umbau wegfallen. Mit dem<br />
geplanten modernen Veranstaltungszentrum<br />
haben wir die Möglichkeit, Räume in<br />
der sitzungsfreien Zeit in unterschiedlicher<br />
Größe an externe Veranstalter, zum<br />
Beispiel Ärztegesellschaften oder Pharmafirmen,<br />
gegen Entgelt zu vermieten. So<br />
ganz nebenbei entsteht damit auch eine<br />
stärkere Bindung aller Ärztinnen und Ärzte<br />
an das Haus, und auch das ist ja kein so<br />
schlechter Nebeneffekt. Zudem wird die<br />
Immobilie in der Weihburggasse 10-12,<br />
die ja der Wiener Ärztekammer gehört, in<br />
ihrem Wert deutllich gehoben, wenn man<br />
entsprechend moderne Technik im Haus<br />
installiert. �<br />
Interview: Hans-Peter Petutschnig.<br />
15
NIEDERLASSUNG<br />
Intern<br />
16 5|11<br />
aus den kurien und referaten<br />
Valorisierung der Honorarsätze bei Ordinationsvertretungen<br />
Frohner: „Die Ordinationsvertretungshonorare<br />
sind mittlerweile<br />
eine allgemein<br />
akzeptierte<br />
Richtschnur für die<br />
Kollegenschaft“<br />
UNIVERSITÄTEN<br />
Klaus Frohner, Referent für Sonderklassehonorare der Ärztekammer für Wien, leistungen, et cetera. Hier wird deutlich,<br />
über den Beschluss der beiden Kurien hinsichtlich der Valorisierung der Hono- dass in den nächsten Jahren auch die<br />
rarsätze für Ordinationsvertretungen im Bereich der Ärztekammer für Wien. Vertretungshonorare den neuesten Entwicklungen<br />
mit Gruppenpraxen, Ärzte-<br />
� Kaum jemand erinnert sich noch an der damaligen Situation, wie Ordinati- GmbHs und Spezialisierungsgraden an-<br />
die durchaus heftige Polemik zwischen den onsgrößen, Krankenscheinwert, Zusatzgepasst werden müssen. Die Kurien<br />
beiden Kurien im Jahr<br />
und Fachgruppen<br />
2003, <strong>als</strong> die Richtli- Vertretungshonorare<br />
werden diese Aufganien<br />
für Ordinationsvertretungshonorare<br />
erstm<strong>als</strong> für Wien er-<br />
Fach<br />
Stundensatz<br />
2011<br />
Tagsatz<br />
von bis<br />
be engagiert wahrnehmen.<br />
Die empfohlenen<br />
arbeitet wurden. Heu- Allgemeinmedizin € 44,00 € 180,00 € 250,00 Stundensätze sind der<br />
te sind sie eine allgemein<br />
akzeptierte<br />
Richtschnur vor allem<br />
für neu ins „Vertre-<br />
Augenheilkunde und Optometrie<br />
Chirurgie<br />
Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
€ 66,00<br />
€ 72,00<br />
€ 72,00<br />
€ 300,00<br />
nebenstehenden Tabelle<br />
zu entnehmen<br />
beziehungsweise auf<br />
der Homepage der<br />
tungs-Business“ein- Dermatologie € 72,00<br />
Ärztekammer (www.<br />
tretende Kolleginnen Innere Medizin € 77,00<br />
aekwien.at � Downund<br />
Kollegen, aber<br />
auch für niedergelassene<br />
Ärztinnen und<br />
Ärzte, die einen Pra-<br />
Kinder und Jugendheilkunde<br />
HNO<br />
Psychiatrie<br />
€ 44,00<br />
€ 66,00<br />
€ 50,00<br />
loadcenter � Niedergelassene<br />
Ärzte �<br />
Honorarempfehlungen<br />
für Ordinationsxisvertreter<br />
ganz akut Orthopädie und orthopädische Chirurgie € 77,00<br />
vertretungen)abruf- oder auch für eine<br />
Dauervertretung su-<br />
Physikalische Medizin und<br />
allgemeine Rehabilitation<br />
€ 66,00<br />
bar. Gleichzeitig wurde<br />
beschlossen, die<br />
chen.<br />
Radiologie € 110,00<br />
jährliche Inflations-<br />
Die Höhe der Stun- Urologie € 66,00<br />
anpassung ab dem<br />
densätze reflektiert<br />
heute noch die Realität<br />
und die Usancen<br />
Medizinische und chemische Labordiagnostik € 110,00<br />
Jahr 2011 automatischdurchzuführen.<br />
�<br />
Ärztekammer unterstützt Bundesregierung bei Medizinerquote<br />
Andreas: „Auch in<br />
Wien muss der direkte<br />
Einstieg in<br />
eine Facharztausbildung<br />
nach dem<br />
Medizinstudium<br />
möglich sein“<br />
Die Ärztekammer unterstützt die Bemühungen der Bundesregierung zur<br />
Verlängerung der Quotenregelung an den medizinischen Universitäten<br />
Österreichs. Dies sei laut Ärztekammer eine von mehreren notwendigen<br />
Maßnahmen, um einen zukünftigen Ärztemangel zu verhindern.<br />
� Ohne Quoten an den Medizinuniversi- läuterte, gebe es zurzeit „das ungeschrietäten<br />
würde Österreich von ausländischen bene Gesetz, wonach junge Medizinabsol-<br />
Studenten überschwemmt, die dann zum venten nicht direkt in eine<br />
überwiegenden Teil in ihre Heimat zurück- Facharztausbildung einsteigen können,<br />
kehren und schwere Probleme in der ös- sondern den Umweg über eine Ausbildung<br />
terreichischen Gesundheitsversorgung zur Allgemeinmedizin – den Turnus – ge-<br />
hinterließen, sagte Ärztekammerpräsident hen müssen“. Das verlängere die prak-<br />
Walter Dorner in einer Presseaussendung. tische Ärzteausbildung auf mindestens<br />
Großen Veränderungsbedarf sieht die Ärz- neun Jahre. Andreas: „Das führt zur Situatekammer<br />
in diesem Zusammenhang aber tion, dass gerade in Wien die Wartezeiten<br />
bei der postpromotionellen praktischen auf Ausbildungsstellen in den Spitälern<br />
Ausbildung. Wie auch der Referent für ar- nach wie vor drei Jahre betragen.“ Daher<br />
beitslose Ärzte und Jungmediziner der Ärz- würden immer mehr Jungärzte nach<br />
tekammer für Wien, Martin Andreas, er- Deutschland auswandern, die sehr attrak-<br />
tive Stellen in den Krankenhäusern anböten.<br />
„Um einem hausgemachten Ärztemangel<br />
in Österreich entgegenzuarbeiten, ist<br />
es dringend erforderlich, etwa auch in<br />
Wien den direkten Einstieg in eine Facharztausbildung<br />
nach dem Medizinstudium<br />
zu ermöglichen“, forderte Andreas.<br />
Er sieht generell die Gefahr, dass immer<br />
weniger junge Ärztinnen und Ärzte bereit<br />
sein würden, sich auf Dauer in Österreich<br />
in einer Ordination niederzulassen oder<br />
im Spital zu arbeiten. Andreas: „Wir bilden<br />
zwar genügend Mediziner aus, doch wollen<br />
diese zunehmend nicht mehr unter<br />
den gegebenen Bedingungen <strong>als</strong> Ärzte in<br />
Österreich arbeiten.“ Anforderungsprofil,<br />
Verantwortung und Einsatz entsprächen<br />
nicht mehr den Lebenserwartungen der<br />
jungen Menschen. �
Ausschreibung von Gruppenpraxisstellen<br />
Die Wiener § 2Krankenversicherungsträger, die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter<br />
(BVA), die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB), die Sozialversicherungsanstalt<br />
der gewerblichen Wirtschaft (SVA) sowie die Krankenfürsorgeanstalt Wien<br />
(KFA Wien) schreiben im Einvernehmen mit der Ärztekammer für Wien gemäß § 8 ff des<br />
Gruppenpraxengesamtvertrags vom 1. Jänner 2004 folgende Gruppenpraxisstellen aus:<br />
Neugründung:<br />
Fach: Innere Medizin<br />
Ort: Wien 23. (Dr. Gerald Schnürer)<br />
Neugründung ( . Gruppenpraxisanteil):<br />
Fach: Orthopädie und orthopädische Chirurgie<br />
Ort: Wien 19. (Dr. Karl Michael Riedl)<br />
Gesellschafterwechsel:<br />
Fach: Orthopädie und orthopädische Chirurgie<br />
Ort: Wien 22. (Dr. Kelaridis & Partner Fachärzte für Orthopädie und orthopädische<br />
Chirurgie OG)<br />
Bewerbungen sind bis zum 1. Mai 2011 zu richten an:<br />
Sekretariat der Sektion Ärzte für Allgemeinmedizin: Stefanie Köppl<br />
Tel.: 515 01/1222 DW, EMail: koeppl@aekwien.at<br />
Sekretariat der Sektion Fachärzte: Angela Rupprecht<br />
Tel.: 515 01/1259 DW, EMail: rupprecht@aekwien.at<br />
1010 Wien, Weihburggasse 1012<br />
Die Ärztekammer für Wien und die Wiener Gebietskrankenkasse treffen gemeinsam die<br />
Entscheidung über die Besetzung der ausgeschriebenen Vertragsarztstellen.<br />
Die ausschreibenden Institutionen weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß den Bestimmungen<br />
des Gruppenpraxengesamtvertrags die ausgeschriebene(n)<br />
Gruppenpraxisstelle(n) nur an jene(n) Bewerber vergeben werden kann (können), der (die)<br />
bei der Punktebewertung nach den geltenden Richtlinien eine Quote von mindestens 80<br />
Prozent der Punkte des bestgereihten Bewerbers erreicht (erreichen).<br />
Praxisgründungskredit<br />
Die Wiener Ärztekammer ist seit Herbst 2010 Gesellschafter bei der Bank für Ärzte und Freie<br />
Berufe. Ein Vorteil für die Mitglieder ist dabei eine engere Kooperation zwischen der Ärztekammer<br />
und der Ärztebank. Teil dieser Kooperation ist ein spezieller Praxisgründungskredit.<br />
Beziehen können diesen Kredit alle ordentlichen Mitglieder der Ärztekammer für Wien für<br />
Praxisgründungen und übernahmen bis zu einer maximalen Höhe von 75.000 Euro. Die<br />
Auszahlung erfolgt frühestens drei Monate vor Eröffnung der Ordination und bis zu drei Jahre<br />
danach. Die Laufzeit beträgt maximal zehn Jahre, davon längstens ein Jahr tilgungsfrei.<br />
Als Basis für den Sollzinssatz gilt der DreiMonatsEuribor zuzüglich eines Aufschlags von<br />
0,75 Prozent p.a. Der Aufschlag ist für die gesamte Laufzeit gleichbleibend. Die Anpassung<br />
erfolgt vierteljährlich. Als Anpassungsstichtage werden der 31. März, 30. Juni, 30.<br />
September und 31. Dezember herangezogen.<br />
Service: Interessierte Kolleginnen und Kollegen können sich direkt an die Bank für Ärzte<br />
und Freie Berufe, 1090 Wien, Kolingasse 4, Tel.: 521 07-0, E-Mail: info@aerztebank.at,<br />
wenden.<br />
aus den kurien und referaten<br />
Intern<br />
Ausschreibung von Vertragsarztstellen<br />
Die Wiener § 2Krankenversicherungsträger schreiben gemäß<br />
§ 4 Abs. 1 des Gesamtvertrags gemeinsam mit der Versicherungsanstalt<br />
öffentlich Bediensteter (BVA), der Versicherungsanstalt<br />
für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB), der Sozialversicherungsanstalt<br />
der gewerblichen Wirtschaft (SVA) sowie der Krankenfürsorgeanstalt<br />
der Stadt Wien (KFA Wien) im Einvernehmen<br />
mit der Ärztekammer für Wien folgende Vertragsarztstellen aus:<br />
Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin<br />
Berufssitz in Wien 6. (Stelle nach MR Dr. Werner Peter Zapotoczky)<br />
Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin<br />
Berufssitz in Wien 10. (Stelle nach Dr. Gudrun Herzel)<br />
Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin<br />
Berufssitz in Wien 10. (Stelle nach MR Dr. Ahmed Maher<br />
Abouelenin)<br />
Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin<br />
Berufssitz in Wien 11. (Stelle nach OMR Dr. Chistian Kohnen<br />
Zülzer)<br />
Facharzt/Fachärztin für Chirurgie<br />
Berufssitz in Wien 11. (Stelle nach Dr. Leopoldine Wrede)<br />
Facharzt/Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten<br />
Berufssitz in Wien 22. (Stelle nach Dr. Eva Maria Stiehl)<br />
Bewerbungen sind bis zum 1. Mai 2011 zu richten an:<br />
Sekretariat der Sektion Ärzte für Allgemeinmedizin: Stefanie Köppl<br />
Tel.: 515 01/1222 DW, EMail: koeppl@aekwien.at<br />
Sekretariat der Sektion Fachärzte: Angela Rupprecht<br />
Tel.: 515 01/1259 DW, EMail: rupprecht@aekwien.at<br />
1010 Wien, Weihburggasse 1012<br />
Die Ärztekammer für Wien und die Sozialversicherungsträger treffen<br />
gemeinsam die Entscheidung über die Besetzung der ausgeschriebenen<br />
Vertragsarztstellen. Die Besetzung der Vertragsarztstellen<br />
erfolgt frühestens nach rechtskräftiger Beendigung des Einzelvertragsverhältnisses<br />
des Planstellenvorgängers beziehungsweise<br />
bei neuen Planstellen zum ehest möglichen Zeitpunkt.<br />
Die Ärztekammer für Wien erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass<br />
gemäß den Vereinbarungen mit der Wiener Gebietskrankenkasse<br />
eine Tätigkeit <strong>als</strong> angestellte(r) Ärztin (Arzt) bei Abschluss eines<br />
Einzelvertrags mit der Wiener Gebietskrankenkasse nicht weitergeführt<br />
werden kann und zu beenden ist. Ausgenommen sind<br />
nur konsiliarärztliche und belegärztliche Tätigkeiten.<br />
Unterlagen zur Anrechnung von Punkten können ausschließlich<br />
im Rahmen einer Bewerbung eingereicht werden. Das Ranking<br />
der ausgeschriebenen Kassenplanstellen wird nach ungefähr<br />
zwei bis drei Monaten nach Ablauf der Bewerbungsfrist auf der<br />
Homepage der Ärztekammer für Wien (www.aekwien.at) veröffentlicht.<br />
17
Intern<br />
18 5|11<br />
mitteilungen aus dem kammerbereich<br />
Ernennungen<br />
Dr. Cihan Ay, Turnusarzt Privatdozent<br />
Prim. Dr. Harald Peter David, Psychiatrie und Neurologie Medizinalrat<br />
Dr. Benjamin Halpern, Radiologie Privatdozent<br />
Dr. HansJoachim Heindl, Allgemeinmedizin Medizinalrat<br />
Prim. Dr. Günther Mostbeck, Innere Medizin Medizinalrat<br />
Dr. Silvia Seligo-Schneider, Haut und Geschlechtskrankheiten Ärztliche Leiterin im Aestomed Laserambulatorium<br />
Dr. Andreas Stummer, Allgemeinmedizin Medizinalrat<br />
Dr. Volker Wacheck, Innere Medizin Privatdozent<br />
DDr. Arno Wutzl, Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie Privatdozent<br />
MR Dr. Huschang Yamuti, Allgemeinmedizin Obermedizinalrat<br />
Praxiseröffnungen<br />
Allgemeinmedizin<br />
Dr. Erich Altenburger 1090, Kinderspitalgasse 1/2/4 **<br />
Dr. Fariba Bekzadeh Marzbaly 1220, Am Heidjöchl 14/69/2<br />
Univ.Prof. Dr. Markus Dettke 1050, Margaretenplatz 2<br />
Dr. Sevgi Emir 1110, AlbinKirschPlatz 2/5/5<br />
Dr. Annemarie Fischer 1130, Hietzinger Kai 141<br />
Dr. Bamdad Heydari 1010, Laurenzerberg 2 **<br />
Dr. Josef Kahrom 1220, Tietzestraße 2/1/2<br />
Dr. Margarete Karimi 1190, Heiligenstädter Straße 4648<br />
Dr. Ahmad Keilani 1100, Favoritenstraße 206<br />
Dr. Ida Kubik 1220, RudolfHausnerGasse 13<br />
Dr. Nura Medjedovic 1120, Am Schöpfwerk 29/6/4<br />
Dr. Beata Saria 1130, OskarJaschaGasse 82<br />
Dr. Sonja Schnürl-Hofmeister 1180, Gentzgasse 135/11<br />
Dr. Alma Tanjic-Ibrahimovic 1040, Resselgasse 5<br />
Dr. Michaela Tscheitschonig-Richling 1020, AlexanderPochPlatz 2/2<br />
Priv.Doz. Dr. Arschang Valipour 1190, Heiligenstädter Straße 4648<br />
Augenheilkunde und Optometrie<br />
Priv.Doz. Dr. Matthias Bolz 1010, Krugerstraße 6<br />
Dr.med.univ. Dr.med. Christian Kozich 1010, Rotenturmstraße 11<br />
Dr. Agnes Wienerroither 1110, Simmeringer Hauptstraße<br />
3440/4/2<br />
Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin<br />
Univ.Prof. Dr. Markus Dettke 1050, Margaretenplatz 2<br />
Chirurgie<br />
Priv.Doz. Dr. Chris<strong>top</strong>h Neumayer 1010, Börsegasse 10<br />
Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Dr. Maximilian Franz 1190, Heiligenstädter Straße 5763<br />
Dr. Margarete Karimi 1190, Heiligenstädter Straße 4648<br />
Haut- und Geschlechtskrankheiten<br />
Dr. Babak Adib 1090, Pelikangasse 15/1. Stock<br />
Univ.Prof. Dr. Rainer Kunstfeld 1190, Scheimpfluggasse 3/DG **<br />
Innere Medizin<br />
Univ.Doz. Dr. Alexander Geppert 1060, Mariahilfer Straße 49/1/3/19<br />
Dr. Mohammad Kazem Mirfakhrai 1230, AntonBaumgartnerStraße 44<br />
Kinder- und Jugendheilkunde<br />
Dr. Eva Leder 1190, Salmannsdorfer Straße 24/3<br />
Dr. Martin Mir Mahmoud 1110, Eisteichstraße 23/4/2<br />
Lungenkrankheiten<br />
Dr. Alice Tonsa 1120, Hetzendorfer Straße 90<br />
Priv.Doz. Dr. Arschang Valipour 1190, Heiligenstädter Straße 4648<br />
Nuklearmedizin<br />
Dr. Bamdad Heydari 1010, Laurenzerberg 2 **<br />
Orthopädie und orthopädische Chirurgie<br />
Dr. Günter Mader 1030, Landstraßer Hauptstraße 7577 **<br />
Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation<br />
Dr. Beata Saria 1130, OskarJaschaGasse 82<br />
Plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie<br />
Dr. Rudolf Bartsch 1190, Sieveringer Straße 36<br />
Univ.Doz. Dr. Georg Huemer 1090, Liechtensteinstr. 143145/1D **<br />
Psychiatrie<br />
Dr. Romana Wimmer 1140, Rettichgasse 16a/1<br />
Radiologie<br />
Univ.Prof. Dr. Norbert Gritzmann 1220, Eßlinger Hauptstraße 89<br />
Dr. Josef Kahrom 1220, Tietzestraße 2/1/2<br />
Unfallchirurgie<br />
Dr. Erich Altenburger 1090, Kinderspitalgasse 1/2/4 **<br />
Prim. Univ.Doz. Dr. Christian Kukla 1090, Alser Straße 28/12 **<br />
Dr. Michael Pusch 1030, Landstraßer Hauptstraße 83/11<br />
Urologie<br />
Bgdr. Prof. Dr. Thomas Michael Treu 1190, Heiligenstädter Straße 4648 **<br />
Zahnärzte/Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde<br />
Dr. Agata Klackl 1220, Quadenstraße 68/5/2<br />
(** Zweitpraxis)<br />
Praxisverlegungen<br />
Allgemeinmedizin<br />
Dr. Mojgan Bakhshandeh Salamat 1120, Bickellgasse 55 � 1120, Sechtergasse 810/4<br />
Dr. Melitta Bohn-Rieder 1100, Hofherrgasse 8/1 � 1120, Bischofgasse 26/1<br />
Dr. Eva Ernst 1180, Staudgasse 7/1 � 1080, Laudongasse 3/15<br />
Dr. Gabriele Jakl-Kotauschek 1150, Loeschenkohlgasse 26 � 1160, Maroltingergasse 86/8<br />
Dr. Gabriele Meditz 1060, Mariahilfer Straße 81/3/3 � 1060, Mariahilfer Straße 95/1/18<br />
Dr. Irma Maria Sakl 1120, Grünbergstraße 9 � 1120, Arndtstraße 22/21<br />
Dr. Maria Seidl<br />
Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
1060, Mariahilfer Straße 81/3/3 � 1060, Mariahilfer Straße 95/1/18<br />
Dr. Svenja Stengl 1010, Börseplatz 6/19 � 1070, Stiftgasse 21/17
mitteilungen aus dem kammerbereich<br />
Intern<br />
Praxisverlegungen (Forts.)<br />
Haut- und Geschlechtskrankheiten<br />
Dr. Hajnalka Kiprov 1130, Maxingstraße 42 � 1190, Grinzinger Allee 15<br />
Univ.Prof. Dr. Rainer Kunstfeld<br />
Innere Medizin<br />
1190, Scheimpfluggasse 3/7 � 1180, Währinger Straße 115/14<br />
Dr. Gabriele Jakl-Kotauschek<br />
Neurologie<br />
1150, Loeschenkohlgasse 26 � 1160, Maroltingergasse 86/8<br />
Dr. Andrea Buzath-Fiedler<br />
Psychiatrie<br />
1010, Dorotheergasse 9 � 1130, Dommayergasse 2<br />
Dr. Vlasios Kappos 1150, Sturzgasse 44/28 � 1070, Kirchberggasse 26/E4<br />
Praxisabmeldungen<br />
Allgemeinmedizin (PLZ)<br />
Dr. Hanna Aumair 1150<br />
Dr. Mohammad Baghaei Yazdi 1190<br />
Dr. Jozsef Erdös 1070<br />
Dr. Margarete Groß 1220<br />
MR Dr. Maria Andrea Kubec 1120<br />
Dr. Birgit Nagiller 1070<br />
Dr. Karin Wurzer<br />
Anästhesiologie und Intensivmedizin<br />
1220<br />
Dr. Birgit Nagiller<br />
Augenheilkunde und Optometrie<br />
1070<br />
Dr. Christine Nohynek-Nourou 1110<br />
Dr. Soheil Yousef Elahi<br />
Chirurgie<br />
1180<br />
Dr. Alfred Bart<strong>als</strong>ky<br />
Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
1050<br />
Prim. Dr. Gottfried Gamperl 1180<br />
MR Dr. Peter Prochaska 1180<br />
Haut- und Geschlechtskrankheiten<br />
Dr. Bahareh Keschavarz 1190 **<br />
Dr. Sabine Stolkovich 1020<br />
Innere Medizin<br />
Dr. Christine Herkner 1140<br />
MR Dr. Konrad Kindler 1210<br />
MR Dr. Werner Lackner 1230<br />
Prim. Univ.Prof. Dr. Christian Leithner 1100<br />
Dr. Donatus Pokorny 1060<br />
Kinder- und Jugendheilkunde<br />
Univ.Prof. Dr. Manfred Götz 1210<br />
MR Dr. Franz Kölbl 1110<br />
Dr. Erika Schwarzbach 1110<br />
Lungenkrankheiten<br />
Dr. Hilbert Kuchner 1120<br />
Dr. Alexander Odelga 1040<br />
Univ.Prof. Dr. Hartmut Zwick 1040<br />
Univ.Prof. Dr. Hartmut Zwick 1040 **<br />
Neurochirurgie<br />
Univ.Doz. Dr. Andreas Schöggl 1090<br />
Neurologie<br />
Dr. Mohammad Baghaei Yazdi 1190<br />
Orthopädie und orthopädische Chirurgie<br />
Univ.Doz. Dr. Andreas Schöggl 1090<br />
Plastische, ästhetische und rekonstruktive<br />
Chirurgie<br />
Prim. Priv.Doz. Dr. Matthias Rab 1190<br />
Radiologie<br />
Dr. Claudia Reichhalter 1220<br />
Unfallchirurgie<br />
Dr. Harald Pointinger 1010<br />
Zahnärzte/Fachärzte für Zahn-, Mund- und<br />
Kieferheilkunde<br />
Dr. Christiane Kargl 1090<br />
Dr. Marta Wieser 1100<br />
(** Zweitpraxis)<br />
Geburtstage<br />
Dr. Waltraud Bauer, MR Dr. Wilhelm Binder, Dr. Maria Glogar-Perez, Dr. Valery Hadjiivanov, Dr. Ernst Kober, Mag. DDr. Teresa Konieczny, Dr. Helga Künzl,<br />
MR Dr. Stephen Losch, Dr. Maria Navratil, Dr. Julius Rodler, Priv.Doz. Dr. Margaretha Rudas, DI Dr. Michael Schenner, Dr. Harald Siber, Univ.Prof. Dr. Heinz<br />
Sochor, Univ.Prof. Dr. Franz Josef Steinkogler, Dr. Karl Tremmel (alle 60)<br />
Dr. Brigitte Beck, OMR Dr. Katharina Doskar, Dr. Gerhard Eckhart, Dr. Wolfgang Höhsl, Univ.Prof. DDr. Johann Huber, Dr. Georg Kostyrka, Dr. Brigitte Penkner,<br />
Dr. Annegret Richling, MR Dr. Monika Franziska Rösler, Dr. Brigitte Schmid, MR Dr. Wolfram Simon, Dr. Christine Szabo, Dr. Christiane Weber (alle 65)<br />
OR Univ.Prof. Dr. Gerhard Breitenecker, Univ.Prof. Dr. Alfred Gangl, Dr. Reinhard Kröner, Dr. Gerda Novak-Hiess, Dr. Peter Pucher, MR Dr. Horia Dan Scarlat,<br />
Dr. Gertrud Schragner, Dr. Jörg Slany, HR Univ.Prof. Dr. Helmut Umek, Univ.Doz. Dr. Walter Vormittag, Dr. Nicholas Walker, Dr. Burkhard Wicke,<br />
Univ.Prof. Dr. Lothar Wicke, Dr. Roswitha Wittmann, Dr. Roswitha Wolf, MR Dr. Arno Ziebart-Schroth (alle 70)<br />
OMR Dr. Theodor Fuchs, Dr. Barbara Koechlin, MAS, Dr. Florica Marmorstein-Lechner, MR Dr. Maria Riccarda Mayer, Univ.Prof. Dr. Josef Suko (alle 75)<br />
Univ.Prof. Dr. Kurt Jellinger, Dr. Nikolaus Popa, MR Dr. Hans Georg Unzeitig (alle 80)<br />
Univ.Prof. Dr. Wolfgang Enenkel, OMR Dr. Hans Goldbach, Univ.Prof. Dr. Alfred Priesching, Dr. Ilse Salzmann, Dr. Felicitas Schlinke,<br />
MR Prof. Dr. Kurt Stellamor (alle 85)<br />
MR Dr. Pauline Paleczek, Univ.Prof. Dr. Karl Weghaupt (beide 90)<br />
Dr. Karla Bayer, MR Dr. Wilhelmine Binder, Dr. Edith Lachnit-Kothny (alle 91)<br />
Univ.Prof. Dr. Johannes Frischauf, Dr. Maria Ronay (beide 92)<br />
MR Dr. Hildegard Kriegisch (93)<br />
Dr. Ferdinand Dietrich (94)<br />
Dr. Alfred Kristinsky (97)<br />
OMR Dr. Johann Komarek (98)<br />
Todesfälle R.I.P.<br />
Dr. Andreas Bach � 25.12.1962 � 23.02.2011<br />
Dr. Alfred Bart<strong>als</strong>ky � 11.06.1939 � 17.02.2011<br />
Dr. Dorothea Eberhartinger � 22.08.1925 � 27.02.2011<br />
Dr. Ralph Konrad � 03.05.1960 � 09.08.2010<br />
MR Dr. Rudolf Roka � 11.08.1914 � 09.02.2011<br />
Dr. Wilhelm Roninger � 22.01.1947 � 23.02.2011<br />
Univ.Prof. Dr. Franz Johann Wachtler � 24.12.1955 � 02.02.2011<br />
Univ.Prof. Dr. Hartmut Zwick � 23.06.1942 � 23.03.2011<br />
1
PATIENTENSICHERHEIT<br />
Intern<br />
20 5|11<br />
gesundheit und politik<br />
Länderübergreifendes Treffen der deutschsprachigen Institutionen<br />
Ettl: „Obwohl wir<br />
jetzt endlich Zahlen<br />
haben, wird derzeit<br />
immer noch mehr<br />
diskutiert <strong>als</strong> tatsächlichumgesetzt“<br />
SPITÄLER<br />
Bis zu 50 Verwechslungen von Patienten passieren jährlich in Österreich.<br />
Vor diesem Hintergrund haben sich nun Österreich, Deutschland und die<br />
Schweiz zusammengeschlossen, um gemeinsam die Sicherheit der Patienten<br />
zu erhöhen.<br />
� Am 11. März 2011 fand im AKH Linz Projekte und wissenschaftliche Publikati-<br />
im Zuge der Konferenz „Patientenveronen zu entwickeln und zu fördern. 90<br />
wechslung schwer gemacht“ erstm<strong>als</strong> ein Teilnehmer aus ganz Österreich besuchten<br />
Zusammentreffen der deutschsprachigen die Veranstaltung.<br />
Institutionen zur Förderung der Patienten- Entsprechend dem Veranstaltungstitel „Pasicherheit<br />
statt. Zum Treffen luden die tientenverwechslung schwer gemacht“<br />
Österreichische Plattform Patientensicher- wurden österreichweite Lösungsansätze<br />
heit unter der Leitung der ärztlichen vorgestellt und diskutiert. Als zweites<br />
Direktorin des Krankenhauses Hietzing Hauptanliegen wurde die künftige Form<br />
mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel, der Vernetzung und länderübergreifenden<br />
Brigitte Ettl, sowie Maria Kletecka-Pulker Zusammenarbeit festgelegt.<br />
vom Institut für Ethik und Recht in der Me- Dabei waren sich alle drei Länder einig,<br />
dizin der Universität Wien. Die Schweiz dass dringender Handlungsbedarf besteht.<br />
war vertreten durch Dieter Conen von der „Früher gab es ständig Widerstand gegen<br />
Schweizer Stiftung Patientensicherheit und Maßnahmen zur Patientensicherheit we-<br />
Deutschland durch Günther Jonitz vom gen fehlender Zahlen. Jetzt sind die Zahlen<br />
Aktionsbündnis Patientensicherheit. Bei da, die die Wirksamkeit dieser Maßnah-<br />
allen drei teilnehmenden Institutionen men belegen. Trotzdem wird immer noch<br />
handelt es sich um nationale Plattformen mehr diskutiert <strong>als</strong> tatsächlich umgesetzt“,<br />
zur Entwicklung und Förderung der Pati- führt Ettl aus.<br />
entensicherheit, deren Ziel es ist, durch Aufgrund zahlreicher international aner-<br />
Kooperationen und Vernetzung Aktivitäten, kannter Studien muss man davon ausge-<br />
10,6 Milliarden Euro jährlich für die stationäre Versorgung<br />
Die Ausgaben für die Spitäler sind ebenso wie die gesamten Gesundheitsausgaben<br />
in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen.<br />
Insgesamt wurden im Jahr 200 laut Daten der Statistik Austria von<br />
der öffentlichen Hand 2 ,5 Milliarden Euro für die Gesundheit aufgewendet.<br />
Die stationäre Versorgung in den Krankenhäusern verschlang<br />
davon fast die Hälfte – nämlich 10,6 Milliarden Euro.<br />
� Im Jahr 2004 waren die öf- Prozent gependelt waren, sind sie 2009<br />
fentlichen Gesundheitsausgaben dann auch aufgrund der Wirtschaftskrise<br />
von Staat und Sozialversiche- auf 8,6 Prozent angewachsen. Rechnet<br />
rungen noch bei 18,3 Milliarden man auch die privaten Gesundheitsaus-<br />
Euro gelegen. Zwei Jahre später gaben hinzu, dann lagen sie bei 11,0 Pro-<br />
waren es bereits 20 Milliarden zent des BIP, während sie in den Jahren<br />
Euro und im Jahr 2009 dann 23,5 davor zwischen 10,3 und 10,4 Prozent ge-<br />
Milliarden Euro. Gemessen an der pendelt waren.<br />
Wirtschaftsleistung wird diese Stei- Für die stationäre Versorgung in den Spitägerung<br />
allerdings erst im Krisenlern haben Bund, Länder, Gemeinden und<br />
jahr 2009 wirklich signifikant. die Sozialversicherung im Jahr 2009 mit<br />
Während die öffentlichen Gesund- 10,6 Milliarden Euro fast die Hälfte der geheitsausgaben<br />
gemessen am BIP samten öffentlichen Gesundheitsausgaben<br />
seit 2001 zwischen 7,7 und 7,9 aufgewendet. Im Jahr 2004 hatten diese<br />
hen, dass es in Österreich pro Jahr zu 20<br />
bis 50 Patientenverwechslungen kommt.<br />
Hierbei handelt es sich nicht immer um so<br />
dramatische Zwischenfälle wie die Amputation<br />
des f<strong>als</strong>chen Beins, sondern um Fälle,<br />
in denen der f<strong>als</strong>che Patient ein f<strong>als</strong>ches<br />
Medikament bekommt oder Befunde verwechselt<br />
werden. So belegen auch internationale<br />
Studien, welche wirksamen Maßnahmen<br />
hierbei eingesetzt werden können,<br />
um solche Fehler zu verhindern. „Besonders<br />
wichtig wäre es, Inhalte und Methoden<br />
des klinischen Risikomanagements<br />
schon in der Ausbildung zu vermitteln. Andererseits<br />
sind ständige Schulungen und<br />
Trainings der multiprofessionellen Teams<br />
in medizinischen Simulationszentren zu<br />
forcieren“, so Kletecka-Pulker.<br />
Es sei daher notwendig, dass sich die Politik<br />
klar zur Patientensicherheit bekenne<br />
und Rahmenbedingungen für die Etablierung<br />
einer Sicherheitskultur im Gesundheitswesen<br />
geschaffen würden, ergänzt Conen.<br />
Insbesondere müssten finanzielle<br />
Mitteln dafür bereitgestellt werden, um<br />
notwendigen Maßnahmen und Projekte<br />
umsetzen zu können. �<br />
Ausgaben noch acht Milliarden Euro betragen.<br />
Die Zahlungen der Sozialversicherung für<br />
den Bereich der niedergelassenen Ärztinnen<br />
und Ärzte und die Ambulatorien sowie<br />
die Zahlungen des Staates und der Sozialversicherungen<br />
für die Spit<strong>als</strong>ambulanzen<br />
sind im gleichen Zeitraum von 4,4<br />
Milliarden Euro auf 5,5 Milliarden Euro<br />
angewachsen.<br />
Betrachtet man nicht alle Spitäler, sondern<br />
nur jene, die über die Landesgesundheitsfonds<br />
finanziert werden – das sind im Wesentlichen<br />
alle öffentlichen Krankenhäuser<br />
–, dann wurden dafür im Jahr 2008 8,8<br />
Milliarden Euro ausgegeben. Der Löwenanteil<br />
davon entfiel mit 2,6 Milliarden Euro<br />
auf Wien, gefolgt von Oberösterreich mit<br />
1,5 Milliarden Euro. Die geringsten Ausgaben<br />
verzeichnete das Burgenland mit 186<br />
Millionen Euro. �
DEUTSCHLAND<br />
Gesundheitsausgaben weiter gestiegen<br />
Die Gesundheitsausgaben in Deutschland sind 200 deutlich stärker gestiegen<br />
<strong>als</strong> in den Jahren davor. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden<br />
am 6. April 2011 mitteilte, wuchsen die Ausgaben um 5,2 Prozent auf 278,<br />
Milliarden Euro.<br />
� Zwischen 2000 und 2008 waren die ausmachten. Im Vorjahresvergleich betrug<br />
Ausgaben der gesetzlichen und privaten die Kosten-Steigerungsrate in diesem Sek-<br />
Krankenkassen, der Pflegeversicherung, tor etwa 4,9 Prozent.<br />
der privaten Haushalte und gemeinnüt- Als Gründe nannte das Statistische Bunziger<br />
Organisationen für die Gesundheit desamt unter anderem Leistungsverbes-<br />
dagegen jährlich nur um durchschnittlich serungen durch das Pflege-Weiter-<br />
2,7 Prozent gestiegen.<br />
entwicklungsgesetz und Honorarsteige-<br />
Auf jeden Bundesbürger entfielen 2009 rungen für die niedergelassene Ärztinnen<br />
rein rechnerisch Gesundheitsausgaben und Ärzte.<br />
von ungefähr 3400 Euro. 2008 waren es Ausgaben für Krankenhäuser, Rehabilitati-<br />
dem Statistischen Bundesamt zufolge 3220 onskliniken, Pflegeheime und andere stati-<br />
Euro gewesen.<br />
onäre und teilstationäre Einrichtungen<br />
Die Aufwendungen für Dienstleistungen stiegen 2009 um 5,8 Milliarden Euro auf<br />
und Material im Gesundheitswesen ent- 100,2 Milliarden Euro.<br />
sprachen 2009 knapp einem Neuntel Dazu trug den Angaben zufolge unter an-<br />
(11,6 Prozent) des deutschen Bruttoinderem eine gesetzliche Reform der Kranlandsprodukts.kenhausfinanzierung<br />
bei. Diese verpflich-<br />
Ein Großteil der Kosten entstand in ambutete die Kassen unter anderem dazu, sich<br />
lanten Einrichtungen wie Arztpraxen, Apo- an der Finanzierung von Tariferhöhungen<br />
theken oder ambulanten Pflegeeinrich- und Programmen zur Verbesserung der<br />
tungen, die mit 138,2 Milliarden Euro fast<br />
die Hälfte der Ausgaben (49,7 Prozent)<br />
Stellensituation beim Pflegepersonal zu<br />
beteiligen. �<br />
EU<br />
Tabakgesetz: Österreich abgeschlagen<br />
Der Verband der Europäischen Krebs-Ligen (ECL) hat am 23. März 2011<br />
in Den Haag den vierten Europäischen Tabak-Kontroll-Index (TSC 2010)<br />
präsentiert. Österreich liegt dabei auf dem letzten Rang und somit unter<br />
31 Staaten gemeinsam mit Griechenland an 30. Stelle.<br />
� Die von einem Beurteilungsgremium lichter sind Ungarn und Tschechien mit je<br />
beobachteten Staaten bestehen aus den 27 34 Punkten, Luxemburg mit 33 und<br />
EU-Staaten plus Schweden, Island, Norwe- schließlich am 30. Rang ex aequo Östergen<br />
und der Türkei. Zu vergeben waren reich und Griechenland (32 Punkte).<br />
100 Punkte in fünf Kriterien: Zigaretten- Das schlechte Abschneiden Österreichs<br />
preise, Werbevorschriften, Tabakgesetzge- dürfte auch mit den geltenden Anti-Rauchbung,<br />
Warnhinweise und Maßnahmen, Regelungen in der Gastronomie im Zu-<br />
welche den Rauchern das Aufhören ersammenhang stehen. „Die fünf Länder an<br />
leichtern sollen inklusive der für solche der Spitze haben alle Maßnahmen zur<br />
Aufgaben vorhandenen Budgets.<br />
Kontrolle des Tabakkonsums einschließ-<br />
Die Rangliste: An der Spitze liegt mit 77 lich hoher Preise für Tabakprodukte und<br />
Punkten Großbritannien, dann folgen Ir- vollständige Verbote für das Rauchen auch<br />
land (69), Norwegen (62) sowie die Tür- in Bars und Restaurants. Diese Maßnahkei<br />
und Island mit je 61 Punkten. Im Mittelmen sind zwei der effektivsten und wurden<br />
feld befinden sich zum Beispiel Staaten wie<br />
Italien (47) und Spanien (46). Die Schlussmit<br />
der höchsten Punkteanzahl bedacht“,<br />
hieß es in einer Presseaussendung. �<br />
gesundheit und politik<br />
Intern<br />
ÄRZTEBANKfiNANZiERuNg<br />
JETZT MiT ZiNSCAP-fiNANZiERuNg ...<br />
...von niedrigen Kreditzinsen profitieren.<br />
Kombinieren Sie die aktuell niedrigen Zinsen mit der<br />
Zinssicherheit eines klassischen Fixzinskredites und begrenzen<br />
Sie damit das Risiko eines Zinsanstieges. Egal<br />
was die Zukunft bringt. Mit dem Zinssicherungspaket der<br />
Ärztebank profitieren Sie heute vom niedrigen Zinsniveau<br />
an den Finanzmärkten und sichern sich für morgen<br />
günstige Kreditzinsen.<br />
www.aerztebank.at<br />
4020 Linz, Hafnerstraße 11<br />
Tel. +43/732/77 00 99-0<br />
6020 innsbruck, Museumstraße 8<br />
Tel. +43/512/56 09 05-0<br />
Bank für Ärzte und freie Berufe Ag<br />
1090 Wien, Kolingasse 4<br />
Tel. +43/1/521 07-0<br />
5020 Salzburg, Makartplatz 7<br />
Tel. +43/662/87 04 83-0<br />
8010 graz, Herrengasse 9<br />
Tel. +43/316/81 10 41-0<br />
21
Am Puls<br />
22 5|11<br />
coverstor y<br />
<strong>ELGA</strong>: <strong>Mehr</strong><br />
<strong>Flop</strong> <strong>als</strong> <strong>top</strong>?<br />
Als „bundesweite Maßnahme<br />
zur Verbesserung der Qualität<br />
des österreichischen Gesund-<br />
heitswesens“ propagiert das<br />
Gesundheitsministerium die<br />
Implementierung der Elektro-<br />
nischen Gesundheitsakte<br />
(<strong>ELGA</strong>). Die Motivation<br />
von Gesundheitsminister<br />
Alois Stöger, noch vor<br />
dem Sommer ein Gesetz,<br />
das das Mammutprojekt<br />
<strong>ELGA</strong> verwirklichen soll,<br />
in den Nationalrat ein-<br />
zubringen, ist groß –<br />
die Anzahl der<br />
Skeptiker auch.<br />
Von Elisa Cavalieri<br />
� In fast allen Lebensbereichen ist elek- der Gesundheitsversorgung weg vom Patronischer<br />
Datenverkehr auf dem Vorpier hin zu einer technologischen Inframarsch<br />
– und macht auch vor dem Gestruktur steht unmittelbar bevor. Das Gesundheitswesen<br />
nicht halt. Anwendungen sundheitstelematikgesetz (GTelG) 2011<br />
elektronischer Medien werden in Gesund- („<strong>ELGA</strong>-Gesetz“), das schon bald in den<br />
heitsbereichen immer mehr genützt. Nationalrat eingebracht werden soll, soll<br />
Das prominenteste Beispiel der letzten in seinem vierten Abschnitt die Rechts-<br />
Jahre, das sowohl Ärztinnen und Ärzte <strong>als</strong> grundlagen für die Verwirklichung der<br />
auch Patienten massiv betroffen hat, war Elektronischen Gesundheitsakte <strong>ELGA</strong><br />
der Umstieg vom Krankenschein auf die schaffen.<br />
kleine grüne elektronische Gesundheitskarte<br />
aus Plastik: Seit 2005 sind die Öster- Was soll <strong>ELGA</strong> bringen?<br />
reicher mit einer E-Card ausgestattet. Mit „Ein zentrales Element, um die Gesund-<br />
einem Krankenschein den Arzt oder die heitsversorgung zu optimieren, ist, dass<br />
Ärztin aufzusuchen, wäre heute für viele Ärztinnen und Ärzte sowie Personen aus<br />
nicht mehr vorstellbar.<br />
anderen Gesundheitsberufen schnell und<br />
Der nächste große Entwicklungsschritt in unkompliziert relevante Patientendaten<br />
zur Verfügung haben, die für ihre Entscheidung<br />
wichtig sind“, zeigt sich Gesundheitsminister<br />
Alois Stöger überzeugt.<br />
Dem Minister zufolge ist <strong>ELGA</strong> die Lösung,<br />
um einen unkomplizierten Zugriff auf benötigte<br />
Gesundheitsdaten zu gewährleisten.<br />
Gesundheitsdiensteanbieter – unter<br />
anderem Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser<br />
– sollen schon bald Patientenbefunde,<br />
Entlassungsbriefe und Medikationsdaten<br />
ihrer Patienten per Knopfdruck<br />
einsehen können. Argumentiert wird mit<br />
dem Umstand, dass die Gesundheitsdaten<br />
einer Person zumeist auf die Krankengeschichten<br />
in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen<br />
verteilt sind und die vielfältigen<br />
Computersysteme vor allem zwischen
dem niedergelassenen und dem Spit<strong>als</strong>bereich<br />
nicht miteinander kommunizieren<br />
könnten. <strong>ELGA</strong> soll garantieren, dass wichtige<br />
Informationen im Falle einer Behandlung<br />
zur Verfügung stehen und Informationsdefizite<br />
abgebaut werden.<br />
Um die Patientenautonomie und die Patientenrechte<br />
zu stärken, sollen künftig<br />
auch Patienten im Zuge von <strong>ELGA</strong> in der<br />
Lage sein, über das Online-Gesundheitsportal<br />
Österreichs www.gesundheit.gv.at<br />
auf die eigenen Gesundheitsdaten zuzugreifen.<br />
„<strong>Mehr</strong> Transparenz, optimierte<br />
Qualität“ lautet das Credo des Gesundheitsministeriums,<br />
mit dem das Gesetz<br />
noch vor der parlamentarischen Sommerpause<br />
verabschiedet werden soll.<br />
Die Ärztekammer zeigt sich über das flotte<br />
Tempo, das das Gesundheitsministerium<br />
bezüglich <strong>ELGA</strong> vorlegt, wenig erfreut. Zu<br />
viele Fragen sind offen, zu viele Regelungen<br />
unausgegoren.<br />
Erste Schritte mit E-Medikation<br />
Erst vor wenigen Wochen ist – mit einiger<br />
Verzögerung – der Startschuss für das Pilotprojekt<br />
E-Medikation gefallen, der ersten<br />
Anwendung der elektronischen Gesundheitsakte<br />
<strong>ELGA</strong>. Im Zuge einer groß<br />
angelegten Pressekonferenz verkündeten<br />
am 29. März 2011 unter dem Motto „Ein<br />
guter Tag für die Gesundheit“ Gesundheitsminister<br />
Alois Stöger und Hans Jörg Schelling,<br />
Vorsitzender des Hauptverbands der<br />
österreichischen Sozialversicherungsträger,<br />
im Beisein von Ärztekammerpräsident<br />
Walter Dorner und weiteren Gesprächspartnern<br />
aus dem Gesundheitsbereich<br />
stolz den Start des Pilot-Projekts E-Medikation<br />
quer durch ganz Österreich. Zu den<br />
Modellregionen der E-Medikation zählen<br />
seit dem 1. April 2011 der 21. und der 22.<br />
Wiener Gemeindebezirk, die oberösterreichischen<br />
Bezirke Wels Stadt, Wels Land,<br />
Grieskirchen und Eferding sowie die Tiroler<br />
Bezirke Reutte, Imst und Landeck. Stöger<br />
betonte dabei „Österreichs Vorreiterrolle<br />
in der EU bezüglich E-Health“.<br />
Funktionieren soll die E-Medikation-<br />
Anwendung folgendermaßen: Die teilnehmenden<br />
Patienten erhalten ein „Arzneimittelkonto“,<br />
worin sowohl ärztlich verordnete<br />
<strong>als</strong> auch in der Apotheke rezeptfrei bezogene<br />
Arzneimittel für die Dauer der<br />
Einnahme und sechs Monate danach gespeichert<br />
werden. Der vorrangige Zweck<br />
der E-Medikation ist es, unerwünschten<br />
Wechselwirkungen und <strong>Mehr</strong>fachverordnungen<br />
vorzubeugen. Auch Apotheker<br />
sehen bei Abgabe eines rezeptfreien Medikaments<br />
durch Stecken der E-Card, die <strong>als</strong><br />
Zugangsschlüssel zu den Arzneimitteldaten<br />
dienen soll, ob es sich mit der bestehenden<br />
Medikation verträgt. Auf der E-Card<br />
selbst sollen allerdings keine Arzneimitteldaten<br />
gespeichert werden.<br />
Dorner sieht im deutlichen Gewinn an Patientensicherheit<br />
das einzig wichtige Ziel,<br />
um die elektronische Erfassung und zentrale<br />
Speicherung individueller Medikationsdaten<br />
zu rechtfertigen. Der Ärztekammerpräsident<br />
äußert sich zum Pilotbetrieb<br />
mit vorsichtigem Optimismus: „Es stehen<br />
organisatorische, technische und finanzielle<br />
Bedingungen auf dem Prüfstand. Im<br />
Vordergrund der E-Medikation hat der Patientennutzen<br />
zu stehen. Deshalb erwarten<br />
wir uns eine detaillierte Auswertung des<br />
Pilotbetriebs in Bezug auf Patienten- und<br />
Datensicherheit, Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit<br />
sowie Kosten der Einführung<br />
und des laufenden Betriebs.“ Dorner<br />
betont darüber hinaus, dass erst der<br />
Pilotbetrieb über eine österreichweite Umsetzung<br />
entscheiden soll: „Nur, wenn danach<br />
positive Ergebnisse vorliegen, ist aus<br />
unserer Sicht eine Umsetzung in ganz Österreich<br />
sinnvoll.“<br />
Obwohl die erste <strong>ELGA</strong>-Anwendung, die<br />
E-Medikation, erst in den Kinderschuhen<br />
steckt und eine Auswertung noch aussteht,<br />
verfolgt das Gesundheitsministerium bereits<br />
eine baldige Verabschiedung des<br />
<strong>ELGA</strong>-Gesetzes. In der Ende März 2011 abgelaufenen<br />
Gesetzesbegutachtung wurde<br />
der vorgelegte Gesetzesentwurf allerdings<br />
von mehreren Seiten massiv bemängelt.<br />
Gesetzesentwurf erntet Kritik<br />
Die Gründe für die negative Resonanz sind<br />
vielfältig. Geht es nach dem Gesundheitsministerium,<br />
sollen alle Patienten an <strong>ELGA</strong><br />
teilnehmen. Wollen sie das nicht tun, haben<br />
sie – im Gegensatz zu den Ärztinnen<br />
und Ärzten – die Möglichkeit, der Teilnahme<br />
zu widersprechen. Dieses sogenannte<br />
Opting-Out ist jederzeit möglich, und zwar<br />
in mehreren Varianten: Je nach Patientenwunsch<br />
können alle <strong>ELGA</strong>-Gesundheitsdaten,<br />
alle <strong>ELGA</strong>-Gesundheitsdaten ausgenommen<br />
Medikationsdaten oder nur die<br />
Medikationsdaten von der Einsicht durch<br />
Gesundheitsdiensteanbieter ausgenommen<br />
werden.<br />
coverstory<br />
Am Puls<br />
Nutzen stark bezweifelt<br />
Gerade diese Opting-Out-Variante ist es,<br />
die bei unterschiedlichsten Interessenvertretern<br />
im Kreuzfeuer der Kritik steht. Der<br />
Datenschutzrat sieht es <strong>als</strong> problematisch<br />
an, dass Teilnehmer nur durch ihren ausdrücklichen<br />
Widerspruch aus dem <strong>ELGA</strong>-<br />
System austreten können. Aus datenschutzrechtlicher<br />
Sicht sei demnach eine Opting-<br />
In-Lösung, <strong>als</strong>o die Erteilung einer Zustimmung<br />
vor der Verarbeitung von Daten, <strong>als</strong><br />
die korrekte Variante anzusehen. Johann<br />
Maier, SPÖ-Nationalratsabgeordneter und<br />
Vorsitzender des Datenschutzrates, betont:<br />
„Wenn man sich dennoch für eine Opting-<br />
Out-Lösung entscheidet, müssten Patienten<br />
zum Ausgleich umfassend, verständlich<br />
und individuell informiert werden.“<br />
Neben dem Datenschutzrat, der Arbeiterkammer<br />
und weiteren Interessenvertretern<br />
spricht sich auch die Ärztekammer<br />
klar für eine Opting-In-Variante aus: „Patienten<br />
sollten ihre Zustimmung zur Speicherung<br />
und Verarbeitung ihrer Daten bewusst<br />
erteilen können, anstatt Einspruch<br />
erheben zu müssen“, so Ärztekammerpräsident<br />
Dorner.<br />
Ein weiterer Grund für die Kritik daran,<br />
dass Patienten selbst entscheiden können,<br />
ob sie der Speicherung ihrer Gesundheitsdaten<br />
ganz oder teilweise widersprechen,<br />
ist die Frage nach dem Vorteil, den <strong>ELGA</strong><br />
für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte<br />
dann noch bringen soll. Gerade sensible<br />
Gesundheitsdaten, wie beispielsweise eine<br />
HIV-Infektion, eine psychiatrische Erkrankung<br />
oder eine Abtreibung, sollen nur<br />
nach ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen<br />
in die Elektronische Gesundheitsakte<br />
aufgenommen werden. „Wenn<br />
Patienten selbstständig einzelne Daten zurückhalten<br />
können, kann man wohl kaum<br />
von Transparenz sprechen“, kritisiert der<br />
Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte<br />
und Vizepräsident der Ärztekammer für<br />
Wien, Johannes Steinhart.<br />
Sowohl das Finanzministerium <strong>als</strong> auch<br />
das Land Vorarlberg teilen in ihren Stellungnahmen<br />
zum Gesetzesentwurf die Bedenken<br />
der Ärztekammer zum Nutzen des<br />
<strong>ELGA</strong>-Projekts, wenn die Patienten selbst<br />
entscheiden können, ob und in welchem<br />
Umfang sie an <strong>ELGA</strong> teilnehmen möchten.<br />
ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger<br />
bezeichnet die Möglichkeit der Ausblendung<br />
einzelner Gesundheitsdaten sogar <strong>als</strong><br />
„gefährlich“. „Wenn ganze Datenblöcke<br />
Stöger: „Ärzte sowie<br />
Personen aus<br />
anderen Gesundheitsberufenmüssen<br />
schnell und unkompliziertrelevantePatientendaten<br />
zur Verfügung<br />
haben“<br />
Dorner: „Das einzig<br />
wichtige Ziel, um<br />
die elektronische<br />
Erfassung individuellerMedikationsdaten<br />
zu rechtfertigen,<br />
ist der Gewinn<br />
an Patientensicherheit“<br />
Rasinger: „Wenn<br />
ganze Datenblöcke<br />
nicht mehr vorhanden<br />
sind, ist die<br />
ganze Speicherung<br />
von Gesundheitsdaten<br />
wertlos“<br />
2
Steinhart: „Die lückenhafteDokumentation<br />
bei <strong>ELGA</strong><br />
wird ein ernst zu<br />
nehmendes Haftungsproblem<br />
für<br />
uns Mediziner mit<br />
sich bringen“<br />
Am Puls<br />
24 5|11<br />
coverstory<br />
nicht vorhanden sind, ist das Ganze wertlos“,<br />
so Rasinger.<br />
Steinhart befürchtet darüber hinaus, dass<br />
die lückenhafte Dokumentation bei <strong>ELGA</strong><br />
ein ernst zu nehmendes Haftungsproblem<br />
für die Mediziner mit sich bringen wird.<br />
Denn obwohl die behandelnden Ärztinnen<br />
und Ärzte im <strong>ELGA</strong>-System nicht erkennen<br />
können, ob einzelne Informationen vom Patienten<br />
ausgeblendet wurden oder nicht, ist<br />
ihr Haftungsrisiko im vorliegenden Gesetzesentwurf<br />
nur sehr ungenügend geregelt. „Es<br />
ist bis dato unklar, ob wir die Patienten künftig<br />
fragen müssen, ob sie uns Informationen<br />
vorenthalten, ob wir nur die sichtbaren Patienteninformationen<br />
<strong>als</strong> Behandlungsgrundlage<br />
nehmen sollen oder ob uns die Patienten<br />
von sich aus darauf hinweisen müssen,<br />
dass sie bestimmte Daten unsichtbar gemacht<br />
haben“, so Steinhart. „Dass <strong>ELGA</strong> die<br />
Kommunikation zwischen Arzt und Patient<br />
verbessert, ist <strong>als</strong>o fraglich.“ Um negative<br />
Haftungsfolgen für Ärztinnen und Ärzte auszuschließen,<br />
fordert die Österreichische<br />
Ärztekammer, dass ausgeblendete Gesundheitsdaten<br />
für Mediziner keine Relevanz haben<br />
dürfen, es sei denn, sie werden von den<br />
Patienten explizit darauf hingewiesen.<br />
<strong>Mehr</strong>aufwand für Mediziner<br />
Neben der ungeklärten Haftungsfrage ist<br />
im Zuge von <strong>ELGA</strong> auch ein beachtlicher<br />
<strong>Mehr</strong>aufwand für Ärztinnen und Ärzte zu<br />
erwarten. Laut einer im Dezember des<br />
Vorjahrs veröffentlichten GfK-Studie, die<br />
vom Hauptverband der österreichischen<br />
Sozialversicherungsträger in Auftrag gegeben<br />
wurde, wollen beispielsweise drei<br />
Viertel der befragten Österreicher künftig<br />
die Möglichkeit nutzen, ihre aktuelle Arzneimittelliste<br />
mit den Dosierungsinformationen<br />
auszudrucken. In etwa 67 Prozent<br />
davon wollen diesen Ausdruck vom niedergelassenen<br />
Arzt machen lassen. „Vor<br />
allem ältere Patienten haben oft keinen Internetzugang<br />
oder sind mit der Materie gar<br />
nicht vertraut. Auch wenn der Gesundheitsminister<br />
Ombudsstellen für solche<br />
Patienten einrichten will, werden sich diese<br />
mit großer Wahrscheinlichkeit zuerst<br />
an ihren Vertrauensarzt wenden, wenn sie<br />
Hilfe bei dem System benötigen“, so Steinhart.<br />
Auch Susanna Michalek, Allgemeinmedizinerin<br />
in Wien, befürchtet, dass ältere Patienten<br />
nicht in der Lage sein werden, einzelne<br />
Einstellungen selbst durchzuführen:<br />
„Viele werden wollen, dass der Hausarzt<br />
die Opting-Out-Wünsche eingibt. Dabei<br />
wird wieder einmal wertvolle Behandlungszeit<br />
durch bürokratischen <strong>Mehr</strong>aufwand<br />
verkürzt“, meint Michalek. Auch die<br />
gesetzlich angedachte Informationspflicht,<br />
der zufolge Ärztinnen und Ärzte die Pati-<br />
E-Health, E-Card und <strong>ELGA</strong>: Was braucht der Patient, was will der Arzt und wie geht es weiter?<br />
Christian Husek, Allgemeinmediziner in Wien 2 ., über die Bedürfnisse<br />
von Patienten und Ärztinnen und Ärzten, die Zukunft von E-Health-Anwendungen<br />
im Gesundheitsbereich und warum „Humanfaktoren“ im Behandlungsprozess<br />
nicht außer Acht gelassen werden dürfen.<br />
Was braucht der Patient?<br />
Der Patient braucht die Sicherheit, dass alle für seinen aktuellen Behandlungsprozess<br />
wichtigen Informationen allen seinen behandelnden Ärztinnen und<br />
Ärzten und gegebenenfalls anderen<br />
Gesundheitsdienstleistern vollständig<br />
und zeitgerecht zur Verfügung<br />
stehen. Darüber hinaus muss er<br />
aber auch sicher sein können, dass<br />
seine „schutzwürdigen, sensiblen<br />
Gesundheitsdaten“ (§ 9 Datenschutzgesetz<br />
2000) ausschließlich<br />
Husek: E-Health-Anwendungen müssen von diesen von ihm berechtigten<br />
evidenzbasierend positive Effekte für den Personen eingesehen werden kön<br />
Patienten und den Behandler zeigen“<br />
nen. Den „Knackpunkt“ stellt hier<br />
der derzeit in Begutachtung befind<br />
enten über die Möglichkeiten von <strong>ELGA</strong> informieren<br />
müssen, wird den Bürokratieaufwand<br />
drastisch ansteigen lassen, ist<br />
Steinhart überzeugt: „Die von den Patienten<br />
immer wieder gewünschte Zuwendungsmedizin<br />
wird hier zwangsläufig leiden<br />
müssen.“<br />
Uneinigkeit bei der Kostenfrage<br />
Ein heikles Thema, das in puncto <strong>ELGA</strong>-<br />
Implementierung ebenfalls noch ernsthaft<br />
diskutiert werden muss, sind die Kosten,<br />
die das Projekt für sich beansprucht. Laut<br />
Gesundheitsministerium haben sich Bund,<br />
Länder und Sozialversicherung darauf verständigt,<br />
die für <strong>ELGA</strong> notwendige Infrastruktur<br />
gemeinsam zu finanzieren. Bis<br />
zum Jahr 2013 wurde dafür ein Finanzrahmen<br />
von 30 Millionen Euro beschlossen.<br />
Inkludiert sind hier sowohl die Kosten<br />
der <strong>ELGA</strong> GmbH, deren Auftrag die Koordination<br />
aller Umsetzungsmaßnahmen ist,<br />
<strong>als</strong> auch die Finanzierung des Pilotprojekts<br />
E-Medikation.<br />
Experten sind sich allerdings einig, dass<br />
diese Summe höchst unrealistisch ist.<br />
Nach einer Kosten-Nutzen-Analyse der<br />
deutschen Beratungsfirma „Debold &<br />
Lux“, die vor drei Jahren im Auftrag der<br />
damaligen ARGE <strong>ELGA</strong> die Spesen für das<br />
gesamte <strong>ELGA</strong>-System berechnet hat, ist<br />
mit Anschaffungskosten in der Höhe von<br />
liche Entwurf zum „<strong>ELGA</strong>Gesetz“ (Gesundheitstelematikgesetz 2011 – GTelG<br />
2011) dar, der hinter verschlossenen Türen im Gesundheitsministerium erarbeitet<br />
wurde und prompt massive – aus meiner Sicht berechtigte – Ablehnung quer<br />
durch alle politischen Fraktionen und Interessengemeinschaften gefunden hat.<br />
Was will der Arzt?<br />
Der von einem Patienten aufgesuchte Arzt seines Vertrauens will alle für seine<br />
Diagnostik und Behandlung unmittelbar notwendigen Informationen zeitgerecht<br />
und rasch erfassbar vorliegen haben. EDV kann und soll diese Prozesse unterstützen.<br />
E-Health-Projekte finden aber bei vielen Ärztinnen und Ärzten trotzdem<br />
nicht die Akzeptanz und die Verbreitung, die sich die Verantwortlichen wünschen.<br />
Die Ursachen dafür sind vielfältig, beginnend von der Altersstruktur<br />
(und dem damit verbundenen Interesse an und der Aufgeschlossenheit für<br />
neue Entwicklungen) über die damit entstehenden Kosten und den Arbeitsaufwand<br />
(oft durch nicht benutzergerechte Anwendungen) bis hin zu mangelhaftem<br />
Akzeptanzmanagement durch die Betreiber. Ein wesentlicher Faktor für<br />
die mangelnde Akzeptanz und Verbreitung ist auch die bisherige Fokussierung<br />
auf technische Möglichkeiten anstelle der sorgfältigen Bedarfs und Wunscherhebung<br />
bei uns Ärztinnen und Ärzten.<br />
Evidenz, Qualitätssicherung und die Transparenz entsprechender Ergebnisse
130 Millionen Euro zu rechnen. Diese<br />
Summe teilt sich wie folgt auf: 34 Millionen<br />
Euro für das Zentr<strong>als</strong>ystem (Patientenindex,<br />
GDA-Index, Dokumentenregister,<br />
Gesundheitsportal, et cetera), 20 Millionen<br />
Euro für die regionalen Spit<strong>als</strong>verbünde<br />
für regionale Dokumentenregister,<br />
42 Millionen Euro für die Ärztinnen und<br />
Ärzte, vier Millionen Euro für die Apotheken<br />
und 30 Millionen Euro für die Spitäler.<br />
Auf die einzelnen Einheiten heruntergebrochen<br />
bedeutet dies Belastungen in<br />
der Höhe von 2800 Euro pro Ordination,<br />
120.000 Euro pro Spital und 4000 Euro<br />
pro Apotheke. Die jährlichen Betriebskosten<br />
sind in diesen Berechnungen noch<br />
gar nicht berücksichtigt.<br />
Nicht nur „Debold & Lux“ rechnet mit<br />
weit höheren Kosten für das Mammut-<br />
Projekt, <strong>als</strong> vom Gesundheitsministerium<br />
veranschlagt. Auch der ehemalige <strong>ELGA</strong>-<br />
Programm-Manager Alexander Schanner<br />
spricht in Vorträgen von erwarteten<br />
Spesen in der Höhe von 150 Millionen<br />
Euro, die ARGE Daten hat sogar Kosten<br />
von 200 Millionen Euro errechnet. Vonseiten<br />
der ARGE <strong>ELGA</strong> wird argumentiert,<br />
dass die damalige Kosten-Nutzen-Analyse<br />
von anderen Voraussetzungen ausgegangen<br />
sei.<br />
Die vom Gesundheitsministerium kolportierten<br />
30 Millionen Euro Errichtungskos-<br />
ten für <strong>ELGA</strong> sind dennoch mit Vorsicht zu<br />
genießen; vor allem deshalb, weil in diesem<br />
Betrag die Belastungen der einzelnen<br />
Gesundheitsdiensteanbieter für die Vorbereitung<br />
ihrer Informations- und Kommunikationstechnologiesysteme<br />
zur Nutzung<br />
von <strong>ELGA</strong> noch nicht enthalten sind.<br />
Die Ärztekammer zeigt hier wenig Verständnis.<br />
„In Zeiten, in denen angeblich<br />
kein Geld für eine flächendeckende kinderpsychiatrische<br />
Versorgung vorhanden<br />
ist und Patienten wochenlang auf einen<br />
CT- oder MR-Termin warten müssen, weil<br />
die Krankenkassen sparen müssen, ist es<br />
grotesk, eine so hohe Summe in ein Projekt<br />
zu stecken, dessen Nutzen nicht einmal<br />
von Experten quantifizierbar und somit<br />
mehr <strong>als</strong> zu hinterfragen und zu bezweifeln<br />
ist“, kritisiert Steinhart. Für den<br />
Kurienobmann ist klar: „Wenn sich der<br />
Gesetzgeber ein derartiges Projekt<br />
wünscht, dann muss er auch für die Kostendeckung<br />
sorgen und allen betroffenen<br />
Einrichtungen das System finanzieren.<br />
Und das darf nicht zulasten der Ärzteschaft<br />
oder der Patienten gehen.“<br />
<strong>ELGA</strong>-Fahrplan<br />
Laut Gesundheitsministerium sollen – sofern<br />
das <strong>ELGA</strong>-Gesetz den Nationalrat passiert<br />
– die technischen Errichtungsarbeiten<br />
für das Großprojekt im Jahr 2012<br />
werden heute – berechtigterweise – in der Medizin ebenso wie auch in industriellen<br />
Bereichen und der Luftfahrt verlangt. Wir Ärztinnen und Ärzte müssen<br />
dies aber genauso von EHealthAnwendungen einfordern: Diese müssen<br />
nachweisbar evidenzbasierend positive Effekte (Patientensicherheit, Komfort)<br />
für den Patienten und den Behandler (Arzt) beziehungsweise andere Gesundheitsdienstleister<br />
(Apotheker, Pflegepersonal, et cetera) zeigen. Die Allokation<br />
der Kosten (der Ausgleich zwischen Einsparungen und anderen Vorteilen für<br />
die Solidargemeinschaft und den Kosten und dem Aufwand bei uns Ärztinnen<br />
und Ärzten) muss fair sein, der Entwicklungs und Einführungsaufwand<br />
(Kosten, Einschulung) muss in einem vertretbaren Kosten/NutzenVerhältnis<br />
stehen, die Investitionen müssen nachhaltig sein.<br />
Wie geht es weiter?<br />
An unsere Wünsche und unseren Bedarf gut angepasste EHealthAnwendungen<br />
können unsere ärztliche Arbeit effektiv unterstützen. Wir Ärztinnen und<br />
Ärzte <strong>als</strong> „Endkunden“ müssen diese unsere Anforderungen besser formulieren<br />
und artikulieren, um die Entwicklung von für uns und unsere Patienten komfortablen,<br />
sicheren und leistbaren „Endprodukten“ im EHealthBereich zu fördern.<br />
Teilweise noch große legistische Schwächen (<strong>ELGA</strong>-Gesetz) und Defizite im<br />
Verwaltungsbereich (zum Beispiel Versicherungsdatenaktualität) müssen von<br />
coverstory<br />
Am Puls<br />
abgeschlossen sein. Nach umfangreichen<br />
Tests und Pilotprojekten ist geplant, 2013<br />
schrittweise damit zu beginnen, <strong>ELGA</strong> in<br />
den Echtbetrieb überzuleiten. Der Standpunkt<br />
der Ärztekammer ist dabei klar: Bevor<br />
das <strong>ELGA</strong>-Gesetz beschlossen wird,<br />
müssen die Ergebnisse und Erfahrungen<br />
des bis Jahresende 2011 laufenden<br />
E-Medikation-Pilotprojekts abgewartet<br />
werden. Auch die Frage, welche öffentliche<br />
Stelle das nötige Geld für <strong>ELGA</strong> aufbringen<br />
kann, muss eindeutig geklärt<br />
sein. Darüber hinaus brauchen Ärztinnen<br />
und Ärzte Rechtssicherheit und eine eindeutige<br />
Klärung des Haftungsrisikos.<br />
Ob das <strong>ELGA</strong>-Gesetz noch wie geplant vor<br />
dem Sommer beschlossen werden kann,<br />
ist – vor allem nach der massiven Kritik in<br />
der Begutachtungsfrist – zumindest fragwürdig.<br />
Ärztekammerpräsident Dorner ist<br />
überzeugt, dass einem so wichtigen Gesundheitsprojekt<br />
die notwendige Aufmerksamkeit<br />
und vor allem Zeit –<br />
unter Einbeziehung all jener, die die massive<br />
Umstellung betrifft – eingeräumt werden<br />
muss. „Zuerst ein entsprechendes<br />
Kosten-Nutzen-Gutachten in Auftrag zu geben,<br />
anstatt nach österreichischer Art<br />
‚schnell-schnell‘ ein Gesetz zu beschließen,<br />
von dem keiner weiß, was es wirklich<br />
bringen wird“, wäre laut Dorner jedenfalls<br />
„der klügere Weg“. �<br />
Michalek: „Viele<br />
Patienten werden<br />
wollen, dass der<br />
Hausarzt die Opting-Out-Wünsche<br />
eingibt, womit Behandlungszeitverloren<br />
geht“<br />
uns aufgezeigt und von den Verantwortlichen wahrgenommen und korrigiert<br />
werden, um eine solide Basis für EHealthAnwendungen zu schaffen.<br />
Im eigenen Bereich müssen wir mithilfe der bereitstehenden EDVFachleute<br />
durch Standardisierung und Herstellung von Interoperabilität die gemeinsame<br />
Sprache schaffen, in der die für uns wesentlichen Informationen ausgetauscht<br />
werden können, damit die Kommunikation im ärztlichen Bereich in vieler Hinsicht<br />
verbessert werden kann. So können auch schon langjährig bewährte<br />
Wege der gerichteten Kommunikation (MedicalNet, DaMe) weiter optimiert<br />
werden, vielleicht im Sinne einer „<strong>ELGA</strong> light“.<br />
Die besten technischen Voraussetzungen nützen uns und unseren Patienten jedoch<br />
nur, wenn auch die Bereitschaft in der Kollegenschaft besteht, Befunde<br />
überhaupt zu erstellen, und wichtige Informationen bedarfsgerecht für die Zuweisenden<br />
und andere am Behandlungsprozess Teilnehmenden zugänglich gemacht<br />
werden. Hier muss noch an vielen sogenannten „Humanfaktoren“ (zum<br />
Beispiel Dokumentationssysteme, Kommunikationstechniken, Akzeptanz) gearbeitet<br />
werden. Die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen müssen von<br />
der Allgemeinheit getragen werden. Denn für eine ungerichtete Kommunikation,<br />
wie sie in <strong>ELGA</strong> vorgesehen ist, fehlen – derzeit und absehbar noch auf<br />
längere Zeit – die gesetzlichen und gesellschaftlich akzeptierten Voraussetzungen.<br />
25
Service<br />
Mai bis September 2011<br />
Carotissonographie Abschlusskurs<br />
Ort: HanuschKrankenhaus, 1140 Wien, HeinrichCollinStraße 30<br />
Termin: 27. – 28.5.2011<br />
Kursleiter: Univ.Doz. Dr. Reinhold Katzenschlager,<br />
Dr. Ara Ugurluoglu<br />
Kursbeitrag: € 355,- ( € 255,- für Mitglieder des BÖI)<br />
Information und Anmeldung: BÖI – Sekretariat<br />
1200 Wien, Treustraße 43/4/4, Tel. und Fax: +43/1/270 24 57<br />
EMail: sekr@boei.or.at, www.boei.or.at<br />
Wiener Bluttage 2011<br />
Ort: AKH Wien, Hörsaalzentrum Ebene 7<br />
1090 Wien, Währinger Gürtel 1820<br />
Termin: 2. – 4.6.2011<br />
Leitung: Plattform Blut<br />
Information und Anmeldung: Bluttelefon: +43/676/651 05 71<br />
www.wienerbluttage.at<br />
12. Internationaler Kongress für Sportphysiotherapie<br />
(VÖSM & ÖGS)<br />
be part of the future – Wissenschaft und Therapie für den<br />
Spitzenfußball<br />
Ort: Congress Casino Baden, 2500 Baden, KaiserFranzRing 1<br />
Termin: 24. – 25.6.2011<br />
Veranstalter: Vereinigung Österreichischer Sportmasseure<br />
und Sporttherapeuten und Österreichische Gesellschaft<br />
für Sportphysiotherapie (VÖSM & ÖGS) in Kooperation<br />
mit dem Österreichischen FußballBund (ÖFB) und der<br />
Österreichischen Bundessportorganisation (BSO)<br />
Kongressorganisation und Anmeldung:<br />
VÖSM&ÖGS, Bundessport und Freizeitzentrum Südstadt<br />
2344 Maria EnzersdorfSüdstadt, LieseProkopPlatz 1<br />
Tel.: +43/2236/865 875 oder +43/676/700 64 91<br />
E-Mail: office@sportphysiotherapie-sportmassage.at<br />
www.sportphysiotherapiesportmassage.at<br />
10 Jahre APPOLONIA 2020<br />
Arbeitskreis für zahnärztliche Vorsorgemedizin<br />
Termin: 16.9.2011<br />
Praxistag und 5. Assistentinnentag der<br />
ÖGZMK Niederösterreich<br />
Termin: 17.9.2011<br />
Ort: Fachhochschule St. Pölten<br />
3100 St. Pölten, MatthiasCorrinusStraße 15<br />
Themen: Gruppen und Individualprophylaxe<br />
Veranstalter: Landeszahnärztekammer Niederösterreich<br />
Wissenschaftliche Organisation: Dr. Hans Kellner,<br />
Dr. Helmut Haider<br />
Information: ÖGZMK NÖ, Helga Hofinger, Tel.: +43/664/424 84<br />
26, Fax: +43/050511-3109, E-Mail : oegzmknoe.office@kstp.at<br />
Fachausstellung: Medizinische Ausstellungs und<br />
Werbegesellschaft, Iris Bobal, Tel: +43/1/536 6348 D<br />
Fax: +43/1/536 6361 DW, EMail: iris.bobal@media.co.at,<br />
maw@media.co.at, www.maw.co.at<br />
26 5|11<br />
kongresse<br />
Hands on Infiltrationsworkshop 2011<br />
Obere & Untere Extremitäten<br />
Ort: Anatomisches Institut, 1090 Wien, Währinger Straße 13<br />
Termine: 25.6., 17.9., 15.10., 12.11.2011<br />
Veranstalter: LudwigBoltzmannCluster für Rheumatologie, Balneologie und<br />
Rehabilitation<br />
Wissenschaftliche Leitung: Univ.Doz. Dr. Attila Dunky<br />
Information: Ärztezentrale Med.Info, 1014 Wien, Helferstorferstraße 4<br />
Tel.: +43/1/531 1641 DW, Fax: +43/1/531 1661 DW, EMail: azmedinfo@media.co.at<br />
Workshops<br />
Workshop Duplexsonographie des Varizen- und Ulkuspatienten<br />
Termin: 1.10.2011<br />
Workshop Schaumsklerosierung<br />
Termin: 12.11.2011<br />
Workshop Ultraschallgezielte Punktionstechnik<br />
Termin: 19.11.2011<br />
Workshop Phlebochirurgie im St. Josef-Krankenhaus in Wien<br />
Termin: 2.12.2011<br />
Ort: Institut für funktionelle Phlebochirurgie, 3390 Melk, Himmelreichstraße 15<br />
Information und Anmeldung: Tel. und Fax: +43/2672/889 96<br />
E-Mail: office@tagungsmanagement.org<br />
www.phlebologieaktiv.org, www.tagungsmanagement.org<br />
Kongress Essstörungen 2011 – Eating Disorders 2011<br />
19. Internationale Wissenschaftliche Tagung<br />
Ort: Alpbach<br />
Termin: 20. – 22.10.2011<br />
Wissenschaftliche Leitung: Univ.Prof. Dr. Günther Rathner<br />
Kongressorganisation: Netzwerk Essstörungen in Zusammenarbeit mit der<br />
Österreichischen Gesellschaft für Essstörungen (ÖGES) und der Medizinische Universität<br />
Innsbruck, Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie<br />
Information: Netzwerk Essstörungen, 6020 Innsbruck, Templstraße 22<br />
Tel.: +43/512/57 60 26, Fax: +43/512/58 36 54, EMail: info@netzwerkessstoerungen.at<br />
www.netzwerkessstoerungen.at<br />
47. Jahrestagung der Österr. Gesellschaft für Neurochirurgie<br />
Ort: Aula der Wissenschaften, 1010 Wien, Wollzeile 27<br />
Termin: 7. – 8.10.2011<br />
Themen: Risiko Geschlecht – „Geschlechtsspezifische Unterschiede in Prävalenz und<br />
Therapie von neurochirurgischen Erkrankungen“<br />
Veranstalter: Österreichische Gesellschaft für Neurochirurgie, www.neurochirurgie.ac.at<br />
Tagungspräsident: Prim. Univ.Doz. Dr. Günther Kleinpeter<br />
Tagungssekretär: Dr. Camillo Sherif, Tel.: +43/1/711 6594377 DW<br />
Fax: +43/1/711 654309 DW<br />
Organisation: Neurochirurgische Abteilung, Krankenanstalt Rudolfstiftung<br />
Information: Ärztezentrale Med.Info, 1014 Wien, Helferstorferstraße 4<br />
Tel.: +43/1/531 1638 DW, Fax: +43/1/531 1661 DW, EMail: azmedinfo@media.co.at<br />
www.aulawien.at
ZAFI – Zahnärztliche Fortbildung<br />
der Landeszahnärztekammer für Wien, 1060 Wien, Gumpendorferstraße 83/4<br />
Tel.:+43/1/597 33 57/10-12 DW, Fax:13 DW, E-Mail: spitzhuetl@zafi.at, girkinger@zafi.at<br />
Schwerpunkt Implantologie<br />
Implantologie Live OP – Kurse – Planungs-Jour-fixe<br />
Dr. Christian Schober, Wien<br />
jeweils 14.00 – 17.00 Uhr<br />
Kursserie 2 : 23.9., 14.10., 25.11.2011<br />
Kieferorthopädische Studiengruppe<br />
Dr. Doris Haberler, Dr. Michael Meissl, Wien<br />
Termine: jeweils Donnerstag 19.00 – 21.00 Uhr<br />
9.6., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12.2011<br />
Diplomausbildung KFO<br />
DDr. Alexandra Bodmann, Wien<br />
Termine: jeweils 9.00 – 18.00 Uhr<br />
24. – 26.6.,16. – 18.9., 7. – 9.10., 4. – 6.11., 2. – 4.12.2011, 20. – 22.1., 17. – 19.2.,<br />
16. – 18.3.2012<br />
Technikerausbildung für FGB-Geräte<br />
DDr. Alexandra Bodmann, Wien<br />
Termine: Technik 2: 18.6.2011, jeweils 9.00 – 18.00 Uhr<br />
Super Crash Kurs: Technik 3: 25.6.2011<br />
Fotodokumentation (Seminar für Assistentinnen)<br />
Dr. Gerhard Schager, Wien<br />
27.5.2011, 9.00 – 18.00 Uhr<br />
Frontzahnästhetik in Perfektion mit Keramikveneers und<br />
Ästhetische Behandlungsplanung – Praktischer Arbeitskurs<br />
Prof. Dr. Jürgen Manhart, München<br />
1. – 2.7.2011<br />
Curriculum Lappen- und Nahttechniken in oraler Chirurgie<br />
Teil 1: Lappen und Nahttechniken in der oralen Chirurgie<br />
Univ.Prof. DDr. Peter Solar, Wien<br />
21.5.2011, 9.00 – 18.00 Uhr<br />
Endodontie-Intensivkurs<br />
Dr. Johann Reichsthaler, Dr. Mario Castro, Wien<br />
27. – 28.5.2011<br />
Notfallsonographie Basiskurs – nach den Richtlinien der ÖGUM<br />
Abdomensonographie – Echokardiographie – Gefäßsonographie<br />
Ort: Fortbildungszentrum, 1200 Wien, Treustraße 43/4/4<br />
Termin: 30.9. – 1.10.2011<br />
Kursleiter: Univ.Prof. Dr. Gebhard Mathis, Univ.Prof. Dr. Thomas Binder<br />
Information und Anmeldung: BÖI – Sekretariat, 1200 Wien, Treustraße 43/4/4<br />
Tel. und Fax: +43/1/270 24 57, EMail: sekr@boei.or.at, www.boei.or.at<br />
Transösophagele Echokardiographie (TEE)<br />
Ort: Fortbildungszentrum, 1200 Wien, Treustraße 43/4/4<br />
Termin: 16.9.2011<br />
Kursleiter: Univ.Prof. Dr. Thomas Binder<br />
Information und Anmeldung: BÖI – Sekretariat, 1200 Wien, Treustraße 43/4/4<br />
Tel. und Fax: +43/1/270 24 57, EMail: sekr@boei.or.at, www.boei.or.at<br />
kongresse<br />
Service<br />
September bis November 2011<br />
Jahrestagung 2011 der Österreichischen Gesellschaft für<br />
Pneumolgie<br />
Ort: Reed Messe Wien<br />
Termin: 8. – 10.9.2011<br />
Tagungsleitung: Prim. Univ.Prof. Dr. Otto C. Burghuber<br />
Information: Ärztezentrale Med.Info, 1014 Wien, Helferstorferstraße<br />
4, Tel.: +43/1/531 1638 DW, Fax: +43/1/531 1661<br />
DW, EMail: azmedinfo@media.co.at, www.ogp.at<br />
Kongresssekretariat und Anmeldung: Wiener Medizinische<br />
Akademie, 1090 Wien, Alser Straße 4, Tel.: +43/1/405 13 830<br />
Fax: +43/1/407 82 74, EMail: ogp2011@medacad.org<br />
. Jahrestagung der Österreichischen<br />
Vereinigung für Notfallmedizin – AAEM<br />
Ort: Allgemeines Krankenhaus Wien – Hörsaalzentrum<br />
1090 Wien, Währinger Gürtel 1820<br />
Termin: 9.9.2011<br />
Hauptthemen: Die Notfallabteilung, Zeitkritische Krankheitsbilder<br />
in der NFA, Spezielle Herausforderungen für die Arbeit in der NFA<br />
Organisation: Univ.Prof. Dr. Anton Laggner, Univ.Prof. Dr.<br />
Wolfgang Schreiber<br />
Information: Ärztezentrale Med.Info, 1014 Wien, Helferstorferstraße<br />
4, Tel.: +43/1/531 1648 DW, Fax: +43/1/531 1661 DW<br />
EMail: azmedinfo@media.co.at, www.aaem.at<br />
Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für<br />
Allergologie und Immunologie (ÖGAI)<br />
Ort: Kulturzentrum Minoriten, 8020 Graz, Mariahilferplatz 3<br />
Termin: 15. – 17.9.2011<br />
Tagungspräsident: Univ.Prof. Dr. Winfried Graninger<br />
Information: Ärztezentrale Med.Info, 1014 Wien, Helferstorferstraße<br />
4, Tel.:+43/1/531 1633 DW, Fax.:+43/1/531 1616 DW,<br />
EMail: azmedinfo@media.co.at<br />
Echokardiographie Grundkurs I + II<br />
Ort: Fortbildungszentrum, 1200 Wien, Treustraße 43/4/4<br />
Termin: Teil I: 23. – 24.9.2011, Teil II: 4. – 5.11.2011<br />
Kursleiter: Univ. Prof. Dr. Thomas Binder<br />
Kursbeitrag: € 495,- pro Kursteil (€ 395,- für Mitglieder des BÖI)<br />
Information und Anmeldung: BÖI – Sekretariat<br />
1200 Wien, Treustraße 43/4/4, Tel. und Fax: +43/1/270 24 57<br />
EMail: sekr@boei.or.at, www.boei.or.at<br />
XXIV th International Symposium on Pediatric Surgical<br />
Research<br />
Ort: Graz – Congress, 8010 Graz, Messeplatz 1<br />
Termin: 9. – 10.9.2011<br />
Wissenschaftliche Leitung: Univ.Prof. Dr. Michael E. Höllwarth<br />
Themenschwerpunkte: Pediatric Surgical Research, Evidence<br />
Based Clinical Research in Pediatric Surgery, Minimal Access<br />
Surgery, Gastrointestinal and Colorectal Surgery, uvm.<br />
Information: Ärztezentrale Med.Info, 1014 Wien, Helferstorferstraße<br />
4, Tel.: +43/1/531 1641 DW, Fax: +43/1/531 1661<br />
DW, EMail: azmedinfo@media.co.at<br />
27
ONKOLOGIE<br />
Service<br />
28 5|11<br />
medizin<br />
Studie mit neuem Medikament gegen Prostatakrebs<br />
Krainer: „Die gemeinsameAnwendung<br />
von immunmodulatorischen<br />
Medikamenten und<br />
Docetaxel könnte<br />
einen Tumor von<br />
zwei Seiten gleichzeitig<br />
angreifen“<br />
Ein neuer Typ von Medikamenten für die Behandlung des hormonresistenten<br />
Prostatakarzinoms wird derzeit von der Arbeitsgruppe Urologische Tumore an<br />
der Wiener Universitätsklinik für Innere Medizin I untersucht. Im Rahmen einer<br />
klinischen Studie wird die derzeit übliche Chemotherapie mit einem neuen<br />
Wirkstoff – Lenadolimid – kombiniert.<br />
� „Wir hoffen darauf, damit die Wirkung eine mögliche Wirksamkeit dieser Subs-<br />
der medikamentösen Therapie beim Prostanzklasse geliefert.<br />
tatakarzinom erhöhen zu können“, sagte Die neue Studie ist eine große Untersu-<br />
der Koordinator der Studiengruppe, Michung der Phase III auf Wirksamkeit. Die<br />
chael Krainer, gegenüber der Austria Pres- Probanden erhalten zusätzlich zur etablierse<br />
Agentur.<br />
ten Chemotherapie mit der Substanz Doce-<br />
Lenadolimid gehört zu den sogenannten taxel sowie Cortison auch noch zusätzlich<br />
Immunmodulatoren. Der Wirkstoff ist ähn- die neue Substanz. Immunmodulatorische<br />
lich dem Contergan-Wirkstoff Thalidomid. Medikamente wirken auf vielfältige Weise.<br />
Lenadolimid ist aber wesentlich wirksamer Sie können natürliche Killerzellen gegen Tu-<br />
und hat ein besseres Verträglichkeitsprofil more aktivieren oder auch die Entstehung<br />
<strong>als</strong> die Muttersubstanz. In der Anwendung von Blutgefäßen in Tumoren hemmen.<br />
beim Prostatakrebs gibt es natürlich kein Krainer: „Sie wirken auf ganz andere Weise<br />
Missbildungsrisiko für Ungeborene. Das <strong>als</strong> das etablierte Chemotherapeutikum<br />
Medikament wurde vom US-Unternehmen Docetaxel. Die gemeinsame Anwendung<br />
Celgene entwickelt und bereits im Jahr beider Mittel könnte einen Tumor <strong>als</strong>o von<br />
2007 in der EU zur Behandlung von Kno- zwei Seiten gleichzeitig angreifen.“<br />
chenmarkkrebs zugelassen. Bei der Be- Insgesamt werden weltweit mehr <strong>als</strong> 1000<br />
handlung von Prostatakarzinomen, die auf Patienten in diese Studie aufgenommen.<br />
die herkömmliche antihormonelle Thera- Österreich ist mit vier Zentren beteiligt –<br />
pie nicht oder nicht mehr ansprechen, ha- neben dem Wiener AKH auch das Kranben<br />
erste klinische Studien Hinweise auf kenhaus der Barmherzigen Brüder in der<br />
In Österreich fehlt eine adäquate Krebsrehabilitation<br />
In Österreich erkranken pro Jahr in etwa 36.000 Menschen an Krebs.<br />
300.000 Patienten leben mit dieser Diagnose. Doch ausreichende Rehabilitationsangebote<br />
nach der eigentlichen Therapie auf Sozialversicherungskosten<br />
gibt es für sie fast nicht. „Wir würden pro Jahr einige Tausend Plätze benötigen“,<br />
klagt Chris<strong>top</strong>h Wiltschke von der Klinischen Abteilung für Onkologie<br />
der Wiener Universitätsklinik für Innere Medizin I.<br />
Der Fachmann über die in Österreich offenbar existierende Diskrepanz zwischen<br />
von Spitalerhaltern und Krankenkassen bezahlter Therapie bei Krebserkrankungen<br />
und den mangelnden speziellen Rehabilitationskapazitäten: „Manche<br />
Krebstherapien kosten mehrere 100.000 Euro. Da ist das Geld da. Drei<br />
Wochen onkologische Rehabilitation kosten 5000 bis 6000 Euro. Wir sitzen<br />
permanent an einer Stelle, an der wir Menschen etwas geben wollen, was<br />
eine dramatische Besserung ihrer Lebensqualität ermöglicht, können es aber<br />
nicht.“<br />
Dahinter stecken offenbar zwei verschiedene Ursachen. Wiltschke, seit 30<br />
Jahren in der Krebsmedizin tätig, über historische Gründe: „Es war lange Zeit<br />
so, dass Krebserkrankungen sehr rasch und sehr rasch tödlich verliefen,<br />
wenn man sie nicht im Frühstadium durch Operation heilen konnte. Das hat<br />
sich in den vergangenen 20 Jahren geändert. Wir haben jetzt 80 Prozent der<br />
Patienten, die entweder gesund werden oder sehr lange krank sind. Da<br />
braucht man eine Art Übergangsbehandlung mit Physiotherapie, psychologischer<br />
und sozialmedizinischer Betreuung. Das kann man nicht an medizi<br />
Bundeshauptstadt und je ein Zentrum in<br />
Salzburg und Graz.<br />
Prostatakrebs ist weltweit die dritthäufigste<br />
Krebsart und unter Männern weltweit<br />
die sechsthäufigste Todesursache aller<br />
Krebsarten. Jedes Jahr wird bei 670.000<br />
Männern Prostatakrebs diagnostiziert.<br />
Prostatakrebs machte im Jahr 2008 bei<br />
den Männern in Österreich mit ungefähr<br />
4400 Fällen ein knappes Viertel aller bösartigen<br />
Neubildungen aus.<br />
In etwa jeder neunte Krebstodesfall war<br />
bei den Männern auf Prostatakrebs zurückzuführen.<br />
Die Rate der Sterblichkeit<br />
an Prostatakrebs reduzierte sich in den<br />
vergangenen zehn Jahren in Österreich<br />
aber um 22 Prozent. Eine mögliche Erklärung<br />
wären die vermehrten Früherkennungsuntersuchungen<br />
inklusive Bluttests<br />
auf PSA. �<br />
Service: Die Wissenschafter suchen Probanden.<br />
Interessenten wird die Kontaktaufnahme<br />
mit dem Koordinationsbüro<br />
(Medizinische Universität Wien, Dagmar<br />
Liebhart, Tel.: 40 400/572 DW, zur<br />
Klärung der Eignung für die Studienteilnahme<br />
empfohlen.<br />
nischen Zentren machen. Es gibt zahllose Studien, die gezeigt haben, dass<br />
man durch Rehabilitation die Lebensqualität der Betroffenen dramatisch verbessern<br />
kann.“ Es ginge darum, den Krebspatienten so zu helfen, dass sie „in<br />
ihr Leben zurückkommen“ könnten.<br />
Hinzu kommt – so der Onkologe – eine Sozi<strong>als</strong>ystemproblematik: Die Rehabilitation<br />
wird nicht von den Krankenkassen, sondern von der Pensionsversicherungsanstalt<br />
gewährleistet. Dort wurden traditionell wiederum am ehesten<br />
„organspezifische“ Rehabilitationseinrichtungen geschaffen: für Herz-KreislaufPatienten<br />
sowie für Kranke mit Leiden des Bewegungs und des Stützapparats.<br />
Für das breite Feld der Krebserkrankungen – hier bildet beispielsweise<br />
die Psychoonkologie eine Klammer über für einzelne Erkrankungen<br />
spezielle Rehabilitationsmaßnahmen hinweg – gibt es in Österreich nur einige<br />
wenige Einrichtungen.<br />
Wiltschke: „Wir müssten uns nur ziemlich gute Beispiele aus Ländern wie<br />
Deutschland, Frankreich, Italien und den USA ansehen. Hier haben wir in Österreich<br />
einen gewissen Nachholbedarf.“ Dies klingt nach Untertreibung. Der<br />
Onkologe: „In Deutschland gibt es mehr <strong>als</strong> 50 Kliniken, die onkologische Rehabilitation<br />
machen.“ Bei einer Informationsveranstaltung im Februar 2010 in<br />
Wien war gar von in Deutschland 200 Vertragskliniken für diesen Bereich und<br />
pro Jahr dort durchgeführten 150.000 Rehabilitationsmaßnahmen die Rede.<br />
Ohne Änderungen der Rahmengesetzgebung in Österreich werde hier kaum<br />
eine Änderung der Situation zu schaffen sein, meinte der Fachmann.
VORSORGE<br />
� Die Wissenschafter haben ihre Studie<br />
in der Fachzeitschrift Vaccine publiziert.<br />
Der Hintergrund: Im August 2007 begann<br />
in Österreich im Rahmen des kostenlosen<br />
Impfprogramms für Kinder der breite Einsatz<br />
der Vakzine gegen Rotavirus-Infektionen.<br />
Die Erreger lösen vor allem bei Babys<br />
schwere Durchfallerkrankungen aus,<br />
die sogar eine Aufnahme im Krankenhaus<br />
notwendig machen können.<br />
Weltweit rechnet man mit jährlich 111<br />
Millionen Rotavirus-Erkrankungen bei<br />
Kindern im Alter bis zu fünf Jahren, in Europa<br />
mit 2,8 Millionen. Während schlechte<br />
Versorgung in den Entwicklungsländern<br />
für den Großteil der weltweit ungefähr<br />
440.000 Todesfälle verantwortlich ist, betrug<br />
die Mortalitätsrate in Österreich bei<br />
geschätzten jährlichen 44.900 Infektionen<br />
1:54.000. Doch: Bei einer Hospitalisierung<br />
kann man mit 1500 bis 2400 Euro an<br />
Kosten rechnen. In der ambulanten ärztlichen<br />
Betreuung sind es 140 bis 200<br />
Euro. Die indirekten Kosten, wenn die<br />
Mutter zwei Tage zu Hause bleibt, liegen<br />
bei ebenfalls mindestens mehr <strong>als</strong> 100<br />
Euro. Jährlich wurden in Österreich ehem<strong>als</strong><br />
an die 5000 Kinder mit schweren Rotavirus-Darminfektionen<br />
im Spital aufgenommen.<br />
Das dürfte um die zehn Millionen<br />
Euro gekostet haben.<br />
Diese Problematik konnte mit der Rotavirus-Impfung<br />
in Österreich jedenfalls erfolgreich<br />
bekämpft werden. Kollaritsch:<br />
„Im Jahr 2008 waren bereits 87 Prozent<br />
der Kinder durch Impfung vor der Infektion<br />
geschützt. Gleichzeitig reduzierte sich<br />
die Zahl der Spit<strong>als</strong>aufnahmen um 74 Prozent<br />
in der Altersgruppe der im Beobachtungszeitraum<br />
impfbaren Kinder.<br />
Ersparnis von Kosten<br />
Kollaritsch und die weiteren Autoren der<br />
Studie: „Die Rotavirus-Impfkampagne im<br />
Rahmen des öffentlichen Kinder-Immunisierungsprogramms<br />
hat im Jahr 2009 zu<br />
einem weiteren Rückgang der Hospitalisierungen<br />
wegen solcher Infektionen geführt.<br />
Diese Abnahme erfolgte nicht nur in<br />
der Gruppe der immunisierten Kinder,<br />
sondern auch bei den Kindern, welche<br />
medizin<br />
Service<br />
Rotavirus-Impfung schützt auch nicht immunisierte Kinder<br />
Die Rotavirus-Impfung wirkt. Sie hat in Österreich zu einer drastischen Reduktion<br />
der Spit<strong>als</strong>aufnahmen von Kindern wegen schwerer Durchfallerkrankungen<br />
durch Rotavirus-Infektionen geführt. Und sie schützt in Form einer<br />
„Herdenimmunität“ sogar ungeimpfte Babys, weil die Erreger nicht mehr so<br />
oft „im Umlauf“ sind. Dies haben jetzt Experten des Instituts für Spezifische<br />
Prophylaxe und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien unter Herwig<br />
Kollaritsch nachgewiesen.<br />
Daten und Fakten<br />
Die an der Studie beteiligten Fachleute beobachteten<br />
die Entwicklung rund um die<br />
RotavirusInfektionen in Österreich weiter<br />
und analysierten die Daten aus dem Jahr<br />
2009 im Vergleich zum Zeitraum 2001 bis<br />
2005 (vor der Impfung) und zum Jahr<br />
2008.<br />
Hier die Ergebnisse:<br />
n Im ganzen Jahr 2009 wurden hochgerechnet<br />
1441 Kinder (bis 15 Jahre)<br />
wegen RotavirusInfektionen in österreichischen<br />
Spitälern aufgenommen.<br />
Vor Einführung der Impfung waren es<br />
im Durchschnitt etwa 4500 bis 5000<br />
Kinder, die pro Jahr wegen dieser Erkrankung<br />
im Spital landeten.<br />
n Bei den Kindern unter zwölf Monaten<br />
gab es eine Reduktion der Krankenhausaufnahmen<br />
um 79 Prozent im Vergleich<br />
zur Zeit vor der Impfung, und<br />
2009 noch einmal um minus 30 Prozent<br />
im Vergleich zum Jahr 2008.<br />
n In der Altersgruppe zwischen einem<br />
und zwei Jahren reduzierte sich die<br />
Zahl der RotavirusHospitalisierungen<br />
um 76 Prozent im Vergleich zur Zeit vor<br />
der Impfung und um 72 Prozent im<br />
Vergleich zu 2008.<br />
n Bei den Kindern zwischen zwei und<br />
fünf Jahren verringerte sich die Hospitalisierungsrate<br />
um 35 Prozent und um<br />
45 Prozent im Vergleich zu 2008. Da<br />
diese Kinder niem<strong>als</strong> gegen die Infektion<br />
geimpft wurden, sind die Reduktion<br />
der Erkrankungszahlen in dieser Gruppe<br />
Ausdruck eines indirekten Schutzes<br />
durch die bereits geimpften Kinder<br />
(„Herdenimmunität“).<br />
noch zu jung oder bereits zu alt für die<br />
Impfung waren. Das signalisiert eindeutig<br />
eine ‚Herdenimmunität‘“ (siehe Kasten).<br />
Eindeutig belegt ist damit der extrem positive<br />
Effekt der Rotavirus-Impfung in Österreich.<br />
Vor allem die Spit<strong>als</strong>erhalter – zumeist<br />
die Bundesländer – ersparen sich<br />
dadurch hohe Kosten. Experten fordern allerdings<br />
seit Jahren auch die Aufnahme der<br />
Baby-Pneumokokken-Impfung in das Programm<br />
der öffentlichen Hand. Dies scheiterte<br />
bislang aus Kostengründen. Österreich<br />
liege hier hinter den meisten vergleichbaren<br />
und auch ärmeren Ländern<br />
zurück, wurde betont. Pneumokokken-<br />
Infektionen können zu lebensgefährlichen<br />
Komplikationen führen. Auch die Empfehlung<br />
des Impfausschusses des Obersten Sanitätsrates,<br />
zumindest die österreichischen<br />
Mädchen gegen das Human Papilloma Virus<br />
(HPV) zur Verhinderung von Gebärmutterh<strong>als</strong>krebs<br />
kostenlos zu impfen, wurde<br />
bisher österreichweit nicht umgesetzt.<br />
Erhebliche Impflücken<br />
Wie überhaupt das in Österreich von Politikern<br />
häufig beschworene „beste Gesundheitswesen<br />
der Welt“ scheinbar auf die<br />
Impfungen, und hier speziell bei Kindern,<br />
gerne vergisst.<br />
Auch bei den Gratiskinderimpfungen, wie<br />
Masern/Mumps/Röteln, liegt Österreich<br />
nämlich deutlich hinter den von der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) geforderten<br />
Durchimpfungsraten. Ursula Wiedermann-Schmidt,<br />
Leiterin des Instituts für<br />
Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin<br />
der Medizinischen Universität Wien:<br />
„Die Ursachen dafür dürften vielschichtig<br />
sein. Zum einen haben viele Infektionskrankheiten,<br />
die mit den Impfungen erfolgreich<br />
bekämpft wurden, ihren Schrecken<br />
verloren. Dadurch sind heutzutage<br />
leider die Ängste vor Impfnebenwirkungen<br />
größer <strong>als</strong> vor den Erkrankungen. Darüber<br />
hinaus lehnen manche Bevölkerungsgruppen<br />
kategorisch aus religiösen oder<br />
philosophischen Gründen, zum Beispiel<br />
Anthroposophen, Impfungen ab. Sozial<br />
schlechtergestellte Personen haben nicht<br />
immer ausreichenden Zugang zur Impfversorgung,<br />
besonders wenn es sich um<br />
Impfungen handelt, die nicht im Gratisimpfkonzept<br />
enthalten sind.“ �<br />
Kollaritsch: „Im<br />
Jahr 2008 waren<br />
bereits 87 Prozent<br />
der Kinder durch<br />
Impfung gegen<br />
Rotavirus-Infektionen<br />
geschützt“<br />
Wiedermann-<br />
Schmidt: „Heutzutage<br />
fürchtet man<br />
sich mehr vor Impfnebenwirkungen<br />
<strong>als</strong> vor den Krankheiten“<br />
2
MOLEKULARBIOLOGIE<br />
Service<br />
0 5|11<br />
medizin<br />
Neuer Weg zur Aktivierung des bakteriellen Immunsystems entdeckt<br />
Charpentier: „Wir<br />
konnten feststellen,<br />
dass der Mechanismus<br />
die Bakterien<br />
auch vor der Übertragung<br />
weiterer<br />
Krankheitsfaktoren<br />
durch Viren<br />
schützt“<br />
PSYCHIATRIE<br />
Auch Mikroorganismen können durch Viren infiziert werden. Sie entwickeln dabei<br />
Abwehrmechanismen, um feindlichen Angriffen zu widerstehen. Ein wichtiger<br />
Teil der Aktivierung des mikrobiellen Immunsystems ist die Reifung kurzer<br />
RNA-Moleküle (crRNAs).<br />
� Emmanuelle Charpentier, ehem<strong>als</strong> nannte Spacer – Abschnitte, die spezifisch<br />
Gruppenleiterin an den Max F. Perutz La- fremde Gene erkennen und deren Zerstöboratories<br />
(MFPL) der Universität Wien rung bestimmen. Der CRISPR/Cas-Mecha-<br />
und jetzt am schwedischen Laboratory for nismus ist erst seit wenigen Jahren be-<br />
Molecular Infection Medicine Sweden kannt, viele Details um seine Regulation<br />
(MIMS) der Universität Umea tätig, hat ge- und Mechanismen sind noch unklar. Völlig<br />
meinsam mit ihrem Team und den Kolle- neue Erkenntnisse lieferte nun die Forginnen<br />
und Kollegen am Institut für Moleschungsgruppe von Charpentier.<br />
kulare Infektionsbiologie (IMIB) der Uni- Wenn Bakterien und Archaeen Virus- oder<br />
versität Würzburg einen neuen Weg zur Plasmid-Angriffen ausgesetzt sind, werden<br />
Aktivierung der crRNAs gefunden. kurze Stücke der feindlichen DNA in das<br />
Die in Nature präsentierten Ergebnisse Bakterium injiziert und in den CRISPR-Gen-<br />
werfen neues Licht auf die Übertragung komplex eingebaut. Diese Veränderung des<br />
von Virulenz bei Krankenhauskeimen und Genoms führt zur Umprogrammierung der<br />
die Immunität von Bakterienstämmen bei mikrobiellen Wirtszelle, welche die einge-<br />
der Herstellung von Milchprodukten. Der bauten Genabschnitte <strong>als</strong> immunologisches<br />
Hintergrund: Um sich gegen eine Infektion Gedächtnis nutzt und der Zelle auch Immu-<br />
zu schützen, entwickeln Mikroorganismen nität gegen künftige Infektionen mit den<br />
ein ausgeklügeltes Abwehrsystem. CRISPRs gleichen feindlichen Genen verleiht.<br />
(Clustered Regularly Interspaced Short Pa- Nach dem Einbau kommt es zur crRNAlindromic<br />
Repeats) sind Genabschnitte für Reifung, wobei der veränderte genomische<br />
ein Protein (Cas) und zusätzliche soge- CRISPR-Komplex in der Wirtszelle in RNA-<br />
Experten fordern Ansätze in Richtung integrierte Therapie<br />
Musalek: „Die<br />
‚Zwei-Welten-Theorie‘<br />
einer Trennung<br />
von Psyche und<br />
Körper ist nicht<br />
mehr aufrechtzuerhalten“<br />
Ein Viertel der Menschen entwickelt in ihrem Leben eine psychiatrische Erkrankung.<br />
Im Vergleich dazu werden Psychiatrie und deren Patienten von Gesellschaft<br />
und Politik oft stiefmütterlich behandelt. Eine Gegendarstellung<br />
dazu bot der Europäische Kongress für Psychiatrie vom 12. bis 15. März 2011<br />
im Austria Center Vienna.<br />
� Michael Musalek, Präsident der Öster- zur Evidenz-basierten Medizin, die zu eireichischen<br />
Gesellschaft für Psychiatrie und ner Human-basierten Medizin werden<br />
Psychotherapie, verwies dazu im Gespräch soll.“ Der Hintergrund: In den vergan-<br />
mit der Austria Presse Agentur auf die Notgenen 15 Jahren gab es in der Medizin,<br />
wendigkeit ausreichender, leicht zugäng- auch in der Finanzierung der Patientenverlicher<br />
und integrierter Therapieangebote. sorgung, eine zunehmende Tendenz dazu,<br />
Der European Congress of Psychiatry (EPA ausschließlich nur das anzuerkennen, was<br />
2011) fand zum ersten Mal in Wien statt. durch medizinische Studien eindeutig be-<br />
Das Motto lautete: „Translating Research wiesen werden konnte (Evidenz).<br />
into Care“. Musalek, der auch Mitglied des Für den Wiener Psychiater greift das aller-<br />
Exekutivkomitees des Europäischen Verdings zu kurz: „Wir müssen von der Diabands<br />
der Gesellschaften für Psychiatrie gnose und Therapie eines ‚Krankheits-<br />
ist, zu den wichtigsten Diskussionsthemen konstrukts‘ wegkommen und hinkommen<br />
bei dem Kongress und in der Psychiatrie zur Berücksichtigung der ganzen Komple-<br />
allgemein: „Eine große Diskussion gibt es xität des einzelnen Patienten.“ Wissen-<br />
Moleküle übersetzt wird. Diese RNA-<br />
Moleküle werden in spezifische Sequenzen<br />
gespalten, und im letzten Schritt der<br />
Immunreaktion, dem sogenannten Stilllegen<br />
der fremden Gene, erkennen diese<br />
kurzen crRNA-Stückchen das Fremdgenom<br />
wieder und führen es der zellulären<br />
Abbaumaschine zur Zerstörung zu.<br />
Bisher ging man davon aus, dass bei allen<br />
Reaktionen dieses Immunsystems die Aktivierung<br />
durch das Cas-Protein ausreicht. Die<br />
neuesten Forschungsergebnisse zeigen aber<br />
jetzt, dass zusätzliche Faktoren im Wirtsgenom<br />
für die Aktivierung des CRISPR-Mechanismus<br />
benötigt werden, die an RNA-Interferenz<br />
bei höheren Organismen erinnern.<br />
„Der neu entdeckte Reaktionsweg schützt<br />
die Bakterien davor, von Phagen abgetötet<br />
zu werden“, sagt Charpentier. „Wir konnten<br />
feststellen, dass dieser Mechanismus<br />
die Bakterien auch vor der Übertragung<br />
weiterer Krankheitsfaktoren durch Viren<br />
schützt, zum Beispiel bei Antibiotikaresistenzen.<br />
Somit könnte CRISPR auch einen<br />
alternativen Ansatz zur Bekämpfung von<br />
resistenten Krankheitserregern in Kliniken<br />
eröffnen.“ �<br />
schaftliche Beweise könnten nur die notwendige<br />
Basis für eine individuelle Betreuung<br />
des Patienten darstellen. So gehe zum<br />
Beispiel die Psychotherapie in Richtung<br />
integrierte Behandlungsformen, die „Zwei-<br />
Welten-Theorie“ einer Trennung von Psyche<br />
und Körper sei nicht aufrechtzuerhalten.<br />
Auch die ehem<strong>als</strong> moderne Konstruktion<br />
eines neuen Fachgebiets, der Psychosomatik,<br />
könne die Erfordernisse nicht<br />
erfüllen. Musalek: „Zwischen Geist und<br />
Körper gibt es keine dritte Ebene, die Psychosomatik.<br />
Es gibt nur den gesamten<br />
Menschen.“<br />
Das wissenschaftliche Programm bei dem<br />
Kongress gestaltete sich aus Plenarvorträgen,<br />
Symposien, Workshops, Pro- und<br />
Kontradebatten sowie Symposien führender<br />
pharmazeutischer Unternehmen. Doch<br />
es ging auch um versorgungspolitische<br />
Fragen. �
H1N1-Vakzine: Österreichs Impfstoff weniger immunogen, aber verträglicher<br />
Perfekt ist nichts in der Medizin: Ständig muss zwischen Wirkung und potenziellen<br />
Nebenwirkungen balanciert werden. So war die in Österreich im Jahr<br />
2009 verwendete A(H1N1)PandemieVakzine von Baxter offenbar etwas weniger<br />
immunogen <strong>als</strong> eine Vakzine von GlaxoSmithKline (GSK), die mit einem<br />
Verstärker (Adjuvans) versetzt war. Dafür verursachte der GSKImpfstoff etwas<br />
mehr Impfreaktionen. Das ist das Ergebnis einer direkten Vergleichsstudie, die<br />
jetzt im Lancet online veröffentlicht wurde.<br />
Im Rahmen der Studie waren die Immunogenität und das Auftreten von Impfreaktionen<br />
von britischen Experten bei ursprünglich aufgenommenen 347 Probanden<br />
aus verschiedenen Altersgruppen verglichen worden. Die Testpersonen<br />
erhielten entweder zweimal die BaxterVakzine (7,5 Mikrogramm Ganzvirus<br />
Partikel aus Zellkulturen <strong>als</strong> Antigen pro Dosis) oder zweimal den Spaltimpfstoff<br />
von GSK (3,75 Mikrogramm Antigeninhalt pro Dosis). Dieser Impfstoff aus der<br />
traditionellen Antigenproduktion mit Hühnereiern kommt mit der halben Antigendosis<br />
aus, ist dafür aber mit dem Adjuvans AS03, ein sogenanntes Squalen<br />
und DLalphaTocopherol, ein Vitamin E, zur Verstärkung der Immunreaktion<br />
versetzt.<br />
Im Rahmen der Influenza-Pandemie 2009 hat es vor allem in Deutschland hef<br />
Ein Leberzirrhose-Marker, der keiner ist<br />
Ein angeblicher Marker für Bindegewebszellen in der Leberzirrhose, der eigentlich<br />
keiner ist: Chris<strong>top</strong>h Österreicher vom Institut für Pharmakologie der<br />
Medizinischen Universität Wien und seine CoAutoren haben jetzt mit der Veröffentlichung<br />
in den Proceedings of the National Academy of Sciences mit einer<br />
bisher vorhandenen Meinung „aufgeräumt“: dass eine Vernarbung des<br />
Organs von Zellen ausgeht, welche den Marker FSP1 aufweisen.<br />
Leberfibrose und Leberzirrhose sind eine häufige Folge von chronischen Leberschädigungen.<br />
Bindegewebszellen sind dafür verantwortlich. Weiters<br />
dachte man, dass dies unter anderem durch eine Umwandlung von Epithelzellen<br />
in Fibroblasten erfolgen würde, ein „Übergang“ von Epithel in Mesenchymalzellen,<br />
was üblicherweise mit dem Marker FSP1 demonstriert wurde.<br />
Österreicher: „Das Fibroblasten-spezifische Protein 1 (FSP1) wurde für einen<br />
wichtigen Marker gehalten, um Bindegewebszellen in vernarbten Organen zu<br />
identifizieren. Man dachte, damit solche fibrotischen Prozesse nachweisen zu<br />
können. Dazu findet man in den Datenbanken über die entsprechende wissenschaftliche<br />
Literatur mehr <strong>als</strong> 19.000 Eintragungen.“<br />
Doch dem ist offenbar bei den chronischen Lebererkrankungen gar nicht so.<br />
Der Wissenschafter: „Wir haben herausgefunden, dass Leberfibroblasten<br />
dieses Protein nie bilden. Im geschädigten Lebergewebe, aber auch in anderen<br />
Organen, tun dies offenbar nur bestimmte entzündungsfördernde Makrophagen.“<br />
Nach dem Umstoßen dieses bisherigen Dogmas wollen die Wissenschafter<br />
jetzt klären, was die Zellen, die FSP1 bilden, wirklich tun.<br />
In eigener Sache<br />
Die unter Service, Medizin veröffentlichten Texte zu medizinischen Themen<br />
basieren auf Meldungen der Austria Presse Agentur. Die Texte sind teilweise<br />
gekürzt wiedergegeben. Davon ausgenommen sind von Ärztinnen und Ärzten<br />
verfasste Artikel, die an die Redaktion gesandt wurden und namentlich gezeichnet<br />
sind.<br />
medizin<br />
Service<br />
tige Diskussionen über das Adjuvans gegeben. Es wird aber seit Jahren millionenfach<br />
auch in anderen Impfstoffen verwendet. Adjuvantien erlauben durch<br />
die Intensivierung der Immunreaktion eine Verringerung der Antigendosis in<br />
Vakzinen. Das kann vor allem bei Influenza-Pandemien wichtig werden, wenn<br />
die Produktion hinter dem Bedarf herhinkt.<br />
Die Hauptergebnisse der Vergleichsstudie: Von 166 Probanden, welche den<br />
BaxterImpfstoff bekommen hatten, wiesen 42 Tage nach der ersten Immunisierung<br />
(21 Tage nach der zweiten) 54 Prozent hohe schützende Antikörperkonzentrationen<br />
gegen A(H1N1) im Blut auf, beim GSKImpfstoff (ebenfalls<br />
166 Probanden) war das bei 91 Prozent der Fall. Nach sechs Monaten war es<br />
bei 59 Prozent der Testpersonen der Fall, welche die BaxterVakzine bekommen<br />
hatten, in der Vergleichsgruppe (GSKVakzine) waren es 83 Prozent.<br />
Karl Nicholson von der Abteilung für Infektionskrankheiten der Universität Leicester<br />
und seine CoAutoren stellen in ihrer Zusammenfassung fest: „Es gab<br />
keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, die mit den Vakzinen in Verbindung<br />
zu bringen gewesen wären. Die GanzVirusVakzine war mit weniger lokalen<br />
und systemischen Impfreaktionen verbunden <strong>als</strong> der adjuvierte Impfstoff.“ Hingegen<br />
wäre eben der adjuvierte Impfstoff immunogener gewesen.<br />
Schonende Blut-Oxygenierung vor Lungentransplantation<br />
Die Lungentransplantation stellt für Patienten im Endstadium chronischer<br />
Lungenerkrankungen die einzige Therapiemöglichkeit dar. Während der Wartezeit<br />
auf ein Spenderorgan – das können auch Wochen sein – führt eine weitere<br />
Verschlechterung der Grunderkrankung häufig zu einer kritischen Situation<br />
mit der Notwendigkeit für eine künstliche Beatmung. Dabei wird intubiert<br />
und der Patient in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Am Wiener AKH konnte jetzt<br />
allerdings ein schonenderes Verfahren eingesetzt werden, bei dem die Betroffenen<br />
wach und einigermaßen mobil bleiben.<br />
Das Verfahren wurde vor Kurzem erstm<strong>als</strong> in Österreich auf der Intensivstation<br />
der Wiener Universitätsklinik für Innere Medizin I verwendet. In Zusammenarbeit<br />
mit der Klinischen Abteilung für HerzThoraxchirurgie der Wiener<br />
Universitätsklinik für Chirurgie wurde durch den Leiter der Intensivstation,<br />
Gottfried Locker, einer 27jährigen Patientin eine neuartige Kanüle implantiert.<br />
Über sie wird venöses, <strong>als</strong>o sauerstoffarmes, Blut entnommen, dann via einer<br />
ECMOMaschine (Extracorporale Membranoxygenierung) mit Sauerstoff angereichert<br />
und wieder zurückgeleitet. Der Vorteil liegt darin, dass eben bei der<br />
Sauerstoffversorgung per ECMO weder eine Intubation noch eine starke Sedierung<br />
erforderlich ist. Dadurch werden Komplikationen – zum Beispiel Infekte<br />
oder zusätzlicher Muskelabbau durch die Immobilität – verhütet.<br />
Die Methode dürfte buchstäblich „gefragt“ sein. Walter Klepetko von der Klinischen<br />
Abteilung für HerzThoraxchirurgie der Wiener Universitätsklinik für<br />
Chirurgie gegenüber der Austria Presse Agentur: „Wir haben in den vergangenen<br />
zwei Jahren zunehmend Patienten sehr spät für Lungentransplantationen<br />
bekommen oder ihr Zustand verschlechterte sich während der Wartezeit<br />
auf ein Organ.“ Das machte teilweise eine Überbrückung mit Beatmung über<br />
Wochen hinweg notwendig. Die ECMOMethode könnte hier deutlich schonender<br />
über solche Zeiträume hinweg eingesetzt werden.<br />
Bei der 27jährigen Patientin allerdings wurde sehr schnell ein Spenderorgan<br />
gefunden. Klepetko: „Die Patientin musste nur drei Tage warten.“ Dann erfolgte<br />
die Transplantation. Am Wiener AKH befindet sich mit der Klinischen<br />
Abteilung für HerzThoraxchirurgie eines der weltweit größten Zentren für<br />
Lungentransplantationen.<br />
1
Service<br />
Ärzte-VIP-Package für den Figaro<br />
2 5|11<br />
melange<br />
Mit Wolfgang Amadeus Mozarts populärster Oper „Le Nozze di<br />
Figaro“ steht im Sommer 2011 ein musikalisches Meisterwerk<br />
auf dem Spielplan der operklosterneuburg. Figaro, ehem<strong>als</strong> Barbier<br />
von Sevilla, nun Kammerdiener des Grafen Almaviva,<br />
möchte die Kammerzofe Susanna heiraten. Doch sind davor von<br />
ihm mit List und Pfiffigkeit noch einige Hindernisse zu bewältigen,<br />
da der Graf selbst ein amouröses Interesse an Susanna hat<br />
und seine Liebe zur Gräfin längst abgekühlt ist. Mit Witz und<br />
weiblichem Raffinement beschließen Susanna und die Gräfin,<br />
den Grafen und seine Schürzenjägerei bloßzustellen.<br />
Versäumen Sie nicht diese amüsante Komödie um Liebe, Begierde,<br />
Lust und Moral.<br />
Mittwoch, 27. Juli 2011, 20.00 Uhr, Kaiserhof Stift Klosterneuburg<br />
Das Ärzte-VIP-Package umfasst: Karte in der 1. Kategorie<br />
In der Pause: Sektempfang im VIPBereich<br />
Parkticket, Programmheft, VIPBetreuung<br />
Preis pro Person: 70 Euro (statt Normalpreis 88 Euro)<br />
Buchung ausschließlich über das Kulturamt Klosterneuburg,<br />
Tel.: 02243/444424, EMail: karten@operklosterneuburg.at<br />
Joseph Kornhäusel: Lustschlösser und Theater<br />
Joseph Georg Kornhäusel, dessen<br />
150. Todestag 2010 begangen wurde,<br />
gilt <strong>als</strong> herausragender Architekt der<br />
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
und <strong>als</strong> einer der wichtigsten österreichischen<br />
Vertreter des Klassizismus,<br />
den er mit lokalen Traditionen verbindet. Sowohl die dem Donaukanal<br />
zugewandte Seite der Inneren Stadt von Wien <strong>als</strong> auch die<br />
zentralen Teile von Baden bei Wien sind wesentlich von ihm geprägt.<br />
1823 bis 1826 plante und errichtete er die Wiener Hauptsynagoge,<br />
den sogenannten Stadttempel.<br />
Die Kunsthistorikerin Bettina Nezval hat sich in ihrem neuen Buch<br />
– 2008 erschien „Villen der Kaiserzeit. Sommerresidenzen in Baden“<br />
– auf Spurensuche nach den von Kornhäusel geplanten<br />
klassizistischen Tempeln und anmutigen Biedermeierschlössern<br />
begeben, die inmitten der Gärten und weitläufigen Parkanlagen<br />
gebaut wurden. Eine besondere Entdeckung ist dabei das klassizistische<br />
Schlosstheater in Feistritz, dessen originale malerische<br />
Ausstattung komplett und unverändert erhalten geblieben ist.<br />
Das Thema Musik und Apollon begleitet den Leser auch in den<br />
tschechischen Schlössern und weitläufigen Parkanlagen von<br />
Eisgrub und Schönwald.<br />
Das Buch ist eine umfangreiche Darstellung der prächtigen<br />
Schlösser, Villen und Theater, die Kornhäusel in Wien, Niederösterreich,<br />
Tschechien und Schlesien errichtet hat.<br />
Service: „Joseph Kornhäusel – Lustschlösser und Theater“ von<br />
Bettina Nezval, Wien. 2010. 132 Seiten, zahlreiche Farb- und s/<br />
w-Abbildungen. ISBN 978-3-85028-504-9. Verlag Berger, Horn<br />
Alan F. Schatzberg erhält Ehrendoktorat der MUW<br />
� Alan F. Schatzberg ist Präsident der krankungen zeigen. Außerdem erarbeitet-<br />
Amerikanischen Psychiatrischen Gesellen sie unterschiedliche Projekte zu Theschaft<br />
und war bis vor Kurzem Chairman men der Aggressionsverarbeitung und<br />
des Department of Psychiatry and Behavio- psychopathologischen Auffälligkeiten bei<br />
ral Sciences der Universität Stanford im Flüchtlingen im adoleszenten Alter. Wei-<br />
US-Bundesstaat California. Ihn verbindet ters wurden auch regelmäßig gemein-<br />
seit ungefähr 20 Jahren eine enge Koopesame Tagungen veranstaltet, bei denen die<br />
ration mit der Medizinischen Universität internationale Qualität der an der MUW<br />
Wien. Gleichzeitig wurden kontinuierlich durchgeführten Behandlungen dargestellt<br />
Nachwuchswissenschafter der MUW geför- wurde.<br />
dert. Aufgrund dieser Verbundenheit und Einen weiteren Schwerpunkt in der Zu-<br />
den daraus gewonnenen wissenschaftsammenarbeit mit der MUW stellt die<br />
lichen Ergebnissen erhielt Schatzberg am Förderung junger Wissenschafter dar.<br />
29. März 2011 das Ehrendoktorat der Me- Dazu zählen Forschungspraktika, die<br />
dizinischen Universität Wien.<br />
Supervision bei Forschungsprojekten so-<br />
Seit Schatzberg 1991 den Lehrstuhl für wie das Mentoring und die Betreuung<br />
Psychiatrie an der Universität Stanford er- bei Diplomarbeiten und Dissertationen.<br />
halten hat, fördert und intensiviert er den Auch aus dieser Zusammenarbeit sind<br />
Kontakt zur MUW. Das hat sich bisher bereits zahlreiche Ergebnisse in interna-<br />
auch in erfolgreichen gemeinsamen Fortional anerkannten Journalen publiziert<br />
schungsprojekten niedergeschlagen. So worden.<br />
konnten beispielsweise Schatzberg und Schatzbergs Werk ist in mehr <strong>als</strong> 550 Pu-<br />
Siegfried Kasper, der Vorstand der Wiener blikationen festgelegt. Er ist Herausgeber<br />
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psy- von namhaften psychiatrischen Lehrchotherapie,<br />
neue und richtungsweisende büchern und darüber hinaus Herausgeber<br />
Therapiemöglichkeiten bei Depressionen<br />
und Bipolaren („manisch-depressiv“) Ervon<br />
amerikanischen und internationalen<br />
wissenschaftlichen Zeitschriften. �<br />
Gesellschaft der Ärzte Wien: Neuer Präsident gewählt<br />
� Der Radiologe Franz Kainberger hat der Ärzte in Wien/Billrothhaus wurde in<br />
vor Kurzem die Agenden von Karl-Heinz der Jahreshauptversammlung für seine<br />
Tragl <strong>als</strong> neuer Präsident der Gesellschaft langjährigen, großen Verdienste zum Se-<br />
der Ärzte/Billrothhaus übernommen. nator auf Lebenszeit ernannt. Tragl wurde<br />
Kainberger ist Präsident des Verbands für auch für seine Verdienste <strong>als</strong> Erbauer und<br />
Medizinischen Strahlenschutz in Österreich erster ärztlicher Direktor des SMZ Ost/<br />
und Radiologe an der Klinischen Abteilung Donauspital und für seine Leistungen zur<br />
Neuroradiologie und muskuloskeletale Ra- Erforschung der Geschichte der Wiener<br />
diologie der Wiener Universitätsklinik für Medizin geehrt.<br />
Radiodiagnostik. Als neu gewählter Präsi- Die Gesellschaft der Ärzte mit Sitz im Billdent<br />
der Gesellschaft der Ärzte in Wien sieht rothhaus in Wien 9. wurde 1837 gegrün-<br />
er seine Aufgaben in der erfolgreichen Weidet. Sie war Zentrum der 2. Wiener Mediziterentwicklung<br />
der Gesellschaft: „Professor nischen Schule und ist bis heute die traditi-<br />
Tragl haben wir viel zu verdanken. Er hat in onsreichste medizinische Gesellschaft<br />
der seit 1837 existierenden Gesellschaft Österreichs. Nobelpreisträger wie Karl<br />
wissenschaftliche Diskussionen wie auch Landsteiner präsentierten hier ihre bahn-<br />
ärztliche Fortbildung auf höchstem Niveau brechenden Arbeiten. Medizinische Grö-<br />
erhalten und ausgebaut. Dieser Kurs soll ßen wie Theodor Billroth oder Carl von<br />
fortgesetzt werden.“ Weitere wesentliche Rokitansky standen der Gesellschaft <strong>als</strong><br />
Schritte sind der Ausbau der Online-Ange- Präsidenten vor. Hauptaufgaben der Gesellbote<br />
zu einem modernen medizinischen schaft der Ärzte sind die Fortbildung und<br />
Wissensmanagement sowie die Kooperation Präsentation neuester medizinischer For-<br />
mit wichtigen Forschungs-, Lehr- und Geschungsergebnisse. Jährlich finden hier<br />
sundheitseinrichtungen in Österreich.<br />
Der scheidende Präsident der Gesellschaft<br />
mehr <strong>als</strong> 130 medizinische Veranstaltungen<br />
mit mehr <strong>als</strong> 6000 Besuchern statt. �
melange<br />
Service<br />
NEUE WEGE FÜR JUNGE ÄRZTE!<br />
Berufen! Die internationale Berufs- und Karriereplattform.<br />
In Kooperation mit Deutschland veranstaltet die Österreichische Ärztekammer eine Jobmesse für angehende Mediziner.<br />
Dieser Termin bietet die Chance, sich über Ausbildungen und Arbeitsbedingungen vorwiegend an deutschen<br />
aber auch an österreichischen Spitälern zu informieren. Nach Vorträgen und Erfahrungsberichten am Vormittag<br />
stehen Vertreter dieser Krankenhäuser persönlich für Gespräche und Fragen an den Messeständen den ganzen Tag<br />
zur Verfügung.<br />
TERMIN:<br />
25. 05. 2011 | 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr<br />
Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien<br />
„WIR ÜBERSCHREITEN GRENZEN“<br />
Für nähere Informationen: Österreichische Ärztekammer | Internationales Büro | Weihburggasse 10 –12 | 1010 Wien |<br />
Tel: 01-514 06 - DW 931 | Tel: 01-514 06 - DW 933 | E-Mail: international@aerztekammer.at und www.arztjobs.at
Service<br />
4 5|11<br />
melange<br />
WEBTIPP: Fragen Patienten zuerst Google, oder doch eher den Arzt?<br />
Von Eva Hribernig,<br />
Webdesignerin in<br />
Wien 3.<br />
Wir wissen, die Zeit des Arztes ist sehr kostbar, und die Zeit, die er dem Patienten<br />
widmen kann, ist limitiert. Die Qualität der im Web zur Verfügung gestellten<br />
Information nimmt zu. So setzen immer mehr Menschen auf Informationen<br />
im Web. Dass Klicks im Web den Arztbesuch nicht ersetzen, ist klar:<br />
Tendenz ist <strong>als</strong>o kein „entweder oder“, sondern es wird immer häufiger sowohl<br />
der Arzt <strong>als</strong> auch das Web konsultiert.<br />
� Wenn ein Patient seine Therapie ver- im Internet nach medizinischer Informatisteht,<br />
ist er auch bereit, die Anweisungen on. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr<br />
und Ratschläge des Arztes zu befolgen. 2011 noch mehr Menschen im Internet<br />
Seit ungefähr 20 Jahren gibt es das Inter- klicken werden, bevor sie einen Arzt aufnet.<br />
Doch in den ersten Jahren waren es suchen – Tendenz steigend.<br />
nur Wissenschafter, die sich via elektronische<br />
Netze Informationen austauschten. Wichtige Marketingmaßnahme<br />
Seit 1993 ist das Internet der Öffentlichkeit Der Informationsbedarf ist groß. Wer<br />
zugänglich, und man kann sagen, dass es Symptome bei sich, bei Angehörigen und/<br />
seit Anfang 2000 einen sehr großen Auf- oder Kollegen entdeckt oder mehr über<br />
schwung erlebt – mit exponentiell stei- eine bereits erstellte Diagnose wissen will,<br />
gender Tendenz. Die Potenziale scheinen konsultiert das Web. Gesucht wird nach<br />
aber noch lange nicht ausgeschöpft zu Informationen wie auch nach einem medi-<br />
sein.<br />
zinischen Spezialisten.<br />
Das Web hat den Austausch von Informati- Die Ärzte verschließen sich diesem Trend<br />
onen revolutioniert. Die Zahlen sprechen nicht: Gemäß einer Untersuchung der<br />
für sich: Laut Pressetext Austria haben 7 deutschen Stiftung Gesundheit geben mehr<br />
Prozent aller Österreicher im Jahr 2001 <strong>als</strong> 68 Prozent der deutschen Ärztinnen<br />
eine medizinische Information im Web und Ärzte an, dass die Internetpräsenz für<br />
eingeholt. Das Netdoktor-Portal beispiels- sie die wichtigste Marketingmaßnahme<br />
weise gibt es seit dem Jahr 2000. Binnen darstellt. Es ist davon auszugehen, dass<br />
kürzester Zeit hat sich dieses Portal <strong>als</strong> sich in Österreich diese Größenordnung<br />
wichtiger Online-Anbieter in Fragen der in einer ähnlichen Höhe bewegt.<br />
Gesundheit etabliert. Gemäß einer Unter- Auch die sozialen Netzwerke wie Facebook<br />
suchung von Fessel GfK im Auftrag der und Twitter sowie einschlägige Foren tra-<br />
Merkur Versicherung suchten im Jahr gen zum Informationsaustausch über<br />
2009 bereits 41 Prozent der Österreicher Symptome und/oder Diagnosen bei. Virtu-<br />
Stellenplattform für Ärzte www.arztjobs.at seit Kurzem online<br />
Die erste österreichische Stellenplattform für Ärzte, www.arztjobs.at, ist seit Kurzem online. Der Jobmarkt ist ein<br />
Service der Österreichischen Ärztekammer in Kooperation mit dem Verlagshaus der Ärzte und der Österreichischen<br />
Ärztezeitung. Aktuelle Stellenausschreibungen sind direkt über die Startseite zugänglich, weiterführende<br />
Links sollen bei der Stellensuche behilflich sein. Die Plattform informiert aber auch über Themen wie „Arbeiten im<br />
Ausland“, gibt Tipps zu Behördenwegen und stellt Erfahrungsberichte von Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung.<br />
Die Suche nach dem perfekten Job wird durch ein ausgeklügeltes, einfach zu bedienendes Suchsystem erleichtert,<br />
das, je nach Eingabe, passende Stellenangebote filtert. Vielfältige Angebote aus Krankenhäusern, für die<br />
Niederlassung und aus der Industrie werden zusammengetragen, um für jeden eine passende Stelle zu<br />
finden. Auch verfügbare Lehrpraxisstellen werden über die Plattform zugänglich gemacht.<br />
Zusätzlich soll mit der Website eine Wissensdatenbank mit rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen<br />
gebildet werden. Auch werden Informationen über Stipendien und sonstige Förderungen aufgelistet. Außerdem<br />
findet man auf der neuen Homepage aktuelle Veranstaltungen, wie internationale Jobmessen, Alumni-Club-Treffen<br />
oder Symposien.<br />
Ziel der Homepage ist, für jeden eine passende Stelle zu finden. Natürlich kann die Jobbörse nur das anbieten,<br />
was gerade ausgeschrieben ist, aber mit etwas Geduld findet sicher jeder irgendwann seinen perfekten Arbeitsplatz.<br />
Mit www.arztjobs.at sollte das nun deutlich einfacher und rascher gehen.<br />
Für Jobsuchende ist die Nutzung der Plattform übrigens kostenlos.<br />
ell ist die Austauschplattform viel größer<br />
<strong>als</strong> früher, <strong>als</strong> es „nur“ die Möglichkeit des<br />
persönlichen und telefonischen Austausches<br />
im eigenen sozialen Umfeld gab. Die<br />
mittlerweile sehr handlichen und leichten<br />
Netbooks sowie das iPad von Apple sind<br />
derzeit voll auf Erfolgskurs und tragen gemeinsam<br />
mit den relativ kostengünstigen<br />
Tarifen fürs Surfen zu einer rasanten Entwicklung<br />
des Webs bei. Zudem nimmt die<br />
Qualität der im Web zur Verfügung gestellten<br />
Information zu. Die Menschen tauschen<br />
Informationen nicht nur aus, sondern bewerten<br />
sie auch, was sich natürlich positiv<br />
auf die Qualität und das Angebot auswirkt.<br />
Seit 2001 gibt es Wikipedia. Viele Millionen<br />
Menschen nutzen Wikipedia, stellen<br />
Informationen hinein und korrigieren beziehungsweise<br />
ergänzen bestehende Beiträge.<br />
Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit,<br />
f<strong>als</strong>chen Informationen aufzusitzen,<br />
relativ klein geworden.<br />
Der heutige Patient denkt mit, er ist interessiert<br />
an konkreten Antworten zu seinen<br />
persönlichen Symptomen und Beschwerden.<br />
Das Wissen nützt ihm, seine Symptome<br />
und Beschwerden zu verstehen, damit<br />
besser umzugehen und zu therapieren.<br />
Nicht alle Webinformationen sind seriös,<br />
aber der kritische und mündige User besucht<br />
nicht nur eine Website, sondern viele<br />
und vergleicht die Informationen, insbesondere<br />
dann, wenn der Leidensdruck<br />
groß ist.<br />
Dass Klicks im Web den Arztbesuch nicht<br />
ersetzen, ist klar. Die Tendenz ist <strong>als</strong>o kein<br />
„entweder oder“, sondern es werden immer<br />
häufiger sowohl der Arzt <strong>als</strong> auch das<br />
Web konsultiert.<br />
Kompetente Internetpräsenz<br />
Ärztinnen und Ärzte erwirtschaften mittlerweile<br />
einen wichtigen Teil ihres Einkommens<br />
außerhalb der von den Krankenkassen<br />
finanzierten Leistungen. Daher nimmt<br />
die Bedeutung für Investitionen in Marketingmaßnahmen<br />
zu. Diese Investitionen betreffen<br />
einerseits Maßnahmen rund um die<br />
Praxis und die Mitarbeiter, andererseits die<br />
Präsenz im Internet. Auch hier ist immer<br />
mehr kein „entweder oder“ zu beobachten,<br />
sondern aus betriebswirtschaftlichem<br />
Interesse wird sowohl in Marketingmaßnahmen<br />
für die Praxis und Mitarbeiter <strong>als</strong><br />
auch in eine kompetente, ansprechende<br />
Internetpräsenz investiert. �
BUCHTIPP: Der Weg in die Ärzte-GmbH/-OG<br />
Service<br />
� Seit August 2010 ist es erlaubt, neben<br />
einer Offenen Gesellschaft (OG) auch eine<br />
Ärzte-GmbH zu gründen.<br />
Die Novellierung des Ärztegesetzes führt zu<br />
zahlreichen gesundheitspolitischen Neuregelungen,<br />
die weit über den berufsrechtlichen<br />
Aspekt hinausgehen. Das vorliegende<br />
Werk will administrative Hürden durch eine<br />
kompakte Darstellung der rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen der verschiedenen<br />
Gesellschaftsarten aus dem Weg räumen.<br />
Die Autoren des Buches erklären interdisziplinär,<br />
welche Bestimmungen aus ärzteund<br />
sozialversicherungsrechtlicher beziehungsweise<br />
gesellschafts- und steuerrechtlicher<br />
Sicht berücksichtigt werden müssen.<br />
BUCHTIPP: Ärztliches Berufsrecht<br />
Service<br />
� Das ärztliche Berufsrecht gehört zum<br />
Kernbereich des Medizinrechts. Dieses<br />
Werk bietet die erste systematische Gesamtdarstellung<br />
und enthält die gesamte<br />
maßgebliche Literatur und Judikatur:<br />
n Arztvorbehalt<br />
n Zugangsbedingungen zum Arztberuf<br />
n ärztliche Ausbildung<br />
n Berufspflichten der Ärztinnen und Ärzte<br />
wie Verschwiegenheits- und Dokumentationspflicht<br />
n Zusammenarbeit von Ärztinnen und<br />
Ärzten, insbesondere auch im Rahmen<br />
von Gruppenpraxen<br />
n Zusammenarbeit von Ärztinnen und<br />
Ärzten mit sonstigen Gesundheitsberufen<br />
BUCHTIPP: Vielschichtiges Medizinrecht<br />
Service<br />
� Absolventen des Postgraduatestudiums<br />
Medizinrecht der Johannes-Kepler-<br />
Universität Linz beleuchten in diesem Sammelband<br />
unterschiedlichste Aspekte des<br />
Medizinrechts, angefangen von Fragen der<br />
Arzthaftung bei zunehmender Ressourcenknappheit,<br />
des Umfangs der ärztlichen<br />
Aufklärungspflicht in der Anästhesiologie<br />
sowie der wechselseitigen Rechte von Arzt<br />
und Patient unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Entscheidungsfähigkeit des Patienten<br />
über eine effektive Selbst- und<br />
Fremdverteidigung des Spit<strong>als</strong>arztes bei<br />
strafgerichtlicher Verfolgung.<br />
Aktuelle Themen wie die rechtlichen Aspekte<br />
der Zusammenarbeit von Ärztinnen<br />
„Der Weg in die ÄrzteGmbH/OG“ von<br />
Thomas Holzgruber, Petra Hübner<br />
Schwarzinger und Werner Minihold, alle<br />
Wien. 2010. 128 Seiten. ISBN 9783<br />
707317725. Linde Verlag, Wien.<br />
Angefangen bei Informationen über berufsrechtliche<br />
Aspekte von Gruppenpraxen,<br />
über einen Fahrplan zur Vergesellschaftung<br />
bis hin zu Techniken des<br />
Rechtsformwechsels und Fragen der Besteuerung<br />
beleuchtet dieses Buch alles,<br />
was man <strong>als</strong> Gesellschaftsgründer wissen<br />
muss. �<br />
„Handbuch Ärztliches Berufsrecht“ von<br />
Felix Wallner, Linz. 2011. 324 Seiten.<br />
ISBN 9783700748335. LexisNexis,<br />
Wien.<br />
n Regelung der ärztlichen Standesvertretung,<br />
insbesondere auch Fragen der<br />
standeseigenen Versorgungseinrichtung<br />
n Disziplinarrecht für Ärztinnen und<br />
Ärzte<br />
Damit liegt ein Behelf für Juristen vor, die<br />
sich mit Fragen des Arztrechts beschäftigen,<br />
aber auch ein umfassendes Nachschlagewerk<br />
für Ärztinnen und Ärzte. �<br />
„Vielschichtiges Medizinrecht“ von Karl<br />
Krückl, Linz (Hrsg.). Mit Beiträgen von<br />
Tanja Buchrucker, Verena Drabauer, Katharina<br />
Hohenecker, Karl Krückl, Stefan<br />
Lehner, Philipp Nill, Michaela Parb und<br />
Michaela Röhle. 2011. XXVI, 461 Seiten.<br />
ISBN 9783854998631. Trauner Verlag,<br />
Linz.<br />
und Ärzten durch Vergesellschaftung sowie<br />
Fragestellungen im Bereich der Arzneimittelwerbung<br />
werden ebenso aufgegriffen<br />
wie Fragstellungen zur ärztlichen<br />
Behandlungspflicht am Lebensende. �<br />
melange<br />
Endliches Leben<br />
Service<br />
Der bei jedem unserer Gespräche mit<br />
Patienten letztlich mitschwingenden Frage<br />
nach der Endlichkeit des Lebens<br />
widmet sich das von Markus Höfner,<br />
Stephan Schaede und Günter Thomas<br />
herausgegebene Buch aus unterschiedlichsten<br />
Blickwinkeln, welche im Rahmen<br />
einer Tagung der evangelischen<br />
Studiengemeinschaft an der Universität<br />
Bochum im Jahr 2008 vorgetragen wurden.<br />
Aus der Vielzahl von philosophischen Beiträgen, welche auch uns<br />
Ärztinnen und Ärzten abseits des Alltags zu neuen, hilfreichen Gedanken<br />
führen können, ragt etwa jener von Dominic Kaegi hervor,<br />
der von den antiken Deutungen bis zu Karl Jaspers dazu ermuntert,<br />
die Endlichkeit abseits einer „Mythologie der Tätigkeiten“ (Edmund<br />
Husserl, 88) wahrzunehmen und dadurch umso empfindlicher<br />
für die gegebene Lebensgrenze zu werden, deren Überschreiten<br />
ebenso „menschlich“ wie irreversibel ist – ein wichtiger<br />
Gedanke, der im Alltag mitunter zu selten mitgedacht werden mag.<br />
Auch so überraschende Aspekte wie beispielsweise ein Endlichkeitsverständnis,<br />
das einen angemessenen Umgang mit der Anti<br />
AgingMedizin ermöglicht (Oliver Müller, 93) oder Peter Hucklenbroichs<br />
Auslotung des Krankheitsbegriffs, der auch auf die<br />
durchaus ambivalenten medizinethischen Konnotationen zum Begriff<br />
„Krankheitswert“ (158) Bezug nimmt, bereichern den Leser.<br />
Anja Hartmanns soziologische Aspekte einschließlich einer auch<br />
durch die Endlichkeitserfahrung bedingten zunehmenden Medikalisierung<br />
der Gesellschaft (201) führt geradezu zwangsläufig<br />
zu ökonomischen Erwägungen, die später von Oliver Rauprich<br />
(229f) umfangreich beleuchtet werden.<br />
Besondere Aktualität und Berufsrelevanz verheißt der Abschnitt<br />
„Heilsame Grenzen“ (ab 310), in welchem zunächst die Endlichkeit<br />
anhand der Pränatalmedizin thematisiert wird. Damit allerdings<br />
scheinen die für die Praxis besonders konkreten Beiträge<br />
leider erschöpft. Unter dieser Kapitelüberschrift hätte man sich<br />
doch zumindest auch einen kompetenten Beitrag zur „anderen<br />
Lebensgrenze“ in Alter und Krankheit erwarten dürfen.<br />
Dass daneben auch christliche Aspekte betont werden, wie beispielsweise<br />
Günter Thomas’ Erwägung zu den Optionen Widerstand<br />
und Ergebung (Dietrich Bonhoeffer) sowie Hans Martin<br />
Dobners seelsorgliche Perspektive, die auch berücksichtigenswerte<br />
Aspekte für Aufklärungsgespräche beinhaltet (347), liegt in<br />
den Intentionen der Herausgeber und runden das Bild ab.<br />
Es ist dies jedenfalls ein Buch, das geeignet ist, die Sinnfrage,<br />
die sich unseren Patienten und damit auch uns stellt, einmal abseits<br />
der Tageserlebnisse zu beleuchten.<br />
Dr. Michael Peintinger, Referent für Ethik und Palliativmedizin der<br />
Ärztekammer für Wien.<br />
Service: „Endliches Leben. Interdisziplinäre Zugänge zum Phänomen<br />
der Krankheit“ von Markus Höfner, Bochum, Stephan<br />
Schaede, Heidelberg, und Günter Thomas, Bochum (Hrsg.).<br />
2010. 378 Seiten. ISBN 978-3-16-150113-5. Mohr Siebeck,<br />
Tübingen.<br />
5
Service<br />
6 5|11<br />
notdienste<br />
Diensthabende Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Juni 2011 (von 20.00 – 1.00 Uhr)<br />
01. Dr. Schafhauser Roman 369 83 00 19., Krottenbachstraße 106/Stg. 3<br />
02. Dr. Balduin-Stark Brigitte 485 48 48 16., Baumeistergasse 1/14/1<br />
03. Dr. Ehrenzweig Alfons 804 53 60 13., Hietzinger Hauptstraße 3<br />
04. Prim. Dr. Riha Oswald 480 88 88 17., Dornbacher Straße 43/6<br />
05. DDr. Sas Oliwer 535 31 11 01., Schottengasse 4/34<br />
06. Dr. Wuketich Otto 480 80 88 16., Redtenbachergasse 55/1/8<br />
07. DDr. Tasch Maximilian 877 83 91 13., Altgasse 23/5<br />
08. Dr. Perkovic Ekaterina 470 33 74 18., AntonFrankGasse 4/11<br />
09. DDr. Mann Jonathan 767 23 98 11., Miltnerweg 32/4/3<br />
10. Dr. Kunz Sibylle 486 03 61 17., Hern<strong>als</strong>er Hauptstraße 97<br />
11. Dr. Hock Jasmin 603 09 73 10., Keplergasse 16<br />
12. Dr. Nemetz Barbara 712 24 55 03., Barichgasse 2<br />
13. Dr. Schneider Christian 712 45 96 03., Schlachthausgasse 20<br />
14. MR Dr. Dichtl Winfried 712 57 59 03., Radetzkystraße 19/8<br />
15. Dr. Schwarz Marcus 290 51 05 21., Brünner Straße 188/7<br />
16. Dr. Niefergall Irmgard 604 24 86 10., Herzgasse 1519/1/3<br />
17. Dr. Jakesch Herbert 544 27 11 05., Reinprechtsdorfer Straße 29<br />
18. Dr. Drnek Martina 493 16 38 16., Herbststraße 116/9/3<br />
19. DDr. Gyanti Istvan 869 34 65 23., Dirmhirngasse 25/2/4<br />
20. Prim. DDr. Selli Abdullah Edmond 319 78 98 09., Berggasse 25/18<br />
21. Dr. Pabisch Alfred 713 17 59 03., Neulinggasse 28/3<br />
22. Dr. Rieder Lucia 815 94 26 12., Theresienbadgase 4/3<br />
23. Dr. Karner Angelika 332 56 82 20., Treustraße 9092/3/7<br />
24. Dr. Bamer Johannes 774 74 00 22., Esslinger Hauptstraße 76/6/1<br />
25. MR Dr. Wicke Susanne 368 61 31 19., Kreindlgasse 18<br />
26. Dr. Elias Michael 350 66 66 20., Othmargasse 25/57<br />
27. Dr. Laudenbach Gerd 893 63 25 15., Mariahilfer Straße 215<br />
28. Dr. Maarfia Joanna 815 61 15 12., Schönbrunner Straße 219/10<br />
29. DDr. Klimscha Johannes 269 87 77 22., LeonardBernsteinStraße 46/Stg. 10<br />
30. Dr. Kurz György 813 78 44 12., Flurschützstraße 23/1/1<br />
Wochenend- bzw. Feiertagsdienst (Samstag, Sonn- und Feiertag von 9.00 – 18.00 Uhr) Juni 2011<br />
2. – 5. Juni 2011<br />
DDr. Deinhofer Edith 523 71 14 07., Kaiserstraße 5/17<br />
DDr. Tasch Maximilian 877 83 91 13., Altgasse 23/5<br />
Dr. Janas Adela 332 53 16 20., Engerthstraße 81/2<br />
DDr. Dem Alex*<br />
11. – 1 . Juni 2011<br />
402 03 07 09., Pelikangasse 15<br />
DDr. Sas Oliwer 535 31 11 01., Schottengasse 4/34<br />
DDr. Seemann Wolfgang 893 42 45 15., Mariahilfer Straße 167/10<br />
DDr. Friede-Lindner Ingrid 368 42 52 19., Gymnasiumstraße 62<br />
ao. Univ.Prof. DDr. Solar Peter*<br />
18. – 1 . Juni 2011<br />
890 28 89 08., Lange Gasse 76/16<br />
DDr. Griessnig Renate 728 38 81 02., MaxWinterPlatz 21/8<br />
Dr. Gorea Pastorel 604 51 03 10., Reumannplatz 17/2/10<br />
DDr. Eberhardt Rita<br />
2 . – 26. Juni 2011<br />
914 82 50 14., Zehetnergasse 28/3/2<br />
DDr. Fälbl-Fuchs Ursula 713 91 91 03., Landstraßer Hauptstraße 9/19<br />
Dr. Seemann Irene 406 88 84 08., Lange Gasse 72/10<br />
DDr. Sulek Christian 985 38 16 14., Linzer Straße 103<br />
Dr. Mamut EmilFlorin ** 888 19 43 23., Marktgemeindegasse 4450/4/5<br />
* nur privat ** keine Betriebs und Gebietskrankenkasse, nur KFA, SVA
DER KOMMENTAR VON AUSSEN VON DR. JOSEF PüHRINGER<br />
Spitzenmedizin nachhaltig absichern<br />
Mit der Spit<strong>als</strong>reform II will Oberösterreich eine „Großaktion der Vorsorge“<br />
zur nachhaltigen Absicherung der Spitzenmedizin im Land durchführen. Derzeit<br />
liegt der Vorschlag der Expertenkommission auf dem Tisch. Die Politik<br />
wird in den nächsten Wochen entscheiden.<br />
� Dem Expertenvorschlag ging ein zehnmonatiger<br />
Diskussionsprozess voraus. Alle<br />
Beteiligten, aber auch die Bürger, waren<br />
eingeladen, Reformvorschläge und Ideen<br />
einzubringen. Bemerkenswert dabei: 90<br />
Prozent der Reformvorschläge kamen aus<br />
den Krankenhäusern selbst.<br />
Die Expertenkommission orientierte sich<br />
bei ihrer Arbeit an folgenden strategischen<br />
Grundsätzen:<br />
n Definition des Versorgungsauftrags je<br />
Krankenhaus und Abstimmung der Leistungsbereiche<br />
zwischen den Standorten<br />
(abgestufte Versorgungsstruktur)<br />
n Schwerpunktsetzung unter Berücksichtigung<br />
regionaler Besonderheiten<br />
n Bereinigung von Parallelstrukturen<br />
n Schaffung und Neuorganisation von<br />
Kompetenzzentren, wie zum Beispiel in<br />
den Bereichen Onkologie, Gefäßchirurgie,<br />
Thoraxchirurgie<br />
n Berücksichtigung von Qualitätskriterien,<br />
wie zum Beispiel Mindestfallzahlen<br />
n Entwicklung moderner Organisationsmodelle,<br />
wie zum Beispiel standortübergreifende<br />
Abteilungen und Wochenkliniken<br />
n verstärkte Kooperation zwischen den<br />
Krankenanstalten, auch trägerübergreifend,<br />
etwa durch Krankenhausverbünde<br />
n gemeinsame Nutzung medizinischer<br />
Supportbereiche, wie etwa im Bereich<br />
der Mikrobiologie, der Pathologie und<br />
des Labors<br />
n Effizienzsteigerung in Organisation und<br />
Verwaltung<br />
n Initiierung von Modellprojekten mit<br />
verbesserter Planung und Steuerung<br />
zwischen dem intra- und extramuralen<br />
Bereich<br />
Die Spit<strong>als</strong>reform ist so angelegt, dass keine<br />
Krankenhäuser geschlossen und keine<br />
Mitarbeiter gekündigt werden. Die Reform<br />
arbeitet lediglich mit den Instrumenten des<br />
natürlichen Abgangs durch Pensionierungen<br />
und der Versetzung. Damit soll das<br />
Kostenwachstum im Spit<strong>als</strong>bereich bis zum<br />
Jahr 2020 hochgerechnet um 362 Millionen<br />
Euro pro Jahr gedämpft werden.<br />
Wichtig ist mir dabei, dass es hier nicht um<br />
simples Sparen geht. Bei dieser Reform<br />
wird die Qualität nicht verschlechtert, sondern<br />
es wird Geld für andere Maßnahmen<br />
frei, wie etwa für eine Anschubfinanzierung<br />
für eine Medizinuniversität oder Maßnahmen<br />
in der Gesundheitsprävention.<br />
Auch nach Durchführung der Spit<strong>als</strong>reform<br />
ist eine umfassende Ausbildung für<br />
alle Ärztinnen und Ärzte in den oberösterreichischen<br />
Spitälern gesichert. Alle derzeit<br />
in Ausbildung befindlichen Ärztinnen<br />
und Ärzte werden ihre Ausbildung in Oberösterreich<br />
abschließen können, teilweise<br />
natürlich in anderen Häusern, aber in unserem<br />
Bundesland, weil die Organisationsund<br />
Reformmaßnahmen zeitlich so angesetzt<br />
werden, dass die Ausbildung derer,<br />
die sich in Ausbildung befinden, nicht gefährdet<br />
wird beziehungsweise entsprechende<br />
Ausbildungsmöglichkeiten in anderen<br />
Häusern zeitgerecht zur Verfügung<br />
stehen werden.<br />
Nach vorliegenden Informationen plant<br />
der Bund bereits jetzt eine verpflichtende<br />
Schluss<br />
punkt<br />
Dr. Josef Pühringer ist<br />
Landeshauptmann und<br />
Gesundheitsreferent des<br />
Landes Oberösterreich.<br />
Rotation in den Fächern Anästhesie, Gynäkologie/Geburtshilfe,<br />
Radiologie, Chirurgie<br />
und Innere Medizin. In Oberösterreich<br />
gibt es bereits jetzt Vollausbildungsstellen<br />
mit der Auflage der Rotation in ein anderes<br />
Krankenhaus.<br />
Kann die Ausbildung nicht zur Gänze im<br />
„Stammkrankenhaus“ erbracht werden,<br />
ist es die Aufgabe des Trägers, Ausbildungskooperationen<br />
mit anderen Krankenhäusern<br />
einzugehen. Diese standortübergreifende<br />
Form der Ausbildung hat<br />
sich auch bisher bewährt. In diesem<br />
Fall unterzeichnen beispielsweise zwei<br />
ärztliche Direktoren den Ausbildungsvertrag.<br />
Beste Ausbildungsqualität<br />
Das Land Oberösterreich plant gemeinsam<br />
mit der Oberösterreichischen Ärztekammer<br />
und den Spit<strong>als</strong>trägern die Einrichtung<br />
einer Landesausbildungskommission,<br />
die sich mit Fragen der<br />
Ärzteausbildung auseinandersetzt. In der<br />
Sicherstellung der ärztlichen Ausbildung<br />
werden dabei Themen wie Qualität und<br />
Organisation der Ausbildung im Mittelpunkt<br />
stehen. Besonderes Augenmerk<br />
wird auf die Sicherung der Ärzteausbildung<br />
in den regionalen Spitälern gelegt.<br />
Die Landesausbildungskommission soll<br />
auch Anlaufstelle für junge Ärztinnen und<br />
Ärzte sein, wenn Fragen im Zusammenhang<br />
mit der Ärzteausbildung auftreten.<br />
Weiters soll es eine Clearingstelle geben,<br />
die jene Mitarbeiter begleitet, die von<br />
Maßnahmen der Spit<strong>als</strong>reform unmittelbar<br />
betroffen sind. Für die Klärung von<br />
dienst- und besoldungsrechtlichen Fragen<br />
soll die Clearingstelle bei Bedarf auch ver-<br />
�<br />
• Die im „Schlusspunkt“<br />
getätigten Äu-<br />
ßerungen stellen ausschließlich<br />
die Meinung<br />
des Autors/der<br />
Autorin dar und müssen<br />
sich weder in rechtlicher<br />
noch in inhaltlicher<br />
Hinsicht mit der<br />
mittelnde Gespräche mit den betroffenen Meinung der Ärztekam-<br />
Rechtsträgern führen.<br />
mer für Wien decken.<br />
7
38<br />
Kontakt<br />
5|11<br />
kleinanzeigen<br />
Philips Ultraschall Vorführgeräte günstig<br />
abzugeben. Verschiedene Einsatzbereiche.<br />
Einwandfreier Zustand. 12 Monate Garantie.<br />
Nähere Informationen: Hr. Kundi,<br />
0676/786 57 46.<br />
Klavierstimmaktion, € 80,– in Wien/€ 90,–<br />
außerhalb. Alles inkl. Erfahrener Fachmann<br />
besucht Sie! Tel.: 0676/686 61 62.<br />
Internet: www.pianoservice.at,<br />
E-Mail: pianoservice@pianoservice.at.<br />
Praxisgemeinschaft19 bietet interessierten<br />
Kollegen Mitbenützung von modernen Ordinationsräumlichkeiten<br />
im Time-Sharing-<br />
Prinzip. Erstklassige Lage in 1190 Wien in<br />
unmittelbarer Verbindung zur Privatklinik<br />
Döbling. Nähere Informationen unter 01/505<br />
43 82 und www.praxisgemeinschaft19.at.<br />
BDI-FORTBILDUNG<br />
Intensivkurs Geriatrie<br />
Wien, 24. – 26.06.2011. Schwerpunktthemen:<br />
Therapie von Lungenerkrankungen,<br />
Zahngesundheit, Darminfektionen,<br />
Reisen, Impfungen, Delir beim älteren Patienten,<br />
Sturz und Sturzprävention, Rehabilitation,<br />
Ethik, u.v.m.<br />
Leitung: Dr.med. H. Werner, Oberursel,<br />
PD Dr.med. J. Bauer, Oldenburg.<br />
DFP-Punkte: vorraus. 16 (Kategorie A).<br />
Anmeldung:<br />
Berufsverband Deutscher Internisten e.V.<br />
Tel.: 0049611181 3322 /21<br />
Fax: 0049611181 3323<br />
fortbildung@bdi.de, www.bdi.de.<br />
Für ORDINATIONSGEMEINSCHAFT geeignete<br />
Räumlichkeiten von PRIVAT günstig zu<br />
verkaufen: 400 m 2 , 2 Eingänge, separat begehbare<br />
Räume, Frequenzlage 1030 Wien.<br />
Kontakt: Dr. Ebert, Tel.: 0664/184 82 64.<br />
Nachfolge in einer Gruppenpraxis für Innere<br />
Medizin in Wien 1. mit allen Kassen.<br />
Gesucht eine Fachärztin oder Facharzt für<br />
Innere Medizin/Kardiologie.<br />
Bewerbungen werden erbeten an<br />
ebm@praxisklinik.at.<br />
Wahlarztpraxis ab sofort zu vergeben:<br />
– Geräumige Ordination in zentraler, bester<br />
Verkehrslage in 1070 am Spittelberg/<br />
Gutenberggasse 1, noch in Betrieb<br />
– Für gynäkologische Eingriffe nach neuesten<br />
Standards und Auflagen adaptiert<br />
(Behördengenehmigung erteilt):<br />
OP-Raum, Liegeraum, Umkleideraum,<br />
Instrumentenvorbereitungsraum, Wartezimmer,<br />
Besprechungszimmer, Teeküche<br />
plus div. Nebenräume<br />
Auskunft unter:<br />
+43 (0)664/208 01 27,<br />
+43(0)1/526 11 86; m.radauer@gmx.at.<br />
Vermietung: alternativ-medizinische Wahlarztpraxis<br />
an PsychotherapeutInnen, OsteopathInnen,<br />
MasseurInnen, halb-/ganztagsweise,<br />
€ 50,–/Halbtag/Monat, 5. Bez. verkehrsgünstig,<br />
Lift: 01/876 49 18.<br />
1010 Schwedenplatz<br />
repräsentatives Jugendstilhaus, internistische<br />
Praxis bietet einen Ordinationsraum<br />
im Time-Sharing an.<br />
Tel.: 0664/737 595 08 abends.<br />
1130 Wien, Jagdschloßgasse 40/2/1.<br />
Geboten wird eine Privatordination mit 3<br />
separaten Behandlungsräumen, Balkon,<br />
Warteraum, WC und Bad. Gesamt 81 m 2 .<br />
Es handelt sich um ein Mietobjekt von<br />
Wienerwohnen. Miete derzeit € 548,– inkl.<br />
Betriebskosten.<br />
Preis für Ablöse verhandelbar. Kontakt:<br />
0699/108 014 06 oder 0699/812 558 76<br />
oder per Mail: natalie.oehl@gmx.at.<br />
Das Kriseninterventionszentrum sucht<br />
eine/n Arzt/Ärztin mit ius practicandi oder<br />
eine/n Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie<br />
für 20 Wochenstunden ab sofort befristet<br />
bis August 2012.<br />
Tätigkeitsbereich: Krisenintervention, Kurzpsychotherapie,<br />
medikamentöse Therapie.<br />
Voraussetzung: Psychotherapeutische Ausbildung<br />
(eingetragen in die PsychotherapeutInnenliste<br />
des BMG oder FachärztInnen<br />
auch mit PSY3), psychiatrische Vorerfahrung,<br />
Bereitschaft, in einem gleichberechtigten<br />
interdisziplinären Team zu arbeiten.<br />
Bewerbungen per E-Mail oder schriftlich mit<br />
kurzem beruflichem Curriculum Vitae an:<br />
Dr. Claudius Stein, Ärztlicher Leiter,<br />
Lazarettgasse 14A, 1090 Wien,<br />
verwaltung@kriseninterventionszentrum.at.<br />
Raumkonzepte nach Feng Shui für Ordinationen.<br />
Dipl.-Ing. Li Wen PAK<br />
www.liwenpak.com, 0699/194 625 46,<br />
fengshui@li-wen-pak.com.<br />
Privatordination gesucht? Bei uns finden<br />
Sie moderne Ordinationsräumlichkeiten in<br />
bester Lage! Barrierefrei, Nähe AKH, hochwertige<br />
Ausstattung, Serviceleistungen, Kollegen<br />
unterschiedlicher Fachrichtungen, uvm.<br />
Infos unter 01/890 90 10. www.medpoint.at.<br />
Augenarztordination überdurchschnittlich<br />
gut ausgestattet und vollständiges Optikergeschäft<br />
zu übernehmen oder zu verkaufen.<br />
14./15. Bezirk. Telefon: 0660/211 44 01.<br />
Nachfolger/in für Praxisübernahme ab Ende Juni 2011 gesucht<br />
Biete Praxisübernahme ab Ende Juni 2011 im Gesundheitszentrum Hetzendorf an.<br />
Vorzugsweise an PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, Wahlärzte zu übergeben.<br />
Auch eine Nutzung <strong>als</strong> Büroräumlichkeit ist möglich.<br />
• Größe: 90 m² • zwei separat begehbare Therapieräume mit Balkonzugang, großer<br />
Warteraum, WC, Dusche, Küche, Abstellraum, behindertengerecht, Lift, Parkmöglichkeit,<br />
beste Infrastruktur • Miete: € 837,50 pro Monat (inklusive Betriebskosten) • Genossenschaftsmietvertrag<br />
(Untervermietung möglich) • Ablöse nach Vereinbarung.<br />
Besichtigungstermin nach telefonischer Vereinbarung.<br />
Kontakt: Telefon: 0664/262 37 65, E-Mail: c.i.f@gmx.at, Ort: Gesundheitszentrum<br />
Wien Hetzendorf, Eckartsaugasse 7/1/P6A, 1120 Wien.
Die Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien schreibt für<br />
die Krankenanstalt Sanatorium Hera – ein sehr renommiertes Privatkrankenhaus,<br />
das höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht wird – eine<br />
Stelle <strong>als</strong><br />
Facharzt/Fachärztin für Anästhesie<br />
und allgemeine Intensivmedizin aus.<br />
Wir suchen eine engagierte und leistungsbereite Persönlichkeit mit<br />
kooperativem Arbeitsstil.<br />
Sie haben Interesse und Freude, Ihre fachliche Erfahrung und Kompetenz<br />
in unser Team einzubringen, und besitzen<br />
• vertiefte Kenntnisse vor allem in der Regionalanästhesie<br />
(ultraschallkontrolliert)<br />
• und in der Schmerztherapie<br />
• ein Notfalldiplom,<br />
dann sind Sie unser Wunschkandidat.<br />
Bewerbungen richten Sie bitte an die Stellvertreterin<br />
des Ärztlichen Direktors des Sanatoriums Hera:<br />
Fr. Prim. a Dr. Brigitte Baumann<br />
Löblichgasse 14<br />
1090 Wien<br />
bbaumann@hera.co.at<br />
Kleinanzeigen<br />
kleinanzeigen<br />
Kontakt<br />
Wir sind bei 10.768 Ärztinnen und Ärzten,<br />
... die ihre Kammerpost elektronisch bekommen!<br />
„Es sind nur mehr wenige 100 Wiener Ärztinnen und<br />
Ärzte, die weiterhin nicht auf die Zusendung ihrer Kammerpost<br />
auf Papier verzichten wollen. Mein erklärtes<br />
Ziel ist es, diese von der Sinnhaftigkeit des Umstiegs<br />
auf unser E-Mail-Service zu überzeugen. Der Umweltgedanke<br />
ist hier sicher nicht der Hauptaspekt, aber trotzdem<br />
ein wichtiger Beitrag.<br />
Daher: Steigen Sie um – JETZT!“<br />
Ihr Vorteil, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse bekannt<br />
geben: Der Newsletter wird von der Ärztekammer versandt<br />
und informiert Sie wöchentlich über Topaktuelles<br />
aus Standes- und Gesundheitspolitik, Diskussionsveranstaltungen,<br />
Pressekonferenzen, et cetera.<br />
Sichern <strong>als</strong>o auch Sie sich Ihren Informationsvorsprung und melden Sie<br />
uns Ihre E-Mail-Adresse, an die Sie zukünftig die Massenaussendungen<br />
der Wiener Ärztekammer sowie den Newsletter zugeschickt bekommen<br />
wollen:<br />
Abteilung Internet – Neue Medien, EMail: internet@aekwien.at,<br />
Tel.: 515 01/1444 DW, Fax: 515 01/1480 DW.<br />
Jörg Hofmann,<br />
Referent für Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Kommunikation<br />
und Medien der<br />
Ärztekammer für<br />
Wien<br />
Wortanzeigen pro Wort: € 2,60. Wortanzeigen pro Wort fett: € 3,10. Chiffregebühr: € 15,–. Rahmen: € 17,– (zuzüglich 20% MwSt.)<br />
Anzeigenannahme:<br />
Medizin Medien Austria, 1050 Wien, Wiedner Hauptstraße 120–124, Sylvia Saurer, Tel.: 01/54 600112, Fax: 01/54 600710, EMail: saurer@medizinmedien.at<br />
In der<br />
Magistratsabteilung 15 – Ambulatorium<br />
zur Diagnose und Behandlung sexuell<br />
übertragbarer Krankheiten<br />
gelangt die Stelle der/des hauptberuflichen<br />
ärztlichen Leiterin/Leiters<br />
(Leiterin/Leiter im Sinne des § 12 Abs. 3 Wiener Krankenanstaltengesetz<br />
1987) zur Besetzung.<br />
Anstellungserfordernisse sind:<br />
• Österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit einer der anderen<br />
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum<br />
oder der Schweiz. (Die Übergangsbestimmungen zur EU-Erweiterung<br />
– § 32 a Ausländerbeschäftigungsgesetz BGBl. Nr. 218/1975 i.<br />
d.g.F. – sind zu beachten.)<br />
• Doktorat der gesamten Heilkunde<br />
• Anerkennung <strong>als</strong> Fachärztin/Facharzt für Haut und Geschlechtskrankheiten<br />
• Eignung zur Leitung des Ambulatoriums im Hinblick auf Organisation und<br />
Personalführung<br />
• Erfolgreich absolvierter Lehrgang einer Managementausbildung für Einrichtungen<br />
des Gesundheitswesens<br />
Vorzulegen sind:<br />
• Geburtsurkunde<br />
• Staatsbürgerschaftsnachweis<br />
• Promotionsurkunde<br />
• Facharztanerkennung<br />
• Verwendungszeugnisse<br />
• Lebenslauf<br />
• Nachweis einer Managementausbildung<br />
Die Anstellung bzw. Betrauung mit der Funktion erfolgt vorerst für die Dauer<br />
von 2 Jahren.<br />
Es wird ersucht, Bewerbungen bis spätestens 7. Juni 2011 an die Magistratsabteilung<br />
15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien, Servicestelle Personal,<br />
ThomasKlestilPlatz 8/2, 1030 Wien zu richten.<br />
Nähere Informationen zu der in Rede stehenden Stelle unter:<br />
www.wien.gv.at/recht/gemeinderecht-wien/posten-kag/index.html.<br />
Auskünfte und Anforderung von Anforderungsprofil und Arbeitsplatzbeschreibung:<br />
Servicestelle Personal der Magistratsabteilung 15<br />
Tel.: +43 1/40 00-87266, E-Mail: personal@ma15.wien.gv.at.<br />
39
LASSEN SIE SICH<br />
KEINE PUNKTE DURCH<br />
DIE LAPPEN GEHEN<br />
Auf www.meindfp.at können Sie Ihre Fortbildung ganz einfach<br />
organisieren, absolvieren und dokumentieren.<br />
Damit Ihnen kein einziger DFP-Punkt verloren geht.<br />
Und das ist nur einer der vielen Vorteile von www.meindfp.at.<br />
Partner von meindfp, 2011<br />
rz_DFP_dalmatiner_az_A4.indd 1 18.01.2011 9:29:23 Uhr