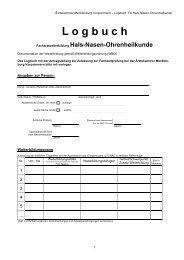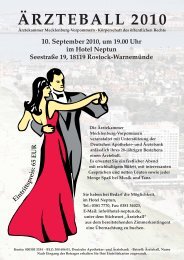Ärzteblatt Mai 2006 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärzteblatt Mai 2006 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Ärzteblatt Mai 2006 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ein weiteres interessantes Thema des Symposions war der<br />
Fortpflanzungsmedizin gewidmet. In Deutschland herrscht<br />
dazu eine sehr restriktive Haltung. Es ist zwar typische<br />
Wunschmedizin, doch aus medizinischer, psychischer, sozialer<br />
aber auch ethischer Sicht gibt es genügend diskussionswürdige<br />
Aspekte die vorhandenen Verbote im Embryonenschutzgesetz<br />
(ESCHG) von 1990 zumindest zu lockern. So ist die<br />
hierzulande verbotene Eizellspende in vielen anderen Ländern<br />
erlaubt und den Paaren bleibt nur der Medizintourismus.<br />
Die Lebendgeburtenraten nach Eizellspende sind in Großbritannien<br />
und den USA deutlich höher als die homologen IVF-<br />
Verfahren. Untersuchungen bestätigen auch eine normale<br />
sozio-emotionale Entwicklung der Kinder. Die verbotene Präimplantationsdiagnostik<br />
kann aus humangenetischer Sicht<br />
als eine erlaubte pränatale Diagnostik angesehen werden.<br />
Juristisch soll das ESCHG auch die Gefahren von Mehrlingsschwangerschaften<br />
und von Fetozid vermeiden. Insgesamt<br />
wird es aber dem medizinischen Fortschritt nicht gerecht. Die<br />
Statusfrage des Embryos wird sich aus vielerlei politischen,<br />
soziologischen und religiösen Gründen nicht klären lassen.<br />
Das ethische Dilemma dieses Teils der Wunschmedizin ist weiterhin<br />
ungeklärt.<br />
In der Geburtsmedizin, steht der Wunsch mancher Frauen<br />
auf eine Entbindung durch Sektio aus persönlichen Gründen<br />
in der öffentlichen Diskussion. Die elektive Sektio ohne medizinische<br />
Indikation hat heute bei optimaler ärztlicher Betreuung<br />
eine sehr geringe Morbidität und Mortalität. Risiken<br />
entstehen jedoch für nachfolgende Schwangerschaften und<br />
vaginale Geburten (Plazentalösungsstörungen, Rupturen,<br />
Atonie-Blutungen). Die Risiken für das Kind sind bei vaginaler<br />
Geburt wiederum eher größer.<br />
Rechtlich ist der „Kaiserschnitt“ ohne medizinische Indikation<br />
kein Heileingriff. Der Patientenwille ist jedoch juristisch<br />
zu unterstützen, wenn keine gesundheitlichen Gründe dagegen<br />
sprechen. Für die Aufklärung über die Risiken und die<br />
Einwilligung der Schwangeren ist der Arzt im Streitfall beweispflichtig.<br />
Die höheren Kosten (d.h. Einnahmen) für die<br />
Schnittentbindung sollten dem Geburtshelfer, der übrigens<br />
nicht zur Wunschsektio verpflichtet ist, nicht als Entscheidungsgrund<br />
dienen. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen<br />
prüft im übrigen sehr genau.<br />
Eigentlich keine Wunschmedizin ist das doch seltene Thema<br />
der Transsexualität. Es sind zwar die Wünsche der Patienten,<br />
die deren Leidensdruck auslösen und verstümmelnde Operationen<br />
zur Folge haben. 1987 hat das Bundessozialgericht<br />
diesen Leidensdruck als behandlungsbedürftige Krankheit<br />
im Sinne des Krankenversicherungsrechts bewertet. Dabei<br />
gibt es bis heute keine objektiven physiologischen Parameter<br />
für das Vorliegen einer Transsexualität. Psychotherapie über<br />
AUSGABE 5 / <strong>2006</strong> 16. JAHRGANG<br />
KONGRESSBERICHT<br />
einen längeren Zeitraum und der so genannte „Alltagstest“<br />
neben den üblichen ärztlichen Maßnahmen werden deshalb<br />
vor einer eher „geschlechtsangleichenden“ (P. Althaus) Operation<br />
gefordert. Die „Standards der Behandlung und Begutachtung<br />
von Transsexuellen“, von einer Expertenkommission<br />
1997 veröffentlicht, gelten als medizinische und auch juristische<br />
Orientierungshilfe. Die umfangreiche Patientenaufklärung<br />
über die Risiken und die Irreversibilität eines operativen<br />
Eingriffs muß der Operateur in eigener Verantwortung wahrnehmen.<br />
Zur Wunschmedizin gehört letztlich auch das kontrovers diskutierte,<br />
in den Praxen unterschiedlich gehandhabte Thema<br />
„Individuelle Gesundheitsleistungen“ (IGeL).<br />
Zweifel bestehen nicht bei den ärztlichen Maßnahmen, die<br />
ohne Bezug zu einer Krankheit vom Patienten (Kunden) gewünscht<br />
werden („Schönheitsbehandlung“).<br />
Die Vertreterin der Bundesärztekammer spricht zu Recht von<br />
einer großen Uneinheitlichkeit bei den individuellen medizinischen<br />
Leistungen, von dem fragwürdigen Stellenwert mancher<br />
Methoden und von einem berufspolitischen „Geburtsfehler“.<br />
Die Kostenunterdeckung einer Praxis sollte eigentlich<br />
kein Argument für IGeL sein! Leider ist die tatsächliche Situation<br />
anders! Es muß aber wiederholt und eindringlich darauf<br />
hingewiesen werden, daß eine privatärztliche Behandlung<br />
vom Patienten verlangt werden muß. Darüber ist nach Aufklärung<br />
im persönlichen Gespräch – auch über Alternativen –<br />
die schriftliche Dokumentation gefordert.<br />
Die Verlagerung von Leistungen des medizinischen Fortschritts<br />
für Zustände mit echtem Krankheitswert in den<br />
Selbstzahlerbereich ist nun offensichtlich politisch gewollt.<br />
Das wird immer weniger zu umgehen sein. Die privaten Versicherer<br />
haben schon reagiert. So gehört es zur Philosophie<br />
der DKV und ihrer Tochterunternehmen qualitätsgesicherte<br />
individuelle Gesundheitsleistungen zusätzlich zu versichern.<br />
Der Jurist sieht bei Zuständen mit Krankheitswert den Kassenarzt<br />
in einer komplizierten Situation! Nach der Sozialgesetzgebung<br />
(§ 2 Abs. 1 SGB V) haben Qualität und Wirksamkeit<br />
medizinischer Leistungen dem allgemein anerkannten<br />
Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und<br />
den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen! Danach<br />
haben GKV-Patienten also Anspruch auf Teilhabe am medizinischen<br />
Fortschritt! Im Sozialgesetzbuch heißt es, daß die<br />
Leistungen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten<br />
dürfen. Die Interpretation des Notwendigen erfolgt durch<br />
den Gemeinsamen Bundesausschuß, also letztlich sozialrechtlich.<br />
Damit wird aber das Leistungserbringungsrecht des Arztes<br />
gegenüber dem Leistungsanspruch des Kassenpatienten<br />
eingeschränkt. Man könnte – sicher überspannt – auch sagen:<br />
Beschränkung bedeutet Behandlungsfehler für den Arzt!!<br />
Für den Vertragsarzt entsteht so eine spezielle Aufklärungs-<br />
SEITE 167